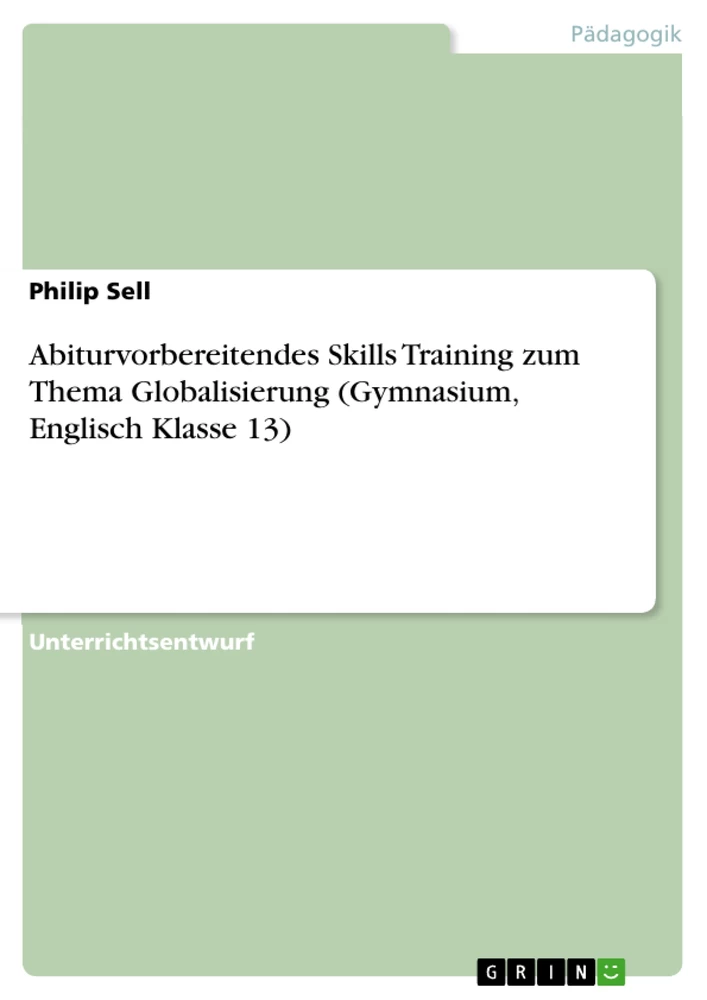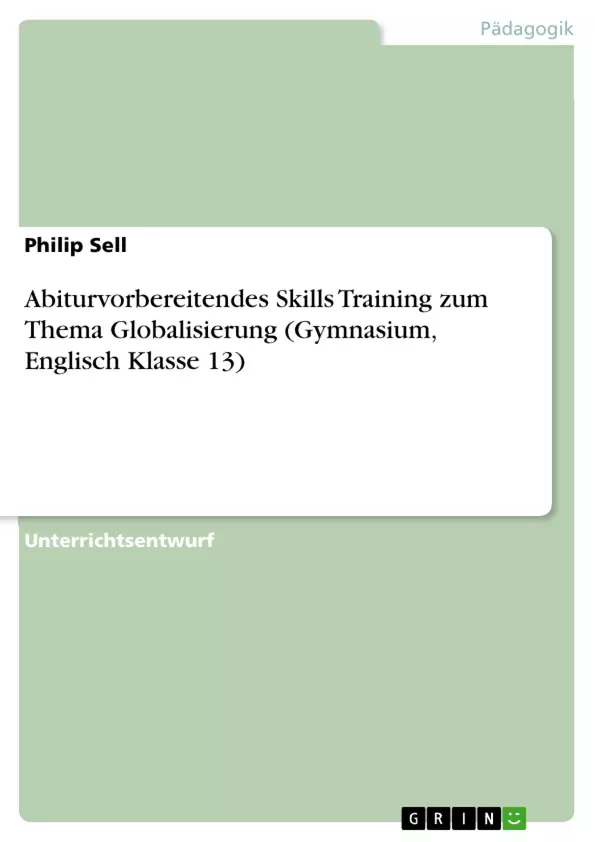Ziele dieses Unterrichtsentwurfes zum Thema Globalisierung mit dem Fokus auf dem kreativen Schreiben sind: die SuS festigen ihre fremdsprachlichen Fertigkeiten im Schreiben durch das selbstständige Verfassen und Korrigieren eines Texts (Letter oder Article) und nehmen dabei Bezug auf ein Zitat, welches als Textgrundlage dient, die SuS kontrollieren gegenseitig die entworfenen Texte und bewerten diese nach den vorgegebenen Kriterien, die SuS bekommen Kenntnisse über die verschiedenen Textsorten vermittelt und wenden diese kreativ und produktiv an (Sachkompetenz), die SuS wenden ihr methodisches Wissen über das Verfassen von Texten und deren einzelnen Teilabschnitten an (Methodenkompetenz), die SuS organisieren ihren Arbeitsablauf in der Gruppe selbstständig und verteilen Aufgaben eigenständig (Sozialkompetenz), die SuS identifizieren sich mit den betroffenen Kleinhändlern und nehmen eine andere Perspektive ein (Selbstkompetenz/interkulturelle Kompetenz).
Obgleich schon vor Jahrzehnten an den deutschen Schulen das Ziel ausgerufen wurde, die mündliche Kommunikationsfähigkeit zu steigern, wurde das Schreiben nicht zurückgedrängt und zählt noch heute zu der am häufigsten ausgerufenen Tätigkeit im Englischunterricht. Das Schreiben trägt als Ausdruck von Gedanken zu einer bestimmten Thematik Relevantes zur Bildung sprachlicher und kommunikativer Kompetenzen bei. Die Lernenden intensivieren durch das kreative Schreiben ihren Sprachkontakt. Darüber hinaus ermöglicht es aus didaktischer Perspektive eine effiziente Individualisierung. Dank der langsamen und aufmerksamen Sprachverarbeitung ist es beim Schreiben möglich, bereits beherrschte Elemente mit neuen Strukturen zu verbinden, was im mündlichen Sprachgebrauch schwieriger zu realisieren ist. Ein weiterer positiver Aspekt des Schreibens ist die in der Regel hohe Aufmerksamkeit, welche fast zwangsläufig zu einer Auseinandersetzung mit der Sprache an sich führt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Bedingungsanalyse
- 2. Sachanalyse
- 3. Unterrichtsziele
- 3.1. Grobziele
- 3.2. Feinziele
- 4. Didaktische Analyse
- 4.1. Stellenwert des kreativen Schreibens
- 4.2. Kompetenzbereiche
- 5. Methodische Analyse
- 6. Reflexion
- 6.1. Organisation, Grundlegendes und Bedingungen
- 6.2. Durchführung
- 6.3. Persönliche Reflexion
- 7. Bibliografie
- 8. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Unterrichtseinheit/Projekt „Abiturvorbereitung Skills Training“ zielt darauf ab, Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 13 im Fach Englisch Fähigkeiten und Fertigkeiten im Bereich des kreativen Schreibens zu vermitteln. Die Einheit soll ihnen helfen, sich auf die Abiturprüfung vorzubereiten und ihre Kompetenzen im Bereich des kreativen Schreibens zu erweitern.
- Entwicklung und Bedeutung des kreativen Schreibens
- Theorie und Praxis des kreativen Schreibens
- Didaktische Ansätze zur Förderung kreativen Schreibens im Englischunterricht
- Kompetenzbereiche und -entwicklung im Kontext des kreativen Schreibens
- Methodische Ansätze zur Umsetzung des kreativen Schreibens im Englischunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Bedingungsanalyse
Dieses Kapitel beschreibt die Rahmenbedingungen der Unterrichtseinheit/Projekts. Es werden die Schule, die Klasse und die Schülerinnen und Schüler vorgestellt. Es werden zudem die Entwicklungspsychologischen Aspekte der Jahrgangsstufe 13 beleuchtet und die Relevanz des kreativen Schreibens im Englischunterricht der Sekundarstufe II hervorgehoben.
2. Sachanalyse
Dieses Kapitel befasst sich mit der Entwicklung des kreativen Schreibens, seinen theoretischen Grundlagen und seiner Praxis. Es werden verschiedene Aspekte des kreativen Schreibens beleuchtet, wie die Bedeutung der Selbstentfaltung und des Neuigkeitswerts. Zudem wird die Frage aufgeworfen, wie Kreativität im Unterricht gefördert werden kann.
3. Unterrichtsziele
Dieses Kapitel definiert die Grob- und Feinziele der Unterrichtseinheit/Projekts. Es wird beschrieben, welche Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler am Ende der Einheit erworben haben sollen.
4. Didaktische Analyse
Dieses Kapitel untersucht den Stellenwert des kreativen Schreibens im Englischunterricht und beleuchtet die relevanten Kompetenzbereiche.
5. Methodische Analyse
Dieses Kapitel beschreibt die methodischen Ansätze, die in der Unterrichtseinheit/Projekt zum Einsatz kommen sollen.
6. Reflexion
Dieses Kapitel beinhaltet eine Reflexion der Organisation, Durchführung und der persönlichen Erfahrungen im Zusammenhang mit der Unterrichtseinheit/Projekt.
Schlüsselwörter
Kreatives Schreiben, Englischunterricht, Abiturvorbereitung, Sekundarstufe II, Kompetenzbereiche, Didaktik, Methodische Ansätze, Reflexion, Entwicklungspsychologie, Selbstentfaltung, Neuigkeitswert, Schreibblockaden.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist kreatives Schreiben im Englischunterricht wichtig?
Es fördert die sprachliche und kommunikative Kompetenz, ermöglicht eine intensive Auseinandersetzung mit der Sprache und hilft Schülern, komplexe Themen wie Globalisierung aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten.
Welche Textsorten werden für das Englisch-Abitur trainiert?
Im Fokus stehen vor allem formelle Briefe (Letters) und Zeitungsartikel (Articles), bei denen die Schüler lernen, auf Zitate oder Textgrundlagen Bezug zu nehmen.
Was ist das Ziel des Skills Trainings zur Globalisierung?
Die Schüler sollen ihre Fertigkeiten im Verfassen und Korrigieren von Texten festigen, methodisches Wissen anwenden und sich interkulturell mit der Situation betroffener Kleinhändler weltweit auseinandersetzen.
Wie wird Kreativität im Unterricht gefördert?
Durch offene Aufgabenstellungen, Perspektivwechsel und die Möglichkeit zur Selbstentfaltung, wobei Schreibblockaden durch strukturierte methodische Ansätze abgebaut werden.
Welche Rolle spielt die Sozialkompetenz in diesem Projekt?
Die Schüler organisieren ihren Arbeitsablauf in Gruppen selbstständig, verteilen Aufgaben eigenständig und bewerten gegenseitig ihre Entwürfe nach vorgegebenen Kriterien.
- Citar trabajo
- Philip Sell (Autor), 2018, Abiturvorbereitendes Skills Training zum Thema Globalisierung (Gymnasium, Englisch Klasse 13), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/994860