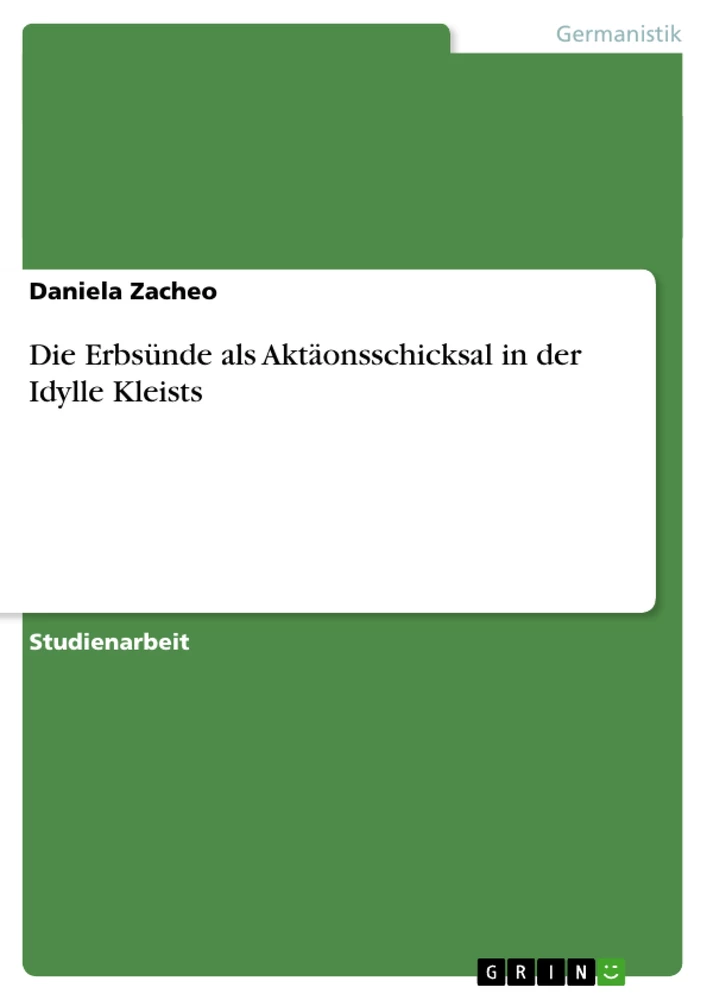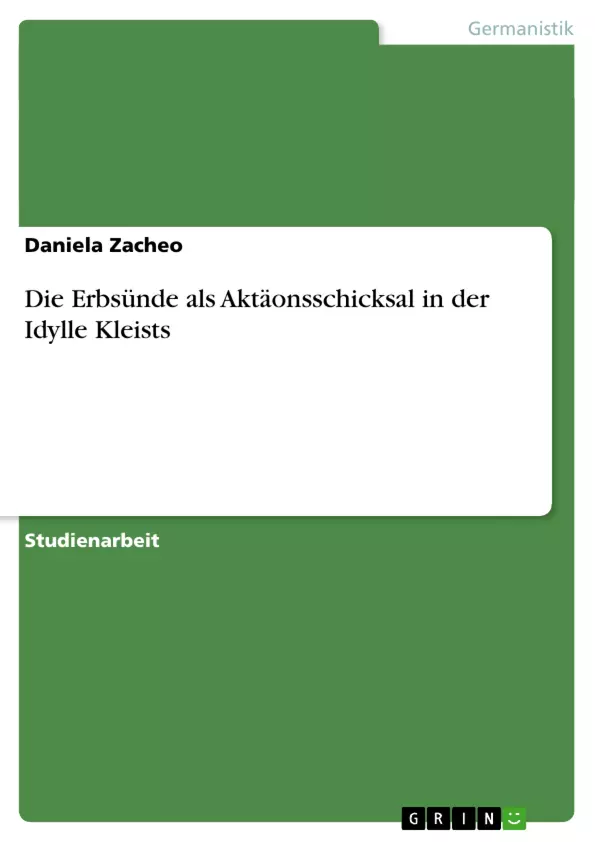Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Hauptteil
2.1 Darstellung einer Idylle
2.2 Der Schrecken im Bade
2.3 Diana und Aktäon
2.4 Das Aktäonsschicksal
3. Zusammenfassung
4. Anhang
4.1 Der Schrecken im Bade
4.2 Diana und Aktäon
5. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Im Februar 1809 veröffentlicht Heinrich von Kleist im letzten Heft Phöbus eine Idylle unter dem Titel ,Der Schrecken im Bade`. Diese unterscheidet sich von seinen grösseren Dichtungen einmal durch einen offenen Schluss, und Kleist erlaubt dem Leser, anhand von den äusseren Vorgängen einen höheren Motivzusammenhang zu erkennen. Die Handlung weitet sich also weit über das Geschriebene hinaus und erscheint dem Leser aus diesem Grund eher als eine Studie oder wie Ringleb1 es nennt als ,mehr schematisch angedeutet als dichterisch ausgeführt`.
Ringleb bestätigt sogar, dass man aus der Offenheit des Themas, dem der Konzeption nach ihm zugehörigen, aber nicht ausgeführten Hintergrund und dem studien- oder keimhaften Charakter der Idylle wohl schliessen kann, dass Kleist hier sich selbst in seinen wesentlichen Lebensmotiven begegnet. In seinem Brief vom 7. Januar 1805 schrieb Kleist an Ernst von Pfuël:
Ich habe deinen schönen Leib oft, wenn Du in Thun vor meinen Augen in den See stiegest, mit wahrhaft mädchenhaften Gefühlen betrachtet.
Kleist betrachtet seinen Freund mit mädchenhaften Gefühlen, Johanna hingegen gibt sich als Mann, während sie Grete beobachtet. Ganz im Gegensatz zu dem heidnisch-antiken Modelle Aktäons, der Diana im Bade belauscht, zu dem ebenfalls heidnischen Modell Melusines und dem biblisch-antiken Modell von Susanna im Bade muss für Kleist die badende Person keineswegs immer weiblich und die beobachtende immer männlich sein. In all den genannten Beispielen geht es um den die Identität der Frau bedrohenden männlichen Blick, in allen Fällen führt die Situation zu Sanktionen mit tödlichem Ausgang.
Bei Kleist stirbt niemand. Ein Mann ist nicht immer ein Mann, eine Frau nicht sicher eine Frau. Seine Anschauungen zeugen aber nicht von einem Wunsch nach der Vereinheitlichung der Geschlechter, sondern von der modernen Anschauung der menschlichen Sexualität. Kleist hat sich in vielen seiner Werke intensiv mit dem weiblichen Triebwesen befasst. Vor allen andern sind hier sicher die ,Marquise von O.` und ,Penthesilea` erwähnenswert. Plötzlich ist es nicht mehr der Mann, der die Frau beobachtet und begehrt, sondern die Frau, die danach verlangt, beobachtet und begehrt zu werden. Und genau mit diesem Thema befasst sich Kleist in seiner Idylle.
Parallel zum ,Schrecken im Bade` muss die Geschichte von Diana und Aktäon aus den ,Metamorphosen` von Ovid betrachtet werden, denn sogar Johanna vergleicht die Situationen Gretes und Dianas miteinander. Auch sind laufend Symbole und Anspielungen zu finden, die auf die Dianafabel verweisen.
Unter anderem wird darin die Frage der Schuld und Unschuld aufgeworfen und auch Kleist nahm sich derselben in seiner Idylle an. Seine modernen Anschauungen führten ihn aber zu einer ganz anderen Schlussfolgerung, als die moralischen Betrachtungen, die zu Kleists Zeiten den Mensch beherrschten. Ein Ausschnitt aus Goethes ,Dichtung und Wahrheit` zeigt die etwas andere, für uns schon fast prüde scheinende Auffassung von Nacktheit2:
Unter die damaligen Verrücktheiten, die aus dem Begriff entstanden, man müsse sich in einen Naturzustand zu versetzen suchen, gehörte denn auch das Baden im freien Wasser, unter offnem Himmel; und unsere Freunde konnten auch hier, nach allenfalls überstandener Schicklichkeit, auch dieses Unschickliche nicht unterlassen. Darmstadt, ohne fliessendes Gewässer, in einer sandigen Fläche gelegen, mag doch einen Teich in der Nähe haben, von dem ich nur bei dieser Gelegenheit gehört. Die heiss genaturten und sich immer mehr erhitzenden Freunde suchten Labsal in diesem Weiher; nackte Jünglinge bei hellem Sonnenschein zu sehen, mochte wohl in dieser Gegend als etwas Besonderes erscheinen; es gab Skandal auf alle Fälle. Merck schärfte seine Konklusionen, und ich leugne nicht, ich beeilte unsre Abreise.
2. Hauptteil
2.1 Die Darstellung einer Idylle
Bereits der Titel verrät, dass die Idylle, wie sie hier von Kleist zu Papier gebracht wurde, keinen Bestand haben kann. Das Wort ,Schrecken` hängt bedrohlich über dem Bild der Idylle, das sich überhaupt noch nicht selbst erschaffen hat. Die antiken Idyllen des 18. und 19. Jahrhunderts preisen das einfache, ländliche, naturverbundene Leben, im Gegensatz zur städtisch-regen Unruhe. Von jeher ist der Idylle das Vorläufige, Pausen- oder Ferienhafte zu eigen, sie ist Darstellung, auch aufgeführte Feier der Genesung zur Natur, findet sich aber stets zurückgewiesen in eine innerlich bestimmte Alltäglichkeit. Sie handelt meist von Menschen, die mit der Natur, den Tieren und Pflanzen eins werden, mit ihrer Umwelt verschmelzen.
Tismar3 spricht in der Einleitung zu ,Gestörte Idyllen' von vier Kriterien, die sich in einer Idylle erfüllen müssen.
1. Idylle meint Wunschbild von einem in sich ruhenden, ungefährdeten Dasein, das in eingestandener Selbstbeschränkung sich von den Sensationen der sozialen und politischen Veränderung fernhält und dabei einen Mythos von herrschaftsfreien Zuständen bewahrt.
2. In dieser Eigenschaft hat die Idee von Idylle ein Nähe zur Utopie. In beiden erträumt sich der Mensch glückliche Verhältnisse, nur die Zielrichtung ist verschieden. Utopia heisst der Ort, in dem eine bessere als die gegenwärtige Sozialverfassung denkbar erscheint. In die Idylle zieht der Träumende sich aus seinen anstehenden Verhältnissen zurück und blickt auf vergangen Zustände, die er in seiner Vorstellung vergoldet.
3. Die Imagination von idyllischen Zuständen braucht handfeste Absicherungen, sie baut Zäune und Mauern um die kleine Wunschlandschaft herum. Vor allem sucht sie natürliche Begrenzungen: Waldenklaven, Grotten, verschollene Reste einer alten Siedlungsweise mitten in der expansiven Stadtzivilisation; damit wird die Einbettung in einen harmonisch verstandenen Naturzusammenhang behauptet.
4. Daher fassen die geschlossenen Räume, in denen Idylle manifest werden soll, häufig auch die Reservate einer poetischen Ausdruckskonvention ein, und eben dieser funktionelle Zusammenschluss bringt die Idyllik leicht in den Einzugsbereich von Trivialität.
Die Möglichkeit eines idyllischen Lebens eröffnet sich erst durch seine Gebrochenheit und hebt damit den Sinn der Idylle auf. Mit anderen Worten kann eine Idylle nur durch ein entgegengesetztes Wissen entstehen, das in der Literatur sowohl auf der Ebene des Schriftstellers, als auch auf derjenigen des Lesers vorhanden sein muss. Bei Jean Paul4 wird die Idylle als ,epische Darstellung des Vollglücks in der Beschränkung` bezeichnet. Dieses Glück sei ,immer ein Widerschein eueres früheren kindlichen` und in ihm spiegle sich ,der Zauber euerer Erinnerung`. Ganz klar werden bei Jean Paul Leidenschaften von der Idylle ausgeschlossen. Im Gegensatz dazu macht Kleist aus seinen idyllischen Darstellungen gewagtere Experimentierfelder.
In vielen seiner Werke wird zu irgendeinem Zeitpunkt eine Idylle nach den Kriterien Tismars oder Jean Pauls aufgebaut. Doch lässt er die Geschlossenheit der Idylle aufgrund der Leidenschaften gegen aussen hin aufbrechen. Laut Ringleb5 sind bei Kleist ,die Idyllenregionen im Grunde die subjektiven Zonen des Herzens, die Aussparung einer idyllischen Landschaft erfolgt zunächst nicht als objektive Szenerie`. In der Familie Schroffenstein beschreibt Ottokar ein solches Bild, das einmal die Kulisse für Agnes` Taufakt darstellte:
Ich fand dich schlafend hier in diesem Tale, Das einer Wiege gleich dich bettete.
Ein schützend Flordach webten dir die Zweige, Es sang der Wasserfall ein Lied, wie Federn Umwehten dich die Lüfte, eine Göttin Schien dein zu pflegen. - Da erwachtest du, Und blicktest wie mein neugeborenes Glück Mich an. (Vers 1256 ff.)
In diesem Abschnitt befinden sich typische Fragmente einer Idylle: grünender Naturraum (Tal), Laubschatten, bergender Hain, sprudelndes Wasser, laue Lüfte. Auch in der Grottenszene im letzten Akt spielen sich die Ereignisse in einer schützenden, alle äusseren Einflüsse abschirmenden und aus diesem Grunde idyllischen Höhle ab. Und schliesslich ist es genau diese Idylle, die dem Liebespaar zum Verhängnis wird6.
Auch in ,Das Erdbeben von Chili` entwirft Kleist eine Idyllik:
Sie ging, weil niemand kam, und das Gewühle der Menschen anwuchs, weiter, und kehrte sich wieder um, und harrte wieder; und schlich, viel Tränen vergiessend, in ein dunkles, von Pinien beschattetes Tal, um seiner Seele, die sie entflohen glaubte, nachzubeten; und fand ihn hier, diesen Geliebten, im Tale, und Seligkeit, als ob es das Tal von Eden gewesen wäre. (...) Indessen war die schönste Nacht herabgestiegen, voll wundermilden Duftes, so silberglänzend und still, wie nur ein Dichter davon träumen mag. Überall, längs der Talquelle, hatten sich, im Schimmer des Mondscheins, Menschen niedergelassen, und bereiteten sich sanfte Lager von Moos und Laub, um von einem so qualvollen Tage auszuruhen.
Und schliesslich ist an dieser Stelle noch eine Szene aus der ,Hermannsschlacht` mit eindeutig idyllischen Elementen erwähnenswert:
Dies ist der stille Park, von Bergen eingeschlossen,
Der, auf die Lispelfrage: wo?
Mir gestern in die trunknen Sinne fiel!
Wie mild der Mondschein durch die Stämme fällt!
Und wie der Waldbach fern, mit üppigem Geplätscher, Vom Rand des hohen Felsens niederrinnt! - Thusnelda! Komm und lösche diese Glut, Soll ich, gleich einem jungen Hirsch,
Das Haupt voran, mich in die Flut nicht stürzen! (5.Akt, 17. Auftitt)
Die Idylle sollte das Bild einer erfüllten Welt, eines Arkadiens oder Elysiums im Stande der Unschuld sein. Doch auch im Wort Unschuld ist die Schuld schon beinhaltet, es gibt keine Unschuld ohne das Wissen über den Stand der Schuld.
2.2 Der Schrecken im Bade
Der Stand der Unschuld stellt sich bei Kleists einziger Idylle im wirklichen Sinn des Wortes schon in den ersten paar Zeilen in Frage. Als ,von List durchtrieben` (Zeile 1)7 wird Grete bezeichnet und ,gleich, als scheute sie den Duft der Nacht` (3) bereitet sie ihren nächtlichen Ausflug vor. Nicht dass sie ihn scheut, diesen Duft, der später im Gedicht als ,der Glieder Duft` (37) von Johanna noch einmal angetönt wird. Grete ist sich dessen bewusst und ,knüpft geschäftig ein Tuch sich ums Kinn` (4). Sie will ein erkranktes Lamm pflegen. Das Wort Lamm löst in uns allgemein die Assoziation Opfer- oder eben Unschuldslamm aus, was die Idee der Schuld/Unschuld von einer anderen, diesmal symbolischen Seite her aufgreift. Es wird besagt, dass das Lamm krank oder zumindest bedroht sei - um mit einem Augenzwinkern auf die metaphorische Unschuld zu verweisen.
Dies ist jedoch nicht das vollständige Bild, das Johanna dem Leser als Voraussetzung in das Gedicht mitgibt, denn nur wenige Zeilen später öffnet sich ihm noch eine ganz andere Welt mit neuen Horizonten. Eine Welt, in der die Gipfel der Alpen sich nicht nur auf der Seeoberfläche spiegeln, sondern sogar eintauchen. Die eigentlich starre Ebene des Spiegels wird durchbrochen, es ist unklar, was oben und unten steht, denn eigentlich müssten Alpengipfel in den Himmel ragen, nicht unter den Wasserspiegel des Bergsees tauchen.
Ringleb8 spricht hier von einer ,metaphorisch überhöhten Spiegelverkehrtheit`, während in Kleists Briefen folgende Lehrfrage an seine Braut zu finden ist:
Gesetzt du fändest... den Satz, dass die äussere (vordere) Seite des Spiegels nicht eigentlich bei dem Spiegel die Hauptsache sei, ja, dass diese eigentlich nichts weiter ist, als ein notwendiges Übel, indem sie das eigentliche Bild nur verwirrt, dass es aber hingegen vorzüglich auf die Glätte und Politur der inneren (hinteren) Seite ankomme, wenn das Bild recht rein und treu sein soll-welchen Wink gibt uns das für unsere eigne Politur, oder wohin deutet das?
Die Frage nach diesem nicht-physikalischen Eintauchen einerseits und der Spiegelung andererseits öffnet uns die Tore zum Verständnis der Idylle, legt uns aber zugleich wieder viele Steine in den Weg. Auf einmal ist nichts mehr so wie es scheint, es gibt mehr Ebenen als erwartet, Metapher, Bedeutung, Symbol und Ausdruck verschmelzen oder sind so verwirrend ineinandergewebt, dass es schwierig sein wird, sich einen zuverlässigen Weg durch dieses Gedicht zu bahnen. Der Leser steht diesem Gedicht so unvorbereitet gegenüber, wie der ,arme herzdurchglühte Mensch` (18) den Naturgewalten und der Göttlichkeit. Folgende Situation wird beschrieben: Grete badet nackt im See, umgeben von einsamer Natur, Mondschein und dann hört sie dieses Flüstern. Zuerst scheint es nur von den sich im Winde wiegenden Bäumen zu kommen, von der raschelnden Silberpappel9. Doch mit einem Mal weiss Grete, dass die Stimme nur Fritz, ihrem Verlobten, den sie morgen heiraten wird, gehören kann, sie ist sich dessen sicher, und hätte sie ihn ,nicht die Büchse ergreifen sehen` (30), hätte sie sogar ,schwören mögen, dass ers war` (31).
Grete interpretiert die sie umgebende Natur als Fritz, denn tief in ihr drin erscheint ihr ihre Schlussfolgerung als logisch. In ihrem Unterbewusstsein befindet sich dieses Gefühl von Unschuld und Schuld, Sitte und Unsitte und sie hat eine Vorstellung davon, wie es ist, nackt von einem Mann beobachtet zu werden. Sie weiss über Dinge wie Verlangen und Sexualität Bescheid. Nur aus diesem Grund muss sie in ihrer Situation an Fritz denken. Bestimmt hat sie sich in der letzten Zeit vor der Hochzeit mit diesen Themen befasst. So stark anscheinend, dass ihr diese, hervorgerufen durch den Hauch einer Stimme im einsamen Wald, bewusst werden. Sie projiziert ihre Angst, ihr Begehren und die Phantasie des Vom-Manne-gesehen- Werdens auf die Natur und das Flüstern, das sich für den Leser schon von Beginn an als Johanna zu erkennen gibt. Ihr Verlangen beschwört sozusagen den Bräutigam als geistig anwesend in die Einsamkeit. Dass diese Einsamkeit eigentlich eine Zweisamkeit ist, ist zu diesem Zeitpunkt belanglos. Auch Johanna ist überrascht, Grete an solch einem Punkt erwischt zu haben. Es ist die Badende allein, die ihr den Anstoss dazu gibt, die Rolle von Fritz zu übernehmen. Grete hat einen schmutzigen und unreinen Gedanken zugelassen und ist es jetzt nicht mehr würdig, im See zu baden. In diesem Moment fällt die Idylle zusammen, und es wird dem Leser - abgesehen vom Titel - erst durch ihre Zerstörung bewusst, dass zu Beginn das Bild einer Idylle geschaffen wurde.
Etwas Unreines, von Schuld Beladenes stört das idyllische Bild, und es ist nicht etwa Johanna, die räumlich betrachtet eingedrungen ist, sondern ein Bewusstwerden im Innern Gretes. Es ist die Schuldigkeit, die ihr zwar schon vorher innegewohnt hat, ihr aber nie zu Bewusstsein gekommen war.
Die folgenden Worte Johannas umspannen eine weitere Welt, nämlich die mystische Welt der griechischen Gottheiten. Johanna vergleicht die Situation, in der sich Grete befindet, mit einer Passage aus Ovids ,Metamorphosen`10. Sie spiegelt die ganze Szene in der Dianafabel. Auf diesen Sachverhalt werde ich später noch ausführlicher eingehen.
Schon in den nächsten Zeilen erkennt der Leser, dass die friedliche Ruhe endgültig aufgehoben ist.
O seht doch, Wie das Gewässer heftig, mit Gestrudel, sich über ihren Kopf zusammenschliesst! (51-53) Grete versucht verzweifelt, ins Wasser abzutauchen, sich im schützenden See vor den Männeraugen, die sie auf ihrem Körper spürt, zu verbergen und sich irgendwie reinzuwaschen. Doch es gelingt ihr nicht, denn wie Johanna beschreibt, taucht sie nicht ,wollüstig wie ein Hecht` (21), sondern wie die ,Ente` (51) und ähnlich einer ,Ratz` (57).
Beides sind Tiere, die zwar schwimmen und tauchen können, nicht aber im Wasser heimisch sind. Auch Grete ist nach dem Bewusstwerden ihrer Situation nicht mehr im Wasser Zuhause, sie passt nicht mehr dorthin. Sie muss, rein aus ihrer inneren Logik heraus, vom Wasser verstossen werden. Dieses Dasein, wo man nicht hingehört verdeutlicht Kleist ganz ausdrücklich mit einem kleinen Satz, der auch bei mehrmaligem Lesen immer noch verwirrt:
,In Halle sah ich drei Halloren tauchen, ...` (56)
Dieser Satz ist zu realitätsbezogen, als dass er hierhin gehörte. In dieser Kulisse, die Kleist mit der Idylle aufgezogen hat, erzeugt der Satz einen surrealen Effekt. Er ist für den Leser aufgrund seiner Realität surreal.
Grete versucht, sich durch untertauchen noch aus der Affäre zu ziehen. Glücklicherweise hört sie Johanna nicht, welche die Tatsache anspricht, dass Fritz bald das Recht haben werde, seine Augen offiziell über sie schweifen zu lassen, um Gretes Körper danach ,auswendig` (66) und ,mit geschlossenen Augen` (67) zu beschreiben. Für die aufgeschlossene Grete würde das ein enormer Selbstverlust bedeuten. Sie wäre beraubt von ihrem Privaten, was zu verhindern ihr in Zukunft zwar nicht möglich sein wird, dennoch ,tut sie, als wollte sie den Schleier nehmen, und nie erschaut von Männeraugen sein!` (69-70).
Kurz darauf folgt der Höhepunkt der Idylle und zugleich die Mitte derselben. Grete hält plötzlich still, sie weiss, dass es keine andere Möglichkeit gibt, ausser sich zu ergeben. Dies bedeutet die Aufgabe ihrer sexuellen Immunität, die Hingabe an einen Mann und die komplette Auslieferung ihrer Person. Sie sieht ein, dass sie sich aus der Idylle lösen muss, in die sie erstens nicht mehr passt und die zweitens überhaupt nicht mehr existiert. Nachdem Grete Fritz noch gebeten hat, seinen Blick abzuwenden, steigt sie endlich aus dem Wasser:
Ach wie die Schultern glänzen!
Ach wie die Knie, als säh ich sie im Traum, Hervorgehn schimmernd, wenn die Welle flieht! Ach wie das Paar der Händchen, festverschränkt, Das ganze Kind, als wärs aus Wachs gegossen, Mir auf dem Kiesgrund schwebend aufrecht halten! (89-94)
Es erscheint fast so, als ob nicht Grete selbst aus dem Wasser steigt, sondern der See sie in die Welt gebiert. Schmerzhaft-begeistert und mit vielen Ach begleitet kommentiert Johanna diese Entbindung, dieses Sichtbarwerden der einzelnen Körperteile. Die vielen Diminutivformen, die Johanna vor allem in den folgenden Zeilen verwendet, zeugen von Gretes neuem kindlichen Zustand nach der Geburt aus dem mütterlichen See. Der ganze Vorgang ähnelt dem Erwachen. Grete erwacht in einen neuen, von Schuld beladenen Zustand. Laut Neumann11 macht sich Kleist oft solche Geburtsmetaphern zunutze:
Kleists Ursprungsphantasien richten sich in immer neuen Konstellationen auf die Frage nach dem Setzen eines Anfangs im Chaos, nach der Stiftung eines begründenden Sinnsystems und nach dem endlichen Glücken oder Kollabieren dieses als Urszene gesetzten Beginns.(...) Eigentlich ist das ganze Werk Kleists von solchen ,biologischen` Entstehungsphantasien (und deren Wendung in künstliche Systeme) durchsetzt, die immer wieder von seiner Faszination durch die Zeugung und deren zuletzt unlösbares Rätsel sprechen.
Kurz darauf löst Johanna ihre Täuschung endlich auf - nach der ironischen Benennung dessen, was ihr als Fritz widerfahren wäre, nämlich die ,grosse Not` (113). Johanna gibt sich also zu erkennen. Auch sie ist nur ein ,armer, herzdurchglühter Mensch` (18), der ,äfft` (122), in fremde Röcke steigt und dessen Wunsch es ist, in Siegismunds Brautbett zu liegen. Durch vorgespielte Unbekümmertheit und psychische Unversehrtheit versucht Grete nun, ihre Scham herabzuspielen und das Geschehene ins Lächerliche zu ziehen:
So hätt ich, als du sprachst: ,,Ei sieh, die Nixe!
Wie sie sich wälzet!" und: ,,Was meinst du, Kind; Soll ich herab zu dir vom Ufer sinken?" Gesagt: ,,komm her, mein lieber Fritz, warum nicht? Der Tag war heiss, erfrischend ist das Bad, Und auch an Platz für beide fehlt es nicht". (128-133)
Die Tatsache, dass sie der Täuschung erlegen ist, findet sie nicht so schlimm, ,der kleine Finger` hätte es ihr ,jückend sagen sollen` (127). Sie akzeptiert die reale, menschliche Ungewissheit vor der Täuschungskraft des zweierlei Seins und ihre eigene Unfähigkeit, den Geliebten zu erkennen. Hiermit steht sie ganz im Gegensatz zu Alkmene in Kleists Amphitryon, die ob ihrer eigenen Unfähigkeit in die Verwünschung ausbricht:
Verflucht die Seele, die nicht soviel taugt,
Um ihren eigenen Geliebten sich zu merken! (3. Akt, 11. Auftritt)
Grete bezeichnet sich in der vorausgehenden Zeilen als Nixe, obwohl Johanna dieses Wort nie zuvor gebraucht hat. Die wohl berühmteste Nixe war Melusine12, die den menschlichen Körper angenommen hatte, mit einem Grafen verheiratet war, sich aber jeden Samstag ins Bad einschloss, weil sie einen Tag lang ihren Fischschwanz tragen musste. Eines Tages wurde sie von ihrem Mann bei diesem samstäglichen Bad beobachtet und er vertrieb sie. Im Gegensatz zu anderen Geschichten, zum Beispiel Ovids Dianafabel oder der Susannageschichte aus der Bibel13, wird hier nicht der beobachtende Mann bestraft, sondern die Frau. Die Geschichte der Susanna - übrigens ein beliebtes Motiv in der Malerei, da ein Frauenakt zusammen mit einer Gartenlandschaft dargestellt werden kann - zeigt auch ähnliche Elemente wie Kleists Idylle. Susanna badet nackt im Garten und wird von zwei Alten beobachtet die sie dann sogar bedrängen. Als sie um Hilfe ruft, wird ihr vorerst nicht geglaubt, denn die zwei Männer bezeugen, dass ein dritter Mann mit Susanna im Garten war. Sie wird wegen Ehebruchs zum Tode verurteilt. Daniel kann dann aber durch eine List Susannas Unschuld beweisen und die beiden Alten werden hingerichtet.
Das ,warum nicht?` (131), das Grete im nachhinein als angebrachter zu erwähnen scheint, ist eher eine Frage an sie selbst. Ja warum eigentlich nicht? Im Versuch, die Täuschung Johannas mit einer möglichen Täuschung zu entlarven, um ihre Scham zu bewahren, tritt die Wahrheit mehr und mehr aus ihr selbst hervor. Sie erkennt, Fritz gemeint, verlangt und gerufen zu haben, noch bevor sich Johanna als solchen zu erkennen gab. Sie gesteht ihr Verlangen ein und ist Johanna somit ausgeliefert. ,Dass du zuschanden wärst, du Unverschämte.` (134) Dieser Ausruf ist nicht gegen die Magd gerichtet, sondern gegen sich selber. Das Bad mit Fritz wäre kein metaphorisches Bad gewesen, sondern ein reales und der ,Platz für uns beide` (133), ganz nah bei Fritz, hätte ihre Selbstaufgabe bedeutet. Doch Gretes Mieder wird verschnürt und sie ist äusserlich wieder imstande, sich der Gesellschaft auszuliefern. Das Idyll ist jetzt gänzlich zugrunde gerichtet. Mit der endgültigen Maskerade der Kleidung ist Grete zwar wieder ,krankes Lamm`, aber ein Lamm, das von seiner Krankheit weiss und sein Leben danach ausrichten muss.
2.3 Diana und Aktäon
Während dem Bad der Grete befindet sich Fritz auf der Jagd nach dem Hirsch, der ihnen den Mais zerwühlt hat. Auch Aktäon ist auf der Jagd, aber aufgrund der Hitze fordert er seine Gefährten auf, die ,knotigen Netze` (3.153)14 zu sammeln und die Waffen hinzulegen um ein wenig zu ruhen. Bei Diana gehen die Vorbereitungen in ähnlicher Weise von statten. Sie reicht einer der Nymphen, den Speer, den Bogen und den Köcher. Eine andere breitet dem ausgezogenen Gewande die Arme und zwei lösen ihre Schuhe. Die Schuhe werden zwar aufgeknöpft - ähnlich der Netze Aktäons - ,das frei den Hals umspielende Haar` (3.169) wird
jedoch zum Knoten gebunden, während die Nymphen ihre Haare gelöst tragen. Diana kann sich nicht lösen, da sie ihre eigene strenge Keuschheit zu wahren hat, sie kann sich nie ganz der Idylle hingeben. Hier kann man Parallelen zu Kleists Idylle ziehen. Grete knüpft sich ein Tuch um, bevor sie zum See hinuntergeht. Sie ist sich dem Zwang der Kleidung, der in der Gesellschaft herrscht, bewusst. Beim Baden weichen aber all diese Zwänge von ihr; das Haar ist nicht etwa zum Knoten geknüpft wie bei Diana, sondern leicht ,vom seidnen Band umwunden` (54). In den letzten Zeilen der Idylle wird sie von Johanna wieder zugeschnürt, für die Gesellschaft zurechtgestutzt, indem diese ihr das Mieder senkelt. Nur in einem abgeschirmten Ort - einer Idylle - darf sich eine Frau also gelöst, ohne Kleiderzwang und mit offenen Haaren zeigen.
Bei Ovid kommt hinzu, dass er in den Metamorphosen recht deutlich die absolute Unvereinbarkeit von Erotik und Jagd darstellt. Ovids Figuren sind erst dann bereit für ein erotisches Erlebnis, wenn sie ihre Waffen hingelegt haben. In den Geschichten von Daphne (1.475-478), Io (1.525 ff.) und vor allem bei Callisto (2.415-422) wird dem Leser dieser Gegensatz eindeutig vor Augen geführt. Erstaunlicherweise spielt auch hier der Zustand der Haare in jeder Geschichte symbolisch gesehen eine grosse Rolle. ,Nur eine Binde bezähmt ihre Haare, die regellos liegen` (1.477) heisst es bei Daphne und zu Callisto steht ,Sie bändigt das lässig geknotete Haar mit gewöhnlicher weisser Binde` (2.413).
Aktäon schweift nun planlos durch die ihm fremde Gegend, geleitet von seinem Schicksal oder wie Ovid es schon kurz vorher angedeutet hat: ,Doch, wenn du recht untersuchst, wirst an ihm du finden des Schicksals Schuld, nicht Verbrechen.` (3.141-142). Das Schicksal führt ihn also zu einer Höhle, welche aus ihm ein potentielles Opfer einer sexuellen Schmähung machen wird. Dem Leser muss hier absolut klar sein, dass bei Ovid - im Gegensatz zu anderen Dichtungen15 - Aktäon keinerlei sexuelle Absichten hat. Die Göttin reagiert jedoch auf das einzige Paradigma, das sie versteht, nämlich dasjenige, in dem sie Opfer von einem, ihre Reinheit bedrohenden, Affront wird. Aktäon hat sie nackt gesehen und das reicht ihr. Sie spritzt Wasser in sein Antlitz, verwandelt ihn so in einen Hirsch, der schliesslich von seinen eigenen Jagdhunden zerfleischt wird. Ovid liefert keine Erklärung für Dianas Tat, ausser ihrem Wunsch zu verhindern, dass Aktäon nicht weitererzählen kann, was er gesehen hat. Als Hirsch - Symbol der Leidenschaft und Zeugung; Zeus gab sich oft als solchen aus - kann er nicht mehr sprechen. Bei Ovid bedeutet das Verlieren der Sprache meist den Verlust des menschlichen Status. Sprachverlust steht für Kontrollverlust. Könnte Aktäon seine Hunde beim Namen nennen, wie es Ovid so ausführlich tut (3.206-225), würden sie ihren Meister erkennen und nicht auf die Idee kommen, ihn zu zerfleischen. Das Benennen der einzelnen Hunde hat Kleist in seinem Drama Penthesilea von Ovid übernommen. Penthesilea nennt all ihre Hunde mit ihren Namen und Eigenschaften, bevor sie sich als eine von ihnen auf Achill stürzt. (20. Auftritt)
Grete hat in ihrer Situation nicht die Möglichkeit, Fritz die Menschlichkeit zu rauben. Sie droht zwar, dass er sie nie wieder sehen wird, und dass er sich im Dorf irgendeine Dirne vor den Altar schleppen soll, doch die Macht der Göttin Diana hat sie nicht und auch nicht den Einfluss der Susanna. Aber die Bemerkung mit der Dirne zeigt eindeutig, dass Grete Fritz nicht mehr einen gänzlich menschlichen Status zuschreibt, ihn aber mit jemandem vergleicht, der seine sexuelle Leidenschaft nicht mehr unter Kontrolle hat.
Aktäon verlässt als Hirsch die Höhle, doch erst in einer Wasserspiegelung erkennt er seine neue Gestalt. Auch hier spielt die Symbolik des Spiegels wieder eine wichtige Rolle. Jeder Leser muss sich nun die Frage stellen, wieso die Strafe der Diana so hart ausfällt. Im grössten Teil der Sekundärliteratur wird zu diesem Thema angeführt, dass Aktäon magische Tabus, ungeschriebene Gesetze verletzt habe, die besagen, dass es nicht erlaubt sei, 1) eine Gottheit ohne ihr Einverständnis zu sehen und zu beobachten, 2) einen rituellen Akt mit uneingeweihten, profanen Augen zu betrachten, 3) irgendeine Gottheit oder ein Ritual zu unterbrechen.16
In Ovids Erzählung wird aber nichts dergleichen angedeutet. Was hat es also auf sich mit dieser ungerechten Bestrafung, diesem Schicksal des Aktäon? Ovid selbst fügt am Schluss der Geschichte sogar noch kritisch an, dass es Streit im Urteil darüber gäbe. ,Zwiespalt herrscht im Gerede, den einen dünkte die Göttin heftger als billig, die andern, sie loben sie würdig des strengen Jungfrauentums, und Gründe weiss der und jener zu finden.` (3.253-255) Auch Grete denkt sich Fritz schon als Hirsch, für sie scheint der einzige Ausweg zu sein, ihn nicht mehr vor den Altar zu führen. Als Johanna sich zu erkennen gibt, sagt Grete, sie hätte Fritz zu sich ins Wasser rufen sollen. Auch sie wollte - wie Diana, als diese Aktäon mit Wasser bespritzte - ihn in den Bann des Wasserzaubers ziehen, ihn bestrafen. Es sollte Grete eigentlich schon von Beginn an klar sein, dass es rein symbolisch gesehen nicht Fritz sein kann, der sie beobachtet, da dieser ja gesagt hat, er wolle den Hirsch - Aktäon - erlegen.
Die Frage stellt sich, welche Notwendigkeit Kleist darin gesehen hat, diese Idylle mit Anstoss an die Dianafabel aufzuschreiben. Voraussetzung für alle Figuren und auch für den Leser ist, dass sie deren Verlauf und auch das Prinzip, das dahintersteckt, kennen. Doch was genau beinhaltet dieses Prinzip, das als Grundmuster für die Geschichten von Grete, Diana, Susanna und Melusine gilt? Wieso weiss Grete sofort und instinktiv, dass nur Fritz in Frage kommt?
Wieso bestraft Diana Aktäon so hart, und wieso wird er von seinen eigenen Hunden zerfleischt?
2.4 Das Aktäonsschicksal
Das Aktäonsschicksal trifft nicht einfach nur Männer, die eine Frau beim Baden beobachten und sie nackt sehen. Ovids Geschichte zeigt, dass auch ein Versehen schon ein Vergehen sein kann. Aktäon ist eigentlich unschuldig, doch Diana und die Nymphen wissen von dieser Urschuld des Mannes, die Aktäon schliesslich zum Verhängnis wird. Es ist das natürliche sexuelle Begehren und die Spannung zwischen Mann und Frau. Unschuldig, aber die Natur will es so, kommt er als Hirsch aus der Höhle, gehörnt, als leidenschaftliches Objekt. Dann wird er von seinen eigenen Hunden zerfleischt. Die Hunde, die er selber zu jagen gelehrt hat, richten sich gegen ihren eigenen Meister. Eine Exegese aus dem Mittelalter sieht Aktäon als Jesus und seine Hunde als die Juden, die sich gegen ihn wandten. Weitere, auch moderne Auslegungen besagen, dass die Hunde als Metapher für das eigene schlechte Gewissen stehen. Da Aktäon aber nichts Verwerfliches getan hat, ist sein schlechtes Gewissen unbegründet. Es ist seine blosse Existenz, die ihm zum Verhängnis wird. Er befindet sich zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort, und das ist sein Vergehen. Vielfach wird dieses Aktäonsschicksal als Zweiter Sündenfall interpretiert. Der Zweite Sündenfall, der auch als Erbsünde bezeichnet wird, benennt die seit und durch Adams Sündenfall allen Menschen von Natur aus eigene Sündigkeit. Diese wird durch die geschlechtliche Fortpflanzung weitergegeben und beeinträchtigt das Wesen des Menschen und seine Beziehung zu Gott. Augustinus17 meint hierzu:
Doch sogar das Verursachtsein durch Adam ist eine Modellvorstellung und meint - im Sinne des immerwährenden Heraufführens der Sünde - ein sich im jeweiligen Individuum selbst vollziehendes Überhandnehmen der Sünde, eben die wechselseitig-bedingende Relation von Zustand und selbstursächlicher Annahme bzw. schlichter, freier, mehr oder weniger bewusster, selbständiger und schuldhafter doch immer verurteilenswerter Übernahme der dadurch vorgegebenen Konditionen des Daseins, die traditionell-theologisch als Ursünde bezeichnet wird.
Wenn man mit diesem Wissen den Blick wieder auf Kleists Idylle schweifen lässt, ist ganz klar, wer der Sünder ist. Es ist nicht etwa Fritz. Im Gegenteil, Fritz ist sogar auf der Jagd nach dem Hirsch. In dieser Geschichte wird allein die Sündhaftigkeit Gretes dargestellt. Nicht der Mann ist diesmal der Schuldige - in der Idylle ist nicht einmal ein Mann anwesend, sondern es sind ganz allein die Frauen, die in diesem Fall die Urschuld erkennen. Grete wird mit ihrem eigenen Verlangen, ihrem Begehren konfrontiert und zugleich mit der Unmöglichkeit, sich im See reinzuwaschen.
Kleist hat diese Problematik schon einmal in der ,Marquise von O.` dargestellt. Ob die Marquise schuldig oder unschuldig ist, mag hier irrelevant sein, doch die Frage, ob sie wissend oder unwissend war ist in diesem Zusammenhang interessanter. Neumann18 sagt dazu:
Zum einen geht es in der Novelle Kleists ja ohne Zweifel um das - auch von der zeitgenössischen Philosophie wiederholt angestellte - Experiment auf die Geschlechterrolle und ihren sozialen Ort. Das Erkenntnisziel dieses Experiments ist die Auflösung des Rätsels weiblichen Begehrens. Es gehört zum poetischen Verfahren Kleists, dass er diese Frage nun ihrerseits in zwei Beleuchtungen zeigt. Die Novelle selbst, auf der einen Seite, plädiert für die Unschuldsrolle der Frau; ein Epigramm, demgegenüber, das Kleist gleichfalls veröffentlichte, zeigt eine zynische Desavouierung des Triebwesens Frau, gleichsam aus dem voyeuristischen Blick der Leser erschlossen:
Dieser Roman ist nicht für dich, meinen Tochter, in Ohnmacht! Schamlose Posse! Sie hielt, weiss ich die Augen bloss zu.
Etwa zur gleichen Zeit, als Kleist seine Idylle schrieb, nämlich im April/Mai 1808, erschien im Phöbus sein Doppelepigramm ,Die Susannen` und ,Vergebliche Delikatesse`.
DIE SUSANNEN
Euch aber dort, euch kenn ich! Seht, schreib ich dies Wort euch: Schwarz auf weiss hin: was gilts? Denkt ihr - ich sag nur nicht, was.
VERGEBLICHE DELIKATESSE
Richtig! Da gehen sie schon, so wahr ich lebe, und schlagen (Hätt ichs doch gleich nur gesagt) griechische Lexika nach.
In den zitierten Epigrammen ist die Frau als Leserin, ganz in der Tradition Evas, durch ihr neugieriges Wissen-Wollen charakterisiert. Ihre Neugierde richtet sich auf das immer schon gewusste Geheimnis der Sexualität, das sie hinter allem vermuten. Das neugierige Begehren, das Kleist den Frauen unterstellt, findet sich sowohl bei der Marquise als auch bei den Susannen. Die Susannen, alle Frauen, werden durch Kleist fehlgeleitet, wenn sie hinter den unlesbaren Zeichen des eigenen Namens etwas Ungehöriges vermuten und ,griechische Lexika` nachschlagen, wo sie - ganz gegen ihre Erwartung - Susanna als (keusche) Lilie finden. Neumann19 bemerkt hierzu:
Das Spiel entspinnt sich im Bezug auf eine alte wissenschaftliche Schreibtradition, den Brauch nämlich, verfängliche Stellen im Text in einer Sprache wiederzugeben, die dem Laien unzugänglich ist, in lateinischer Sprache, oder in griechischen Lettern; hier also das Anstössige der Susanna- Geschichte, das der unschuldigen Frau durch den wissenden Mann gleichsam grammatologisch erspart wird. Aber gerade dieses Verfahren setzt das Erkenntnis- als ein Frivolitäts-Spiel in Gang, die Inszenierung des Sündenfalls mit vertauschten Rollen, als Verstehenwollen des Unverständlichen und als Erwachen der sexuellen Neugier zugleich: Wissen und Liebe.
Auf ähnliche Weise wird Grete von Johanna fehlgeleitet, wenn sie glaubt, dass Fritz der Beobachtende sei und sich dann herausstellt, dass es nur ihre Freundin ist. In beiden Fällen geschieht diese Erkenntnis aus dem Inneren der Frau heraus, sie stolpert sozusagen über ihre eigene Neugier nach Sexualität. Und das geschieht allen Menschen, Männern wie Frauen. Aus ihrer eigenen Unschuld heraus entwickelt sich die Schuld, der Zweite Sündenfall, das Aktäonsschicksal.
Die einzige Figur, die das Aktäonsschicksal nicht erleidet ist Diana. Sie ist Symbol der Keuschheit und zwar nicht nur der körperlichen Keuschheit, sondern auch der geistigen. Und genau aus diesem Grund, in ihrer sexuellen Unwissenheit, erkennt sie - um noch einmal auf Ovids Metamorphosen zurückzukommen - die Schwangerschaft von Callisto nicht.
Wäre Diana nicht Jungfrau, sie konnte an tausend Beweisen Ihre Verschuldung erkennen; es heisst, dass die Nymphen es merkten! (2.451-452)
Erst im neunten Monat und als sich Callisto entkleiden muss, bemerkt Diana, dass etwas geschehen war.
Als die Enthüllung geschehn, erweist sich am Körper der Frevel.
Schaudernd steht sie und sucht mit den Händen den Leib zu verdecken.
,Weiche von hier!` ruft Diana aus, ,die heilige Quelle Sollst du nicht schänden!` so wurde sie aus der Gemeinschaft gestossen. (2.462-465) Diana weiss nicht genau, was los ist, dennoch spürt sie, dass ihre innerste Reinheit und der unberührte Ort der Grottenquelle bedroht ist. Die einzige Möglichkeit beides zu bewahren bietet sich ihr in der Verbannung Callistos.
Die Idylle von Diana ist in diesem Zusammenhang gerettet, doch Kleist zeigt mit seiner Geschichte, dass eine Idylle gar nie möglich sein kann, da jeder Mensch die Erbsünde in sich trägt.
3. Zusammenfassung
Der Titel dieser Arbeit ist eigentlich die Antwort auf alle Fragen, die sich mir im Verlauf der Bearbeitung des Themas gestellt haben. Die drei zentralen Bergriffe sind Idylle, Aktäonsschicksal und Erbsünde (oder auch Zweiter Sündenfall).
Idylle
Kleist hat in seinen Werken schon oft Idyllen dargestellt, doch hatten diese nie Bestand. Immer wurden sie durch Leidenschaft oder ganz natürliche Menschlichkeit zerstört. Auch dieser Idylle, die Kleist zum ersten Mal auch offiziell als solche präsentiert, ist das gleiche Schicksal bestimmt. Laut Kleist eröffnet sich die Möglichkeit eines idyllischen Lebens erst durch seine Gebrochenheit und damit ist der Sinn der Idylle aufgehoben. Dem Leser ist bei ,Der Schrecken im Bade` nicht sofort klar, was die Idylle zum Schwanken bringt. Die Parallelität zur Dianageschichte bei Ovid ist jedoch offensichtlich und es ist schliesslich auch diese, welche uns das Tor zum Verständnis von Kleists Gedicht öffnet.
Aktäonsschicksal
Der Begriff Aktäonsschicksal wurde in der Sekundärliteratur zu Ovids Metamorphosen eingeführt. Bei keinem anderen Dichter scheint die Strafe, die Aktäon erleiden muss, so ungerechtfertigt. Zufälligerweise kommt Aktäon bei der Grotte vorbei, in welcher Diana, die Göttin der Keuschheit und Jungfräulichkeit, badet. Er sieht sie nackt und wird deswegen von ihr in einen Hirsch verwandelt. Als er die Höhle verlässt, wird er von seinen eigenen Jagdhunden angegriffen und zerrissen.
Die Interpretation zu dieser Geschichte ist noch heute umstritten, Ovid lieferte uns dafür keine Antwort. Auch eine religiöse oder psychologische Deutung ist schwierig.
Erbsünde
Die Erbsünde ist die nicht selbstverschuldete Schuldigkeit, die jedem Mensch seit dem Sündenfall von Adam und Eva von Geburt an mitgegeben ist. Das Mensch-Sein allein ist also schon Sünde und Schuld. Die Christen fordern zur Erlangung des ewigen Lebens die Tilgung der Erbsünde und begründen damit die Kindertaufe.
Die Erbsünde bezieht sich meist nicht nur auf die blosse Existenz des Menschen, sondern auch auf dessen ,unreines`, geschlechtliches Dasein.
Auch Aktäon ist im Grunde unschuldig, doch die Schuld wurde ihm mit auf den Weg gegeben und er wird bestraft. Die natürliche Begebenheit des Unterschieds zwischen Mann und Frau spielt eine grosse Rolle und das Wissen darüber wird ihm zum Verhängnis. In Gretes Idylle ist es ähnlich. Ihre eigene Sexualität wird ihr bewusst, ihr eigenes Verlangen und das Begehren, welches sie in einem Mann auslösen kann. Zu Gretes und Kleists Zeit war die weibliche Sexualität jedoch immer noch ein tabuisiertes Thema. In der ,Marquise von O.` verbindet Kleist die Bestimmung der Frau durch Beziehung zum Vater, im Zeichen der Asexualität und Familie und die Bestimmung der Frau in ihrem Verhältnis zum geliebten Mann, im Zeichen von Sexualität und Öffentlichkeit. Das Erkenntnis dieser Doppelberufung lässt die Frau ihre Unschuld verlieren. Sie fällt sozusagen ihren Zweiten Sündenfall. Die Idylle ,Der Schrecken im Bade` kann man also neben der ,Marquise von O.` und der ,Penthesilea` zu den Werken Kleists zählen, die sich explizit mit der Sexualität und dem Triebleben der Frau befassen.
4. Anhang
4.1 Heinrich von Kleist, Der Schrecken im Bade. Eine Idylle
4.2 Diana und Aktäon aus Ovids Metamorphosen, 3.131-255
5. Literaturverzeichnis:
Bauer, Dümotz, Golowin: Lexikon der Symbole. Mythen, Symbole und Zeichen in Kultur, Religion, Kunst und Alltag. Wilhelm Heyne Verlag, München, 1990. Bessler, Gabriele: Von Nixen und Wasserfrauen. DuMont Buchverlag, Köln, 1995. Die Bibel. Altes und neues Testament. Einheitsübersetzung. Verlag Herder, Stuttgart, 1980. Gentili, Augusto: Da Tiziano a Tiziano. Mito e allegoria nella cultura veneziana del Cinquecento. Bulzoni Editore, Roma, 1988.
Heath, John: Actaeon, the unmannerly intruder. The myth and its meaning in classical literature. Peter Lang Publishing, Inc., New York, 1992.
Goethe, Johann Wolfgang: Dichtung und Wahrheit. Insel Verlag, Frankfurt am Main, 1965. Koncsik, Imre: Die Ursünde - ein philosophischer Deutungsversuch -. Tectum Verlag, Marburg, 1995
Neumann Gerhard: ,...der Mensch ohne Hülle ist eigentlich der Mensch`. Goethe und Heinrich von Kleist in der Geschichte des physiognomischen Blicks. In: Jahrbuch Kleist 1988/89.
Erich Schmidt Verlag, Berlin, 1988.
Neumann, Gerhard: Skandalon. Geschlechterrolle und transzendentale Familie in Kleists ,Marquise von O.` In: Heinrich von Kleist. Kriegsfall - Rechtsfall - Sündenfall.
Rombach
Druck- und Verlagshaus, Freiburg im Breisgau, 1994.
Ovid: Metamorphosen. Artemis Verlag, Zürich, 1996. Ovid: Metamorphosen. Reclam Verlag, Stuttgart, 1998.
Paul, Jean: Vorschule der Ästhetik. Levana oder Erziehlehre. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1967.
Pfeiffer Joachim: Die zerbrochenen Bilder. Gestörte Ordnungen im Werk Heinrich von Kleists. Verlag Königshausen und Neumann, Würzburg, 1989.
Ringleb, Heinrich: Das Ende der Idyllendichtung. In: Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft 7, 1963, S. 313-351.
Schneider, Helmut J.: Idyllen der Deutschen. Insel Verlag, Frankfurt am Main, 1978.
Tismar, Jens: Gestörte Idyllen. In: Literatur als Kunst. Carl Hauser Verlag, München, 1973. von Matt, Peter: Liebesverrat. Die Treulosen in der Literatur. Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 1999. von Ranke-Graves, Robert: Griechische Mythologie. Quellen und Deutung. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg, 1984.
Titelbild: Paolo Veronese: Diana e Atteone. Museum of Fine Arts, Boston.
[...]
1 Ringleb, Das Ende der Idyllendichtung. In: Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft 7. S. 313/314
2 Goethe, Dichtung und Wahrheit. 4. Teil, 18. Buch.
3 Tismar, Gestörte Idyllen. In: Literatur als Kunst. S. 7-11
4 Jean Paul, Vorschule der Ästhetik. Levana oder Erziehlehre.
5 Siehe Anm. 1
6 Vgl. hierzu: von Matt, Liebesverrat - Die Treulosen in der Literatur. Kapitel VI ,Die Gegenwelt der Liebenden`
7 Die Zeilenangaben beziehen sich auf den Text ,Der Schrecken im Bade` im Anhang, 4.1
8 Siehe Anm. 1
9 Vgl. hierzu: Brief an Luise von Zenge vom 16. August 1801. Darin beschreibt Kleist seine Erlebnisse im Hameau de Chantilly, einem Lustgarten. Es ist die Rede von einem Liebespärchen. ,Wenn sie mit eigentlichen Worten sprachen, so war es ein Laut, wie wenn eine Silberpappel im Winde zittert.`
10 Diana und Aktäon aus Ovids Metamorphosen, 3. Buch, Zeilen 131-255, befindet sich im Anhang, 4.2
11 Neumann, Skandalon. Geschlechterrolle und transzendentale Familie in Kleists ,Marquise von O.` In: Heinrich von Kleist. Kriegsfall - Rechtsfall - Sündenfall. S 127-149
12 Vgl. hierzu: Bessler, Von Nixen und Wasserfrauen. S. 48-52
13 13. Buch Daniel, Die Rettung der Susanna durch Daniel
14 Die Zeilenangaben beziehen sich auf den Text ,Diana und Aktäon` im Anhang, 4.2
15 Vgl. z.B.: Kallimachos, Apollodorus, Apuleius, Nonnus, Hyginus, Hesiod, Pausanias, Fulgentius etc.
16 Heath, Actaeon, the unmannerly intruder. The myth and ist meaning in classical literature. S.67
17 Koncsik, Die Ursünde - ein philosophischer Deutungsversuch -. In: Beiträge aus der Theologie. S.55
18 Siehe Anm. 10
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema von Heinrich von Kleists "Der Schrecken im Bade"?
Die Arbeit analysiert Heinrich von Kleists Idylle "Der Schrecken im Bade" im Kontext des Aktäonsschicksals und der Erbsünde. Sie untersucht, wie Kleist die traditionelle Idyllenvorstellung dekonstruiert und die weibliche Sexualität thematisiert.
Was sind die Hauptthemen im "Schrecken im Bade"?
Die Hauptthemen sind: die Zerstörung der Idylle, die Auseinandersetzung mit Schuld und Unschuld, die Darstellung weiblicher Sexualität, die Parallelen zur Diana-und-Aktäon-Sage sowie die Thematisierung der Erbsünde.
Was ist die Bedeutung des Titels "Der Schrecken im Bade"?
Der Titel deutet darauf hin, dass die Idylle, die im Bade entstehen könnte, durch einen "Schrecken" gestört oder zerstört wird. Das Wort "Schrecken" deutet auf eine Bedrohung der idyllischen Harmonie hin.
Welche Rolle spielt die Diana-und-Aktäon-Sage in der Interpretation des Gedichts?
Die Diana-und-Aktäon-Sage dient als intertextueller Bezugspunkt, um die Themen der Voyeurismus, der Bestrafung und der Transformation zu untersuchen. Johanna vergleicht Gretes Situation mit der Dianas, wodurch die Frage nach Schuld und Unschuld aufgeworfen wird.
Was bedeutet das "Aktäonsschicksal" im Kontext des Gedichts?
Das Aktäonsschicksal symbolisiert die unschuldige Verfehlung, die zu schwerwiegenden Konsequenzen führt. Es steht für die Verletzung ungeschriebener Gesetze oder Tabus, die oft mit dem Blick auf das Verbotene verbunden sind.
Wie wird die Erbsünde in Kleists Idylle dargestellt?
Die Erbsünde wird als die angeborene Sündhaftigkeit des Menschen dargestellt, die durch die geschlechtliche Fortpflanzung weitergegeben wird. In "Der Schrecken im Bade" wird die Erkenntnis der eigenen Sexualität und des Begehrens als ein "zweiter Sündenfall" interpretiert, der die Unschuld zerstört.
Welche Rolle spielt Johanna in der Geschichte?
Johanna fungiert als Auslöser für Gretes Erkenntnis. Durch ihre Täuschung konfrontiert sie Grete mit ihren eigenen verborgenen Wünschen und Ängsten, wodurch die vermeintliche Idylle zerstört wird.
Wie beschreibt der Text Kleists Umgang mit Idyllen in seinen Werken?
Kleist baut in vielen seiner Werke Idyllen auf, lässt sie aber durch Leidenschaften oder äussere Einflüsse zerbrechen. Die Idyllen sind oft subjektive Zonen des Herzens und keine objektiven Darstellungen.
Welche anderen Werke von Kleist werden in diesem Zusammenhang erwähnt?
Es werden "Die Marquise von O.", "Penthesilea", "Familie Schroffenstein" und "Das Erdbeben von Chili" erwähnt, um Kleists Auseinandersetzung mit weiblicher Sexualität, Geschlechterrollen und der Zerstörung von Idyllen zu veranschaulichen.
Was ist die abschliessende Interpretation der Idylle "Der Schrecken im Bade"?
Die Idylle "Der Schrecken im Bade" thematisiert die Unmöglichkeit einer reinen, unschuldigen Existenz, da jeder Mensch die Erbsünde in sich trägt. Durch die Konfrontation mit der eigenen Sexualität verliert Grete ihre Unschuld, wodurch die Idylle zerstört wird.
- Quote paper
- Daniela Zacheo (Author), 2001, Die Erbsünde als Aktäonsschicksal in der Idylle Kleists, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99503