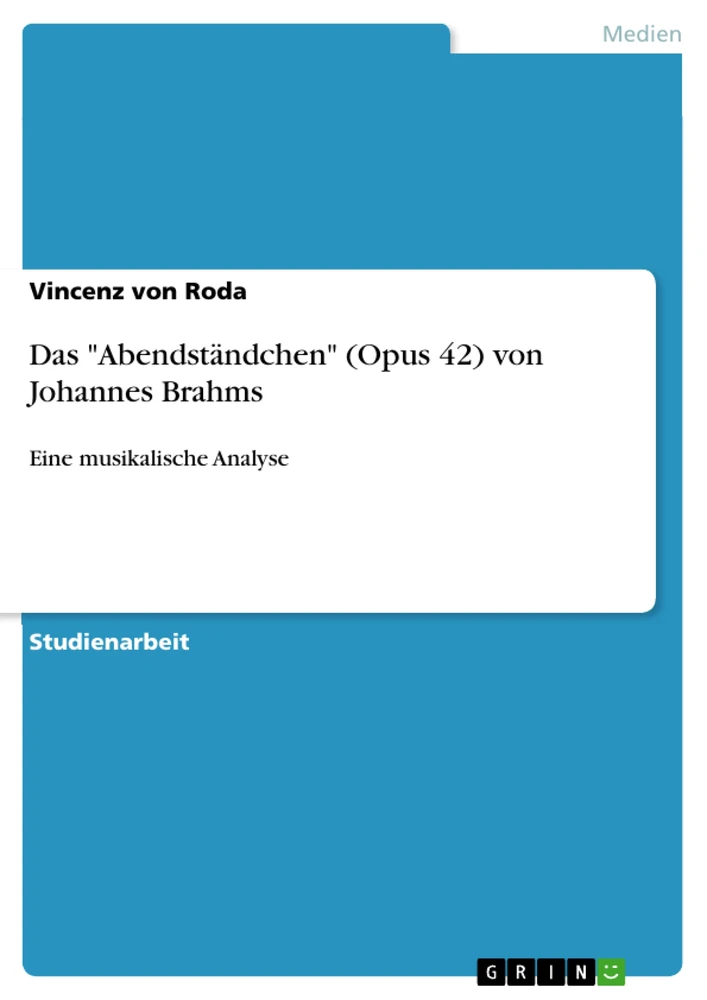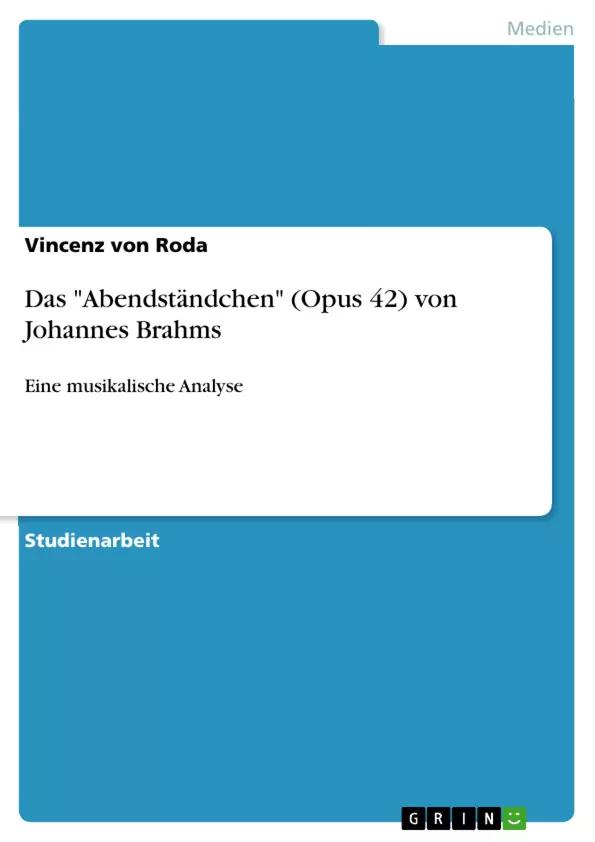Die Arbeit behandelt das „Abendständchen“, Opus 42, von Johannes Brahms. Begonnen wird mit einer kurzen Darstellung der wichtigsten biografischen Eckdaten Johannes Brahms` und der Frage, welche musikalischen Einflüsse er hatte und wer seine Vorbilder oder Mentoren waren? Wie war sein Verhältnis zur Vokalmusik und vor allem zur Chormusik?
Danach wird sich mit seiner Art des Komponierens und seiner Wahl des Textes auseinandergesetzt. Welche Einflüsse hatte Brahms bezüglich seiner kompositorischen Arbeiten? Wie wählte Brahms seine Texte? Vertonte er einen Text direkt, wenn er ihn entdeckte? Wessen Dichtungen nahm er gerne als Vorlage und wo lagen seine Ansprüche an den Text? Darauf folgt eine Kurzbiografie des Dichters Clemens Brentano und eine Einordnung der Verse in den Kontext, aus welchem sie von Brahms genommen wurden. Warum dies für das Verständnis des ganzen Werkes wichtig ist, wird in Kapitel 3 erläutert. Anschließend wird das Stück musikalisch analysiert und versucht herauszufinden, welche Stilmittel Brahms benutzte, um das Stück zu vertonen. Wie arbeitete er mit der Dynamik und dem Rhythmus? Gibt es eine Melodie die eingängig ist und sich durch das ganze Stück hindurch zieht? Kann man das Werk als klassisches Chorlied bezeichnen oder muss man dort Unterscheidungen machen?
Im finalen Teil der Arbeit wird dann versucht, die vorher gefundenen Erkenntnisse auf das Stück zu beziehen. Wie interpretierte Brahms den Text und wie unterstütze er dessen Wirkung durch seine Komposition? Geht Brahms auf den Hintergrund der Verse ein oder reißt er sie komplett aus dem Kontext und gibt ihnen ein neues Gesicht?
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die Analyse des Stückes „Abendständchen“ von Johannes Brahms
- 2.1 Eine Kurzbiographie Johannes Brahms' und Andeutungen zu seinem Verhältnis zur Vokalmusik
- 2.2 Brahms' Art und Ausmaß der Komposition von Vokalmusik und seine Wahl des ,,richtigen\" Textes
- 2.3 Eine Kurzbiografie Clemens Brentanos und Einordnung des Textes
- 2.4 Die musikalische Analyse des Liedes
- 3 Zusammenfassung
- 4 Anhang
- 4.1 Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Analyse von Johannes Brahms' „Abendständchen“ und untersucht die Entstehungsgeschichte des Werkes, die musikalische Struktur und die Bedeutung des gewählten Textes von Clemens Brentano. Ziel ist es, einen tieferen Einblick in das Werk zu gewinnen und dessen Bedeutung im Kontext der Vokalmusik des 19. Jahrhunderts zu beleuchten.
- Johannes Brahms' Biographie und seine Auseinandersetzung mit der Vokalmusik
- Die Wahl des Textes und dessen Einfluss auf die Komposition
- Die musikalische Analyse des „Abendständchens“
- Die Interpretation des Werkes im Kontext von Text und Musik
- Die Bedeutung des „Abendständchens“ in der Musikgeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer kurzen Biographie Johannes Brahms, die auf seine frühen musikalischen Einflüsse, sein Verhältnis zur Vokalmusik und seine Entwicklung als Komponist eingeht. Es wird untersucht, wie Brahms seine Texte auswählte, welche Kriterien für ihn wichtig waren und welche Dichter er bevorzugte.
Im zweiten Kapitel wird die Biografie von Clemens Brentano beleuchtet und der Kontext, in dem die Verse des „Abendständchens“ entstanden sind, näher erläutert. Die Kapitel schließen mit einer musikalischen Analyse des Stücks, die auf die Verwendung von Stilmitteln, die Melodie, den Rhythmus und die Dynamik eingeht.
Schlüsselwörter
Johannes Brahms, Abendständchen, Clemens Brentano, Vokalmusik, Chormusik, Musikgeschichte, musikalische Analyse, Stilmittel, Melodie, Rhythmus, Dynamik, Interpretation.
Häufig gestellte Fragen
Worum handelt es sich beim "Abendständchen" von Johannes Brahms?
Es ist ein Werk für Vokalmusik (Opus 42), das auf einem Text des Dichters Clemens Brentano basiert.
Wie wählte Johannes Brahms seine Texte für Vertonungen aus?
Brahms hatte hohe Ansprüche an die lyrische Qualität. Er vertonte Texte oft nicht sofort, sondern setzte sich intensiv mit deren Gehalt und Struktur auseinander.
Warum ist der Kontext von Brentanos Versen wichtig?
Das Verständnis des ursprünglichen Kontexts bei Brentano hilft zu beurteilen, ob Brahms die Stimmung des Dichters bewahrt oder dem Werk ein völlig neues Gesicht gegeben hat.
Welche musikalischen Stilmittel nutzt Brahms im "Abendständchen"?
Die musikalische Analyse untersucht den Einsatz von Dynamik, Rhythmus und Melodieführung, um die textliche Wirkung zu unterstützen.
Welches Verhältnis hatte Brahms zur Chormusik?
Brahms war tief in der Tradition der Vokal- und Chormusik verwurzelt. Die Arbeit beleuchtet seine Vorbilder und seine Entwicklung in diesem Genre.
- Arbeit zitieren
- Vincenz von Roda (Autor:in), 2019, Das "Abendständchen" (Opus 42) von Johannes Brahms, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/995057