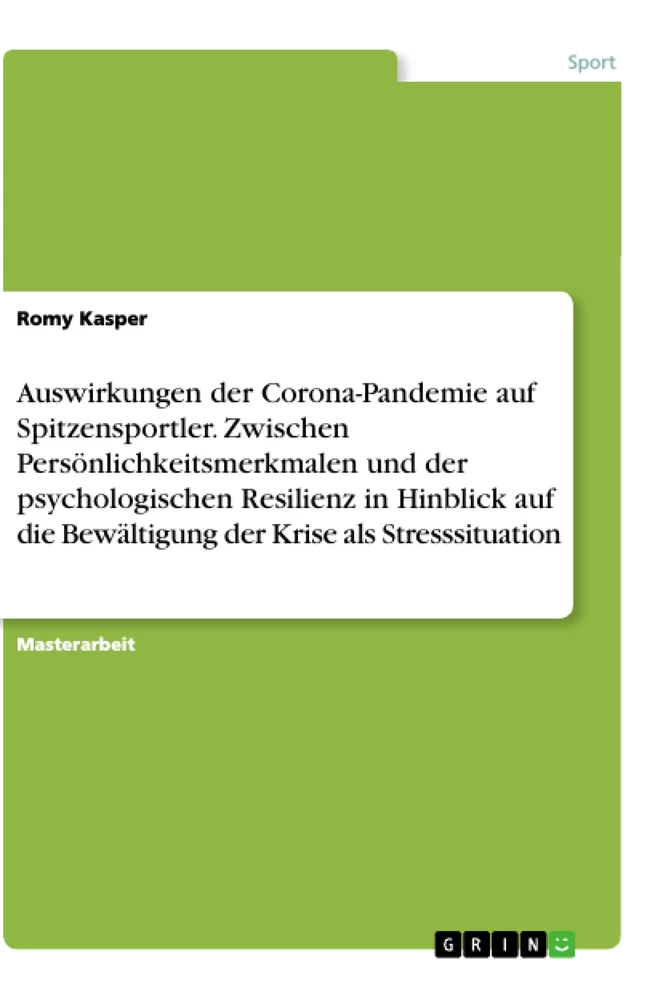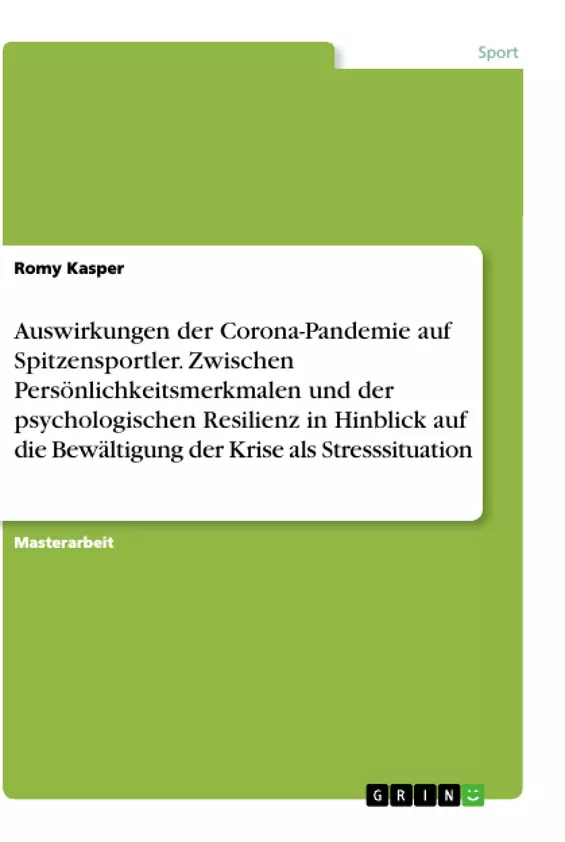Ziel der Arbeit ist es, zu untersuchen, inwiefern die Persönlichkeitsmerkmale im Zusammenhang mit psychologischer Resilienz stehen. In der vorliegenden Untersuchung wird durch das "Kriterium Spitzensport" eine besondere, hochspezifische Bevölkerungsgruppe in den Fokus gerückt. In diesem Kontext wird weiterhin beleuchtet, welche Bedeutung Resilienz für die AthletInnen im Umgang mit der Pandemie hat.
In der gegenwärtigen globalen Situation mit Einschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie sind die meisten Menschen einer noch nie dagewesenen Stresssituation von unbekannter Dauer ausgesetzt. Sie befinden sich im Zentrum von Stress, Angst, Furcht und Depressionen. Besorgniserregende Gedanken durch eine negative Bewertung der Situation können Schlafprobleme verursachen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG UND PROBLEMSTELLUNG
- 2 GEGENWÄRTIGER KENNTNISSTAND
- 2.1 Persönlichkeitsforschung
- 2.1.1 Definition und Forschung
- 2.1.2 Big-Five Modell- Hauptdimensionen der Persönlichkeit
- 2.1.3 Persönlichkeit im Sport
- 2.1.3.1 Sportlich aktive Menschen
- 2.1.3.2 Spitzensport
- 2.2 Resilienz
- 2.3 Zusammenhang zwischen Persönlichkeitsmerkmalen, Resilienz und Sport
- 2.4 Stand der Forschung zu Persönlichkeit und Resilienz im Umgang mit der Corona-Krise
- 2.5 Definition zusätzlicher Items
- 3 ZIELSETZUNG UND HYPOTHESEN
- 4 METHODIK
- 4.1 Untersuchungsdesign
- 4.2 Beschreibung des Onlinefragebogens
- 4.2.1 Das NEO-Fünf-Faktoren Inventar (NEO-FFI)
- 4.2.2 CD-Risc-10/ Connor - Davidson Resilienz Skala
- 4.2.3 Corona-Fragebogen
- 4.2.4 Statistische Überprüfung
- 4.2.4.1 NEO-FFI
- 4.2.4.2 CD-Risc 10
- 4.2.4.3 Corona-Fragebogen
- 4.3 Datenauswertung und statistische Verfahren
- 4.3.1 Deskriptive Statistik
- 4.3.2 Inferenzstatistik
- 4.4 Stichprobenzusammensetzung
- 5 ERGEBNISSE
- 5.1 Deskriptive Auswertung
- 5.1.1 Soziodemograpische Daten
- 5.1.2 Auswertung NEO-FFI
- 5.1.3 Auswertung CD-Risc 10
- 5.1.4 Auswertung Corona-Fragebogen
- 5.2 Hypothesenüberprüfung
- 5.2.1 Zusammenhang zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und Resilienz
- 5.2.2 Zusammenhang zwischen Resilienz und der Einstellung/ dem Umgang mit der Corona Pandemie
- 5.3 Weitere Ergebnisse
- 5.4 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 6 DISKUSSION
- 6.1 Betrachtete Persönlichkeitsdimensionen
- 6.2 Persönlichkeitsfaktoren als Prädiktoren für Resilienz
- 6.3 Resilienz im Umgang mit der Corona-Pandemie
- 6.4 Handlungsempfehlungen
- 6.5 Limitationen und weiterer Forschungsbedarf
- 7 ZUSAMMENFASSUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit befasst sich mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Spitzensportler. Sie analysiert den Zusammenhang zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und der psychologischen Resilienz im Kontext der Bewältigung der Krise als Stresssituation.
- Die Arbeit untersucht, wie sich die Pandemie auf das psychische Wohlbefinden von Spitzensportlern auswirkt.
- Sie analysiert den Einfluss von Persönlichkeitsmerkmalen auf die Fähigkeit, mit der Pandemie-bedingten Stresssituation umzugehen.
- Die Arbeit betrachtet die Rolle der Resilienz im Umgang mit den Herausforderungen der Pandemie.
- Sie untersucht, welche Faktoren die Resilienz von Spitzensportlern beeinflussen.
- Die Arbeit zielt darauf ab, Handlungsempfehlungen für den Umgang mit den Auswirkungen der Pandemie auf Spitzensportler zu entwickeln.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung und der Definition der Problemstellung. Sie führt in die Thematik der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf Spitzensportler ein. Das zweite Kapitel präsentiert den aktuellen Forschungsstand zu Persönlichkeit und Resilienz im Sport. Dabei werden verschiedene Theorien und Modelle vorgestellt, sowie die Relevanz dieser Konzepte im Kontext der Sportpsychologie erläutert.
Das dritte Kapitel beschreibt die Zielsetzung und Hypothesen der Arbeit. Es werden die Forschungsfragen definiert, die in der Arbeit untersucht werden sollen. Das vierte Kapitel widmet sich der Methodologie der Arbeit. Hier werden das Untersuchungsdesign, die verwendeten Fragebögen und die statistischen Verfahren erläutert. Das fünfte Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung. Die Ergebnisse der Datenauswertung werden beschrieben und interpretiert.
Das sechste Kapitel diskutiert die Ergebnisse der Arbeit. Es werden die Implikationen der Ergebnisse für die Sportpsychologie und für die Praxis des Sporttrainings erörtert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Persönlichkeit, Resilienz, Spitzensport, Corona-Pandemie, Stress, psychisches Wohlbefinden und Sportpsychologie. Im Mittelpunkt stehen die Auswirkungen der Pandemie auf Spitzensportler und die Bedeutung von Persönlichkeitsmerkmalen und Resilienz im Umgang mit der Krise.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst die Corona-Pandemie Spitzensportler psychisch?
Die Pandemie stellt eine extreme Stresssituation dar, die zu Angst, Furcht, Depressionen und Schlafproblemen führen kann.
Was ist das 'Big-Five Modell' der Persönlichkeit?
Es ist ein Modell, das die Persönlichkeit in fünf Hauptdimensionen unterteilt. In dieser Arbeit wird untersucht, wie diese Merkmale mit der Resilienz von Sportlern korrelieren.
Welche Rolle spielt Resilienz für Athleten in der Krise?
Resilienz wirkt als psychologischer Schutzfaktor, der Sportlern hilft, die Pandemie-bedingten Einschränkungen besser zu bewältigen.
Welche Fragebögen wurden in der Studie verwendet?
Es wurden das NEO-Fünf-Faktoren Inventar (NEO-FFI) für die Persönlichkeit und die CD-Risc-10 Skala für die Resilienz eingesetzt.
Gibt es Handlungsempfehlungen für Sportpsychologen?
Ja, die Arbeit diskutiert auf Basis der Ergebnisse, wie Sportler in Krisenzeiten durch gezielte psychologische Interventionen unterstützt werden können.
- Quote paper
- Romy Kasper (Author), 2020, Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Spitzensportler. Zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und der psychologischen Resilienz in Hinblick auf die Bewältigung der Krise als Stresssituation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/995117