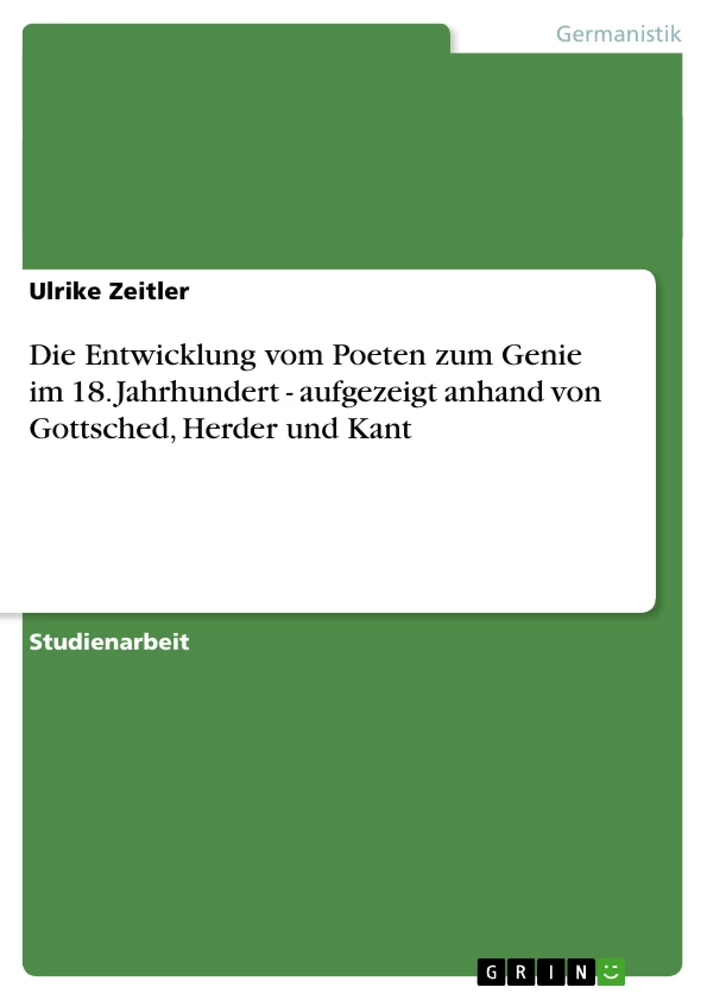Was macht einen Dichter zum Genie? Diese Frage durchzieht das 18. Jahrhundert und formt die deutsche Literaturlandschaft entscheidend. Diese Untersuchung verfolgt die Entwicklung des Dichterbegriffs von der aufklärerischen Regelpoetik Gottscheds über die stürmische Genieästhetik Herders bis zur transzendentalen Auflösung bei Kant. Im Fokus steht die schrittweise Emanzipation des Dichters von normativen Vorgaben hin zur selbstbestimmten Schöpferkraft. Gottsched, verankert in der Tradition des "poeta doctus", fordert von einem Dichter neben Verstand und Geschmack vor allem einen untadeligen Charakter und die Beachtung strenger Regeln, die sich an antiken Vorbildern orientieren. Doch bereits in seiner Betonung des "Witzes" als rationalem Kombinationsvermögen zeichnet sich ein erster Schritt zur Aufwertung der dichterischen Individualität ab. Johann Gottfried Herder hingegen, ein Vordenker des Sturm und Drang, proklamiert in seinem "Shakespear-Aufsatz" das Genie als höchsten Ausdruck menschlicher Schöpferkraft. Für Herder ist Shakespeare das Urbild des Genies, ein von keiner Regel beengter "Dolmetscher der Natur", dessen Werke aus der Tiefe der Seele schöpfen und den Leser in einen irrationalen Traumraum entführen. Immanuel Kant schließlich versucht in seiner "Kritik der Urteilskraft", die Extreme von Regelpoetik und Genieästhetik zu versöhnen. Er verortet das Genie in der Urteilskraft, die durch Geschmack reguliert wird, und betont die Bedeutung der Natur als Quelle der Inspiration. Das Genie manifestiert sich bei Kant in der Transzendentalität, als eine Naturgabe, die der Kunst die Regel gibt, ohne diese jedoch wissenschaftlich ableiten zu können. Diese Reise durch die Denkwelten Gottscheds, Herders und Kants offenbart nicht nur die Transformation des Dichterbildes im 18. Jahrhundert, sondern wirft auch grundlegende Fragen nach dem Wesen der Kunst, der Rolle der Individualität und dem Verhältnis von Natur und Geist auf. Eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für deutsche Literaturgeschichte, Ästhetik und die Epoche der Aufklärung interessieren. Entdecken Sie die Wurzeln des modernen Dichterbegriffs und die anhaltende Faszination des Genies! Erhellende Einblicke in die deutsche Geistesgeschichte des 18. Jahrhunderts, die bis heute nachwirken.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Gottscheds Regelpoetik in Versuch einer critischen Dichtkunst vor die Deutschen von 1730
1.1 Der Poet und sein Charakter
1.2 Der gute Geschmack des Poeten
1.3. Der Poet als Poeta doctus
2. Autonomieästhetik in Herders "Shakespear - Aufsatz"
2.1. Das Genie und sein Verhältnis zur Natur
2.2. Relativität der Zeit im irrationalen Traum-Raum
2.3. Das Genie als göttlicher Schöpfer
3. Manifestation des Genies in der Transzendentalität in Kants Kritik der Urteilskraft von 1790
3.1. Die Urteilskraft und der Geschmack bestimmen das Genie
3.2. Das Genie entsteht aus der Natur
3.3 Transzendentalität des Genies
Schluss
Literaturverzeichnis
Die Entwicklung vom Poeten zum Genie im 18. Jahrhundert - aufgezeigt anhand von Gottsched, Herder und Kant
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis 1
Einleitung 2
1. Gottscheds Regelpoetik in Versuch einer critischen Dichtkunst vor die
Deutschen von 1730
1.1 Der Poet und sein Charakter 4
1.2 Der gute Geschmack des Poeten 6
1.3. Der Poet als Poeta doctus 7
2. Autonomieästhetik in Herders "Shakespear - Aufsatz" 9
2.1. Das Genie und sein Verhältnis zur Natur 9
2.2. Relativität der Zeit im irrationalen Traum-Raum 11
2.3. Das Genie als göttlicher Schöpfer 12
3. Manifestation des Genies in der Transzendentalität in Kants Kritik der Urteilskraft von 1790
3.1. Die Urteilskraft und der Geschmack bestimmen das Genie 14
3.2. Das Genie entsteht aus der Natur 15
3.3 Transzendentalität des Genies 17
Schluss 19
Literaturverzeichnis 20
Einleitung
1. Gottscheds Regelpoetik in Versuch einer critischen Dichtkunst vor die Deutschen von 1730
1.1 Der Poet und sein Charakter
1.2 Der gute Geschmack des Poeten
1.3. Der Poet als Poeta doctus
2. Autonomieästhetik in Herders "Shakespear - Aufsatz"
2.1. Das Genie und sein Verhältnis zur Natur
2.2. Relativität der Zeit im irrationalen Traum-Raum
2.3. Das Genie als göttlicher Schöpfer
3. Manifestation des Genies in der Transzendentalität in Kants Kritik der Urteilskraft von 1790
3.1. Die Urteilskraft und der Geschmack bestimmen das Genie
3.2. Das Genie entsteht aus der Natur
3.3 Transzendentalität des Genies
Schluss
Literaturverzeichnis
Einleitung
Das 18. Jh. hat für die deutsche Literatur bedeutende Veränderungen herbeigeführt: Es war dies u.a. das Zeitalter der Aufklärung und des Sturm und Drang. Anhand der Hauptprinzipien der Aufklärung, Vernunft und Natur, wurden die bisherigen Autoritäten kritisch hinterfragt und erschüttert. Daher erklärt sich "Kritik" als Grundwort des 18. Jhs. Die Literaturkritik bewirkt eine Überwindung der bisher geltenden Normen und Regeln, die hauptsächlich aus der antiken Tradition abgeleitet worden waren. Diese Revolution der Literatur findet um 1770 im Sturm und Drang, der sich wiederum gegen das Vernunftprinzip und die Regelhaftigkeit der Aufklärung richtet, ihren Höhepunkt und stellt den Beginn der großen neueren deutschen Literatur dar.
Hier soll nun, anhand der Autoren Johann Christoph Gottsched, Johann Gottfried Herder und Immanuel Kant, der Weg der Literatur und damit auch des Dichters zur Mündigkeit und Selbstbestimmung des bisher unmündigen und fremdbestimmten Menschen bzw. Dichters untersucht werden.
Johann Christoph Gottscheds führende, philosophisch fundierte Poetik der Aufklärung Versuch einer critischen Dichtkunst vor die Deutschen von 1730 ist der Ausgangspunkt der Arbeit. Er propagiert ein antibarockes, klassizistisches Formideal und führt so ein Loslösung des höfischen Zeitalters herbei, hat aber noch die Auffassung der Vernunftnatur und so ist der Poet der Nachahmung der Natur und der Betonung des Vernunftprinzips verpflichtet. Diesem folgt die im Sturm und Drang vorherrschende Proklamation des Selbstbewußtseins, auf die dem Dichter eigene Schöpfer- bzw. Produktivkraft. Diese Ablehnung von Autoritäten und das irrationale Verständnis der Natur wird von dem freigeistigen Reformer Johann Gottfried Herder, in seinem "Shakespear - Aufsatz" aus dem Jahr 1773, dargelegt. Pathetisch preist er hier Shakespeare, dem er die Prädikate des göttlichen Schöpfers zuweist, als Genie.
Immanuel Kant richtet sich in seiner Kritik der Urteilskraft von 1790 gegen diesen extremen Subjektivismus, wie er in der Genie-Ideologie der Sturm und Drang - Zeit durchgebrochen war. Er setzt ihm regulierend den Geschmack entgegen.
Dieses zusammenfassende und horizontbildende Werk, das die extremen Positionen der Geniezeit relativiert und das Genie im Transzendentalen manifestiert und die rationale Linie weiterführt, bildet daher die dritte und letzte Station der Untersuchung der Entwicklung vom Poeten zum Genie im 18. Jh.
1. Gottscheds Regelpoetik in Versuch einer critischen Dichtkunst vor die Deutschenvon 1730
Johann Christoph Gottsched steht dem Zeitalter des Barocks ablehnend gegenüber und entwirft deshalb in seiner Poetik V ersuch einer critischen Dichtkunst vor die Deutschen von 1730 ein Gegenkonzept. Er stellt dem Schwulst, dem Bombast, der Dunkelheit, der Metaphernfülle und den Manierismen jenes Zeitalters seine Vorstellung von der Vernunft und Rationalität entgegen. Diese strenge Haltung resultiert aus seiner Antipathie gegenüber dem seiner Meinung nach "entarteten" Barock, insbesondere gegen Hofmannswaldau, Lohenestein u.a.
Gottscheds Regelpoetik nimmt sich die französische Literatur des 17. Jahrhunderts zum Vorbild, deren Verstandesklarheit, deren streng regelmäßig strukturierten Werke und deren rationalen sprachlichen Ausdruck er lobt.
Besonders Boileaus Werke, auf den sich Gottsched u.a. bezieht, basieren auf Descartes Lehre von der „raison“ als die Vornehmste, weil zur Wahrheit führenden menschlichen Fähigkeit. Demnach ist Dichtkunst wesentlich der Wahrheit verpflichtet, worin auch eine unerlässliche Voraussetzung ihrer Schönheit zu sehen sei. Dahinter steht die alte idealische Tradition, dass Wahrheit gleich Schönheit sei. Diesem enggefassten Nachahmungsgebot folgt auch Gottsched. Seine Rechtfertigung erhält dies vor dem Hintergrund, dass er sich gezwungen sah dem immer schwülstiger werdenden Barock etwas Neues entgegenzusetzen, und so ist der Vernunft- und Wahrheitsgedanke aufgekommen.
Dies hatte auch eine Abwendung von höfischen und religiösen Inhalten zur Folge, wodurch er die Voraussetzungen für den Übergang vom Hofpoeten zum bürgerlichen Dichter schaffte und so dem bürgerlichen Publikum die Literatur zugänglich machte. Dadurch befreite er Bürgertum und Adel aus der spießbürgerlichen Enge und geistigen Rückständigkeit und schloss Deutschland so an das emanzipiertere westeuropäische Bildungsniveau an.
Vor diesem Hintergrund ist nun Gottscheds Auffassung von einem guten Poeten zu sehen, der gemäß der Tradition des „poeta doctus“ eine Menge an Kriterien erfüllen muss. So zeichnet er sich aus durch einen guten Charakter, guten Geschmack und eben Intellektualität aus.
1.1 Der Poet und sein Charakter
Charakterliche Stärke ist eines der Hauptmerkmale von Gottscheds Dichtungstheorie, denn es muss „ eine große Fähigkeit der Gemüts-Kräfte, Gelehrsamkeit, Erfahrung, Übung und Fleißzu einem rechtschaffenen Dichter gehören. “ 1
Ebenso ist das Wissen um die Sittenlehre und Staatskunst unerlässlich, da der Poet ansonsten die Handlungen der Menschen nicht in gute und böse kategorisieren kann. Beurteilt wird dies durch die "gesunde Vernunft" 2 . Dennoch ist über die Eigenschaften des Verstandes hinaus "ein ehrliches und tugendliebendes Gemüt" 3 notwendig zur Beurteilung von gut und böse. Aufgrund der Moraldidaxe, der die Poesie unterstellt ist, darf ein Dichter auf keinen Fall gegen die gängige Moralauffassung verstoßen. Deshalb schreibt Gottsched dem Poeten seinen Lebenswandel vor, denn er ist der Überzeugung, "daßder Poet selbst innerlich tugendhaft sein müsse, wenn er allezeit keusch und rein schreiben wolle, weil er sich sonst unversehens verraten würde." 4 Als Beurteilungsinstanz und Referenz setzt Gottsched Aristoteles an, dessen Regeln „ sich auf die unveränderliche Natur des Menschen und auf die gesunde Vernunft “ 5 gründen. Aristoteles beschreibt in seiner Poetik den Charakter eines wahren Poeten nicht ausführlicher und so leitet er diesen von der Definition der Poesie ab: Aristoteles sieht in der Poesie eine Nachahmung menschlicher Handlungen, die aufgrund unterschiedlicher Nachahmung zu verschiedenen Ausführungen der literarischen Produkten führt. Demnach bleiben dem Poeten drei Möglichkeiten, um Menschen abzubilden: er „ könne die entweder besser oder schlechter vorstellen, als sie sind; oder dieselben ganzähnlich schildern. “6 Daraus ergibt sich nun für Gottsched folgende Charakterisierung eines Poeten: „ Ein Poet sei ein geschickter Nachahmer aller natürlichen Dinge “ 6 dessen Ausdruck „ durch eine harmonische und wohlklingende Schrift, die wir Gedicht nennen “ 6 seine Vollendung findet. Nachahmung sieht Gottsched, wie Aristoteles, als eine dem Menschen natürliche und angeborene Tätigkeit.
Daraus folgt der Schluss: je größer die Geschicklichkeit im Nachahmen, desto größer ist die Fähigkeit zur Poesie.
Es hat sich aber gezeigt, dass es Unterschiede in der Geschicklichkeit im Nachahmen gibt - so fällt es dem einen leicht, dem anderen dagegen schwer und „ so hat man angefangen zu sagen, daßdie Poeten nicht gemacht, sondern geboren würden. “ 7 Im Ansatz ist hier der Geniegedanke schon angelegt und der von Gottsched zitierte und zum Vorbild genommene Boileau drückt es in seiner L ´ Art poétique folgendermaßen aus: „ Ein Autor ist vermessen, der die Größe der Dichtkunst allein mit Hilfe der Verskunst erstrebt, und er hofft vergebens, sie zu erreichten, wenn er nicht den geheimen Einflußdes Himmels verspürt und wenn sein Stern ihn bei der Geburt nicht zum Dichter auserkoren hat. [...]. “ 8
Was hier mit Einfluss des Himmels beschrieben wird, wurde im 18. Jahrhundert oft auch als lebhafter „Witz“ beschrieben. Dem Wort „Witz“ liegt im aufklärerischen Zeitalter nicht die Bedeutung „Scherz“ zu zugrunde, er ist in dem Sinne einer „ Begabung für geistreiche, überraschend formulierte Einfälle und für dichterisches Erfindungsvermögen “ 9 Zu verstehen. Gottsched selbst definiert „Witz“ als eine „ Gemütskraft, welche die Ä hnlichkeit der Dinge leicht wahrnehmen und also eine Vergleichung zwischen ihnen anstellen kann “ 10 . Der Witz nimmt in Gottscheds Dichtungstheorie eine Schlüsselrolle ein, da dieser für ihn pures rationales Kombinationsvermögen ist. Die damit einhergehende Entzauberung der Poesie wird ihm später, besonders von Lessing und den Stürmern und Drängern zum Vorwurf gemacht werden.
Mit dem Witz hängt die „ Scharfsinnigkeit “10 zusammen, diese ist das Vermögen des Auserwählten viel an einem Ding wahrzunehmen, bzw. wie Wolf die definiert, ist sie eine „ scharfe Beobachtungsgabe, die es erlaubt, an möglichst vielen Phänomenen möglichst viele Merkmale zu beobachten “ 11 Und so folgt der logische Zusammenhang : Je größer die Scharfsinnigkeit, desto größer kann auch der Witz “ 10 eines Poeten sein und desto sinnreichere Gedanken werden entstehen. Ebenso wichtig ist es dazu noch "Einbildungs-Kraft" 10 zu besitzen. Alle diese "Gemüts- Kräfte"10 werden von einem guten Poeten benötigt, denn dieser muss "eine starke Einbildungs-Kraft, viel Scharfsinnigkeit und einen großen Witz schon von Natur besitzen, wenn er den Namen eines Dichters mit Recht führen will." 10
Darüber hinaus muss der Poet einen guten Geschmack besitzen; dieser Aspekt wird im folgenden Abschnitt behandelt.
1.2 Der gute Geschmack des Poeten
Für Gottsched ist der gute Geschmack weitere Voraussetzung für einen wahren Poeten, denn der Poet "mußerstlich die Kräfte der menschlichen Seelen und sonderlich die Wirkungen des empfindlichen und urteilenden Verstandes aus Weltweisheit verstehen." 12 Zur Geschmacksbildung gehört neben der "Fertigkeit in der Vernunftlehre" 13 , die benötigt wird, sich von "vorkommenden Dingen nach logischen Regeln eine gute Erklärung zu machen," 13 auch Übung in der Poesie oder anderen Künsten.
Das Problem der Subjektivität des Geschmacksurteils, es ist ja nach Gottsched so, dass "Leute, die nach dem bloßen Geschmacke urteilen, können sehr ungleich sein, 14 " wird von ihm umgangen, indem dem Urteil der Vorzug gegeben wird, welches mit den Regeln übereinstimmt.
Daraus ergibt sich die Begründung für seine Regelpoetik, der ein Poet, will er ein guter sein, verpflichtet ist:
"Die Regeln nämlich [...] kommen nicht auf den bloßen Eigensinn der Menschen an: sondern haben ihren Grund in der unveränderlichen Natur der Dinge selbst; in der Ü bereinstimmung des Mannigfaltigen; in der Ordnung und Harmonie. Diese Gesetzte nun, die durch langwierige Erfahrung und vieles Nachsinnen untersuchet, entdeckt und bestätiget worden, bleiben unverbrüchlich und feste stehen; wenngleich zuweilen jemand nach seinem Geschmacke demjenigen Werke den Vorzug zugestünde, welches dawider mehr oder weniger verstoßen hätte." 15
Der Geschmack beurteilt natürliche Dinge als schön, deshalb muss die Kunst Muster der Natur nachahmen. So kann seiner Meinung nach die Natur einem künstlerischen Werk die Vollkommenheit geben und ist trotzdem mit dem Verstande kombinierbar.
Deshalb lautet seine Auffassung vom guten Geschmack: "Derjenige Geschmack ist also gut, der mit den Regelnübereinkommt; die von der Vernunft in einer Art von Sachen allbereit festgesetzt werden. “16
1.3. Der Poet als Poeta doctus
Zusammen finden diese Eigenschaften in der Fähigkeit, eine gute Fabel schreiben zu können. In dieser sieht Gottsched das Hauptwerk, die "Seele der ganzen Dichtkunst" 17 und nur dem, der dies beherrscht, erkennt er die Bezeichnung „ Poet “ 17 zu. Denn " wer die Fähigkeit nicht besitzt, gute Fabeln zu erfinden, der verdient den Namen eines Poeten nicht: wenn er gleich die schönsten Verse der Welt macht." 17 . Die Fabel verbindet, in hohem Schreibstil verfasst, gemäß dem Regelsystem den wahren moralischen Lehrsatz mit einem erfundenen Handlungsstrang. Es soll eine Verbindung von Lust und Nutzen stattfinden und dazu schreibt er dem Poeten seinen Lebenswandel vor, denn der "mußnach bereits gegebenen Beschreibungen auch ein rechtschaffener Bürger und redlicher Mann sein: So wird er nicht unterlassen, seine Fabeln so lehrreich zu machen, als ihm möglich ist, ja keine einzige ersinnen, darunter nicht eine wichtige Wahrheit verborgen läge." 18
Hier wieder eine Orientierung am Horaz`schen Vorbild:
"Omne tutulit punctum qui miscuit utile dulci, Lectorem delect undo pariterque mondeo." 19
Gottsched nimmt im weiteren eine Abgrenzung vor, inwieweit ein Poet von der Wissenschaft beeinflußt ist. Und da nach seiner Auffassung ein Poet über alle Dinge schreiben kann, so folgert er, "daßein Poet keine Wissenschaft so gar verabsäumen müsse, als ob sie ihn nichts anginge. Er muss sich vielmehr bemühen, von allen zum wenigsten einen kurzen Begriff zu fassen: damit er sich, wo nicht in allen geschickt erweisen, doch mindestens in keiner einzigen auf eine lächerliche Art verstoßen möge." 20
Diese hohen Anforderungen setzt er an, um ein Ziel zu geben. Er räumt auch ein, dass, wie die Erfahrung zeigt, es diesen höchsten Poeten bisher noch nicht gegeben hat. Aber es geht ihm darum ein höchstes Ziel zu stecken und dadurch ein hohes zu erreichen. Neben dem Wissen um die Wissenschaft bedarf es einer gründlichen Erkenntnis des Menschen, denn "ein Poet ahmet hauptsächlich die Handlungen der Menschen nach, die ihren freien Willen herrühren und vielmals aus den verschiedenen Neigungen des Gemüts und heftigen Affekten ihren Ursprung haben." 21
Gottsched spricht sich noch für ein Maßhalten in Bezug auf "Wunderdinge" 22 aus. Der Poet darf sie nur sparsam anwenden, es bleibt ihm aber das Mittel der Allegorie. So muss das Wunderbare in den Schranken der Poesie bleiben, der "Poet muss stets die Natur vor Augen haben." 23 .
Wie sein Nachfolger Johann Gottfried Herder den Dichter im Zusammenhang mit der Regelpoetik sieht, soll das folgende Kapitel anhand seines Aufsatzes Shakespear klären.
2. Autonomieästhetik in Herders "Shakespear - Aufsatz"
Der rationalen Position Gottscheds setzt Herder seine antirationale Einstellung entgegen und zeigt dies exemplarisch an Shakespeare auf, der für ihn den Inbegriff des Genies darstellt, in gleichnamigen Aufsatz.
Als Schüler Hamanns adaptiert er dessen Lehre vom "Genius" und baut diese zu einem hymnischen Pathos, wie in der Shakespeare-Schrift, aus. Er verachtet die Gelehrsamkeit in der Kunst und setzt in seiner sensualistischen Ästhetik dem Bild des "poeta doctus" Gottscheds die Auffassung des Dichters als Genie entgegen.
Das Genie ist, nach der Definition des Reallexikons für Literaturwissenschaft, ein Mensch bez. spezieller ein Autor, der von "singulärer intellektueller beziehungsweise künstlerischer Begabung" 24 ist.
Schärfer formuliert dies die Zeit des Sturm und Drang, auch Geniezeit genannt, indem hier der Geniebegriff als den "Künstler / Dichter und nur ihn zur exemplarischen Verwirklichung der allein aus sich schaffenden Subjektivität" 24 bezeichnet wird.
Der Shakespeare - Aufsatz ist in der als Manifest des Sturm und Drang geltenden Aufsatzsammlung Von deutscher Art und Kunst aus dem Jahr 1773 enthalten. Diese richtet sich sowohl gegen die französische Geschmackskultur des Adels als auch gegen die lateinische Gelehrtenkultur, um sich dem europäischen Mittelalter und dem Volkstümlichen zuzuwenden.
Sinn und Zweck des Aufsatzes über Shakespeare ist es, laut Herder, das Bild des
angelsächsischen Dichters verständlich zu machen und "zu erklären, zu fühlen wie er ist, zu nützten, und wo möglich - uns Deutschen herzustellen." 25
Zunächst wird auf das Verhältnis des Genies zur Natur eingegangen werden, und im darauffolgenden Abschnitt seine Deutung von Zeit beschrieben werden, was zu der Vorstellung des Genies als göttlichen Schöpfer führt.
2.1. Das Genie und sein Verhältnis zur Natur
Im Vordergrund der Charakteristik des Genies steht die Betonung der Naturhaftigkeit und der individuellen Freiheit und dies zeigt Herder an Shakespeare auf. Dieser entspricht seinen Vorstellungen von einem vollkommenen Dichter, den er als Genie bezeichnet. Um dies begründen zu können, startet er einen Vergleich zwischen den Griechen und eben Shakespeare, und zwar von der Behauptung ausgehend, "daßgrundverschiedene historische Entstehungsbedingungen das Drama der Griechen und das Shakespears bis ins Innerste bestimmen, so daßdas eine nicht vom anderen her beurteilt werden kann." 26
Es widerstrebt ihm die Verurteilung, wenn es "nur in dieser glücklich oder unglücklich veränderten Zeit, es eben Ein Alter, Ein Genie gäbe, das aus seinem Stoff so natürlich, großund original eine dramatische Schöpfung zöge, als die Griechen aus den ihren" 27 und sich eben von dem griechischen Vorbild unterscheidet, da es auf unterschiedliche Weise zustande gekommen ist. Er hält den so urteilenden für einen "Thor, der nur vergliche und gar verdammte, weil dies Zweite nicht das Erste sei. “ 27 Herder gesteht beiden Natur zu, aber in der ihnen eigenen Weise. Denn das Postulat, ein gutes Drama müsse die drei Einheiten einhalten, verwirft er nicht, sondern das Künstliche ihrer Regeln war - keine Kunst! War Natur!" 28 So wie sie es damals empfunden haben, war es, denn alle "diese Dinge lagen damals in der Natur, daßder Dichter mit aller seiner Kunst ohne sie nichts konnte!" 29 Es ist nur so, dass sich Herder eher Shakespeare als den Griechen zugehörig fühlt, und das nicht nur aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe. Bei diesen herrscht Einheit der Handlung vor, welche einen einfacheren Bau nach sich zieht, bei jenen aber läuft es "auf das Ganze eines Eräugnisses, einer Begebenheit hinaus." 30 Shakespeare greift die Allheit der Welt auf, stellt das Ganze eines Ereignisses, einer Begebenheit dar, bezieht alle Charaktere und Stände, sowie alle Alter, Menschen und Menschenarten ein und ist somit der "Dolmetscher der Natur in all` ihren Zungen." 31
Eben deshalb ist Shakespeare für Herder der größte Meister, weil "er nur und immer Diener der Natur ist."32
Sophokles blieb der Natur insofern treu, da er eine Handlung, einen Ort und eine Zeit bearbeitete, Shakespeare dagegen konnte der Natur nur treu bleiben, wenn er "seine Weltbegebenheit und Menschenschicksal durch alle die Ö rter und Zeiten wälzte, wo sie - nun, wo sie geschehen." 33
Wie in der Kritik der drei Einheiten schon angedeutet, hat Herder, was der folgende Abschnitt zeigen soll, eine neue Auffassung von Zeit.
2.2. Relativität der Zeit im irrationalen Traum-Raum
Für Herders Geniebegriff ist auch die Komponente des Irrealen und des Traums von großer Bedeutung. Seiner Auffassung nach gehört zur menschlichen Zeitauffassung sowohl die Zeitraffung, d.h. ein langer Moment wird kurz empfunden, als auch die Zeitdehnung, ein nicht enden wollender kurzer Moment. Diese Erkenntnis liegt im nachvollziehbaren Bereich eines jeden Menschen. So sind seiner Meinung nach "Raum und Zeit eigentlich an sich nichts, daßsie die relativste Sache auf Daseyn, Handlung, Leidenschaft, Gedankenfolge und Maaßder Aufmerksamkeit in oder außerhalb der Seele sind." 34
Die Seele selbst schafft sich ihren Raum, ihre Welt und ihr Zeitmaß, und man erlebet besonders im Traum die Relativität der Zeit. Und eben darin sieht Herder die Aufgabe, sogar die einzige Pflicht, des Dichters bzw. des Genies: den Rezipienten in einen Traum zu versetzen.
"So wurde das Über-Bewußte der Inspiration ersetzt durch das Unter-Bewußte, das den entscheidenden Vorteil hatte, daßes sich in die Natur-Sphäre integrieren ließ. Erst damit ist die Genie-Konzeption schlüssig." 35
Dem Dichter wird eine subjektive Sicht der Welt zugestanden, in die er den Rezipienten führt, denn "im Gange seiner Begebenheit, im ordine successivorum und simultaneorum seiner Welt, da liegt Raum und Zeit [...], da ist seine Welt."36
Es liegt im Ermessen des Autors, wie "schnell und langsam"36 er die Zeiten folgen läßt. - Es ist sein Zeitmaß. Und darin ist Shakespear Meister: "Langsam und schwerfällig fangen seine Begebenheiten an, in seiner Natur wie in der Natur: denn er gibt diese nur im verjüngten Maasse."36
Zudem ist für Herder der unerwartete Handlungsverlauf bei Shakespeare interessant, denn, "wie kürzer die Reden und geflügelter die Seelen, die Leidenschaft, die Handlung! und wie mächtig sodenn dieses Laufen, das Hinstreuen gewisser Worte, [...], ist. Endlich zuletzt, wenn er den Leser ganz getäuscht und in Abgründe seiner Welt und Leidenschaft verloren sieht, wie wird er kühn, was l äß t er auf einander folgen!"36
In der Kombination aus vorgefundener Geschichte und Schöpfergeist, die das
Verschiedenartige zu einem "Wunderganzen"37 verbinden kann, darin sieht Herder die Fähigkeit des Genies.
2.3. Das Genie als göttlicher Schöpfer
Das Genie benötigt nach Auffassung Herders keine Regeln, folgt demnach keinen Mustern, sondern macht welche. Dazu ist eine Genialität im Sinne eines ganzheitlichen Vermögens notwendig: "so wars ein Sterblicher mit Götterkraft begabt, eben aus dem
entgegengesetztestem Stoff, und in der verschiedensten Bearbeitung" 38 etwas Neues, Erstes, ganz Verschiedenes hervorzubringen. - Darin zeigt sich die "Urteilskraft seines Berufs" 38. Das Genie wird ins Göttliche, sozusagen zur zweiten Gottheit erhoben. Dies ist für Herder Shakespeare, aber paradigmatisch für die Epoche des Sturm und Drang wird es Goethes "Prometheus" werden, der als Mensch selbst schöpferisch tätig wird. Herder betont gerade auch bei Shakespeare diesen Gesichtspunkt, dass dieser eine Welt "dramatischer Geschichte" 39 kreiert, die so groß und tief wie die Natur ist - "aber der Schöpfer gibt uns Auge und Gesichtspunkt so großund tief zu sehen!" 39 Das ist es, was er unter anderem an Shakespeare emphatisch preist - die Fähigkeit dies alles zu überblicken. Aus einzelnen, voneinander unabhängigen Begebenheiten schafft er das Ganze "Eines theatralischen Bildes, Einer Grösse habenden Begebenheit, die nur der Dichterüberschaut." 40
Diese Umfassenheit eines Dichters, die er in seinem Stück ausdrückt, wird zur Hauptempfindung, die sein Werk wie eine "Weltseele durchströmt"41 Aber im Shakespeare-Aufsatz besteht eine Problemspannung zwischen der Ganzheitsidee und dem individuellem Geniegedanken. Denn das, so sieht es Schmidt, "Genie verkörpert die schöpferische Ganzheit nur als Individuum, und nur in individueller Gestalt repräsentiert das geniale Werk die Ganzheit." 42
Zwar betont Herder das "Individuelle jedes Stücks, jedes einzelnen Weltalls"43, aber damit ist die Kluft zwischen Individualität und beanspruchter Totalität lediglich verdeckt. Das Problem besteht darin, dass die Ganzheit über eine "bunte Vielfaltäußerer Erscheinungen aufgewiesen" 42 werden muss.
Eine Lösung bietet Kants Kritik der Urteilskraft, in der Kant den Geschmack als Regulativ einführt. Wie Kant dieses Problem auf philosophischen Weg zu lösen sucht, soll das fol- gende Kapitel klären.
3. Manifestation des Genies in der Transzendentalität in Kants Kritik der Urteilskraft von 1790
Immanuel Kant führt in seiner dritten Kritik, der Kritik der Urteilskraft von 1790, die beiden extremen Gedankengänge seiner Vorgänger zusammen. Die im ersten Kapitel anhand von Gottscheds Versuch einer critischen Dichtkunst vor die Deutschen aufgezeigte rationale und aufklärerische Traditionslinie verbindet er mit dem radikalen Irrationalismus des Sturm und Drang.
Als systematischen Ort weist er dem Genie die Urteilskraft zu. Deshalb wird zuerst das Verhältnis Genie, Geschmack und Urteilskraft untersucht, dann das Genie im Zusammenspiel mit der Natur und schließlich das Genie in seiner transzendentalen Bestimmung.
3.1. Die Urteilskraft und der Geschmack bestimmen das Genie
Der Urteilskraft schreibt Kant in Bezug auf das Genie eine Schlüsselrolle zu, sie entscheidet über das Genie und auch innerhalb der Kritik der Urteilskraft erhält das Genie seine Bedeutung über die Urteilskraft. Diese erhält durch ihre Mittelstellung zu den beiden Erkenntnisvermögen, dem Verstand und der Vernunft, eine wichtige Rolle. Ersteres ist das Vermögen der Begriffe und Regeln, letzteres das Vermögen, nach dieser Regel zu schließen. Die Urteilskraft ist aber das Vermögen zu urteilen, genauer, zu beurteilen, ob das Besondere unter eine allgemeine Regel fällt. Oder wie Kant es ausdrückt: "Urteilskraft ist das Vermögen, das Besondere als enthalten unter dem Allgemeinen zu denken." 44 Wie Kant in der "Tafel der oberen Seelenvermögen"45 darstellt, wird sie bestimmt über das gesamte Vermögen des Gemüts, dem "Gefühl der Lust und Unlust." 45 Sie findet ihr Anwendungsgebiet u.a. in der Kunst und hat als Prinzip a priori dasjenige der Zweckmäßigkeit.
Diese besteht darin, dass die "hervorbringende Ursache"46 eben einen Zweck gedacht und danach die Form bestimmt hat.
Die Intention der Urteilskraft in Bezug auf die Kunst ist aber nicht in erster Linie das Genie, sondern der Geschmack, denn zur "Beurteilung schöner Gegenstände wird Geschmack, zur schönen Kunst selber aber, d. i. zur Hervorbringung solcher Gegenstände wird Genie erfordert."47
Eine Trennung von Genie und Geschmack nimmt Kant nicht vor, vielmehr werden diese beiden in der Person des Künstlers verbunden. Das Genie übernimmt die Funktion des Steuerns und Regulierens, beurteilt das vom Genie hervorgebrachte.
Deshalb ist für Kant das Prinzip des Geschmacks das subjektive Prinzip der Urteilskraft.
Darin liegt das fundamental Neue in Kants Denkansatz: Für Geschmack gibt es kein objektives Kriterium. "..., in Ansehung des Angenehmen gilt also der Grundsatz: ein jeder hat seinen eigenen Geschmack." 48 Dieser ist die Instanz, die Individuelles und Allgemeines zusammenführt, "indem es als Bestimmungsgrund des Geschmacks ein jeden eigenes und alle übersinnliche Substrat der Menschheit annimmt - ein Substrat, das seinerseits eine allgemeine Begrifflichkeitübersteigende "Idee" bleibt." 49
Geschmack ist für Kant ein synthetisches Vermögen, das Individuell-Subjektives und Allgemein-Objektives, also antagonistische Sphären "in einer höheren Einheit aufhebt. “ 49 Der Geschmack ist das Vermögen den disziplinierenden Verstand, d.h. den allgemein gültigen, mit dem leitbildhaften "Geist"49 in Übereinstimmung zu bringen. Es bedarf also zur Beurteilung schöner Gegenstände des Geschmacks und zur Hervorbringung, zur schönen Kunst selber, des Genies.
Kants Verständnis des Schönen ist eng mit dem Naturverständnis verbunden, geht aus der Natur hervor. So ist für ihn das Schöne bestimmt durch seine Naturhaftigkeit. Er führt das Beispiel der Täuschung an, die man, als man es noch nicht wusste, für schön, da natürlich gehalten hatte, aber sich enttäuscht abwendet, wenn man des Betrugs gewahr wird. Ergo muss Schönheit "Natur sein oder nur dafür gehalten werden, damit wir an dem Schönen als solchen ein unmittelbares Interesse nehmen können." 46 Diese Beziehung des Genies zur Natur wird im Folgenden ausführlicher dargestellt werden.
3.2. Das Genie entsteht aus der Natur
Für Kant muss das Kunstwerk eine "Naturwirkung"50 besitzen, welche auch das Merkmal des menschlichen Werks ist. Er definiert hier das Kunstwerk über eine Synthese aus Mensch und Natur. Daher kommt die Bestimmung der schönen Kunst einer Gratwanderung gleich, denn:
"Die Natur war schön, wenn sie zugleich als Kunst aussah, und die Kunst kann nur schön genannt werden, wenn wir uns bewußt sind, sie sei Kunst, und sie uns doch als Natur aussieht." 51
Wie oben angeführt ist für Kant wesentliches Merkmal der schönen Kunst die Zweckmäßigkeit, deshalb muss "schöne Kunst [muß] als Natur anzusehen sein, ob man sich ihrer zwar als Kunst bewußt ist. 52
So ist für ihn die Natur noch ersichtlich, wenn der Künstler mit den Regeln übereinkommt, aber dies mit einer Leichtigkeit, dass die Spur nicht (sofort) ersichtlich wird. Und genau dazu benötigt er das Genie, das er wie folgt definiert: "Genie ist das Talent (Naturgabe), welches der Kunst die Regel gibt."53 Es bestimmt Talent gleich näher als "Naturgabe"53, welche ein angeborenes "produktives Vermögen des Künstlers ist und somit zur Natur gehört." 53 Weshalb er das Genie auch definiert als "angeborene Gemütslage (ingenium), durch welche die Natur der Kunst die Regel gibt."53
So besitzt nur das Genie die Fähigkeit schöne Kunst zu schaffen.
Aber da per definitionem jede Kunst Regeln voraussetzt und der Begriff der schönen Kunst eine Verbindung der Regel ablehnt, kann "die schöne Kunst sich selbst nicht die Regel ausdenken, nach der sie ihr Produkt zustande bringen soll." 53 Hier ist wieder anzumerken, dass aber ein Kunstwerk ohne Regel nie Kunst sein kann, "so mußdie Natur im Subjekte [...] der Kunst die Regel geben, d.i. die schöne Kunst ist nur als Produkt des Genies möglich. 53
Kant führt vier Eigenschaften an, die ein Genie ausmachen: das Vermögen der "Originalität"54. Es schafft etwas, wozu es keine Regel gibt. Weiter müssen seine Werke "exemplarisch"54 sein, also selbst nicht nachgeahmt sein, aber dazu anstiften. Das Genie hat jedoch keine Möglichkeit wissenschaftlich anzuzeigen, wie sein Werk zustande gekommen ist, es gibt "als Natur die Regel 54 " Letztes Merkmal ist der Bezug des Genies zur Kunst, zur schönen Kunst und nicht zur Wissenschaft.
Die Regel, die ja auf keinen Fall z.B. die wissenschaftliche Form einer Formel haben kann, „[muß] vom Produkt abstrahiert werden, an welchem andere ihr eigenes Talent prüfen mögen, nur sich jenes zum Muster, nicht der Nachmachung, sondern der Nachahmung dienen zu lassen."55
Erklärende Worte für diesen Vorgang findet Kant nicht - es bleibt ein diffuser Bereich.
Er nimmt eine Unterscheidung zwischen mechanischer und schöner Kunst vor. Erstere zeichnet sich durch Fleiß und Lernen aus, letztere wird im Genie sichtbar. Aber die schöne Kunst ist in der mechanischen enthalten. Hierin zeigt sich deutlich, wie Kant die beiden vorangegangen Strömungen verbindet. Rationale Element der Regeln "ein durch die Schule gebildetes Talent" 56 um von der Instanz der Urteilskraft bestehen zu können und dem Irrationalen des Genies.
Aber entscheidend neu ist jedoch, dass Kant das Genie, wie der folgende Abschnitt zeigt, im Transzendentalen manifestiert.
3.3 Transzendentalität des Genies
Das Genie, nach Kant Produkt einer Synthese von Einbildungskraft und Verstand, wird apriorisch von einer synthetischen Instanz bewirkt, welche Kant als "Vermögen zur Darstellungästhetischer Ideen bezeichnet." 57 Diese ist nur dem Genie eigen, da diese Fähigkeit weder wissenschaftlich begründet noch erlernt werden kann. Zudem zeichnet sich das Genie noch durch eine besondere "Proportion der Gemütskräfte" 58 aus, da diese Harmonie nicht erzwungen werden kann, denn nur die Natur selbst des Subjekts, des Genies kann dieses Zusammenspiel zustande bringen. Dabei ist die Einbildungskraft der gestaltende und schöpferische Teil, denn "sie ist nicht dem Zwange des Verstandes und der Beschränkung unterworfen".59 Die Einbildungskraft des Genies liefert "die Fülle des Anschauungsstoffes, welcher sich dem Verstande, den das Genie seinem Werk zugrunde legt, anpassen muß." 59
Das "schöne Kunstwerk", im Unterschied zur "mechanischen Kunst", entsteht demnach aus der Synthese der durch Einbildungskraft entstandenen Phantasie mit den Verstandesbegriffen.
Kant erweitert diesen Gedankengang, dass Genialität des Subjekts eine einmalige, besondere Natur sei, indem er diese besondere Eigenschaft im Übersinnlichen manifestiert und als "letzte Quelle aufdeckt."60
Ein anderer Ausdruck für dieses entscheidende Kriterium ist der "Geist"61, worunter er "das belebende Prinzip im Gemüte"51 versteht. Dies ist das Vermögen zur Darstellung ästhetischer Ideen und der eigentliche geniale Impuls. Das zentrale Vermögen liegt in der Einbildungskraft selbst, "denn diese ist nicht nur zu Vorstellungen fähig, die sich auf das Sinnliche beschränken, sondern auch zu komplexeren "ästhetischen Ideen" 62 . Es folgt also: das zentrale Vermögen des Genies ist die Einbildungskraft in "ästhetischer " Hinsicht und eine weitere Gemütskraft, der Verstand. So hat das Schöne der Kunst im Übersinnlichen seinen letzten Grund und Ursprung.
Ergo ist das Genie bei Kant "die musterhafte Originalität der Naturgabe eines Subjekts im freien Gebrauche seiner Erkenntnisvermögen." 63
Schluss
Gottschdes Auswirkungen seiner Diskussion um die Begründung und um die Stellung des Dichters sind, in meinen Augen, der Wegbereiter des Geniegedankens. Er war es, der sich gegen die althergebrachte, barocke Literatur hinwegsetzte und den Dichter, zwar innerhalb des Regelsystems dachte, ihm aber doch eine freie Stellung zugestand. Indem er die Literatur unter die Moraldidaxe stellte und sie so von religiösen und höfischen Inhalten ablöste, konnte die Literatur dem bürgerlichen Publikum zugänglich gemacht werden. Weiter vorangetrieben wurde die Entwicklung in Richtung Autonomisierung der Literatur, zunächst von den Stürmern und Drängern.
Diese standen dem Rationalismus der Aufklärung kritisch gegenüber und konnten daraus ihr neues irrationalistisches Lebensgefühl definieren: Sie erblickten im Genie die höchste Form menschlicher Totalität.
Wie gesagt, erreichte diese Literaturauffassung im Sturm und Drang ihren Höhepunkt, der von Kant zwar relativiert wurde, aber die Literatur bis in die heutige Zeit beeinflusst: Zunächst lebte der Freiheits- und Universalgedanke in der deutschen Romantik fort und beeinflusste ebenso, durch die Auffassung des Genies als göttlichen Schöpfer, Nietzsches Philosophie des Übermenschen.
Im 20. Jh. Befasste sich u.a. Gottfried Benn in seinem Aufsatz "Genieproblem" aufgrund seines Interesses am pathologischen Gegenstand mit dem Geniegedanken. Eine künstlerische Auseinandersetzung mit der Geniethematik verfasste Thomas Mann in dem Roman "Doktor Faustus" von 1947 um den hochbegabten Musiker Adrian Leverkühn. Damit kann gesagt werden, dass das 18. Jahrhundert nur der Anfang einer viel weiter reichenden Gedankengeschichte ist.
Literaturverzeichnis
[Eisler, 1989]
Eisler, Rudolf: Kant Lexikon. Hildesheim: Georg Olms Verlag, 1989 [Gottsched, 1972]
Gottsched, Johann Christoph: Schriften zur Literatur. Stuttgart: Reclam 1972 [Herder, 1999]
Herder, Johann Gottfried: Von deutscher Art und Kunst. Einige fliegende Blätter. Stuttgart: Reclam, 1999
[Kant, 1990]
Kant, Immanuel: Kritik der Urteilskraft. Hamburg: Meiner, 1990 [Kohlschmidt, 1958]
Kohlschmidt, Werner und Wolfgang Mohr (Hg .): Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte Bd. I. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 19582
[Kohlschmidt, 1979]
Kohlschmidt, Werner und Wolfgang Mohr (Hg.): Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte Bd. III. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1979
[Renner, Habekost, 1995]
Renner, Rolf Günter und Engelbert Habekost (Hg.): Lexikon literaturtheoretischer Werke. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1995
[Saatröwe, 1971]
Saatröwe, Jürgen: Genie und Reflexion. Zu Kants Theorie des Ä sthetischen. Neuburgweier:
G. Schindele Verlag, 1971
[Schmidt, 1988]
Schmidt, Jochen: Die Geschichte des Genie-Gedankes in der deutschen Literatur, Philosophie und Politik. 1750-1945. Bd 1: Von der Aufklärung bis zum Idealismus. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 19882
[Schneider, 1952]
Schneider, Ferdinand Josef: Die deutsche Dichtung der Geniezeit. Stuttgart: Metzler 1952 [Schweikle, 1990]
Schweikle, Günther und Irmgard: Metzler-Literatur-Lexikon. Stuttgart: Metzler, 1990
[Weimar, 1997]
Weimar, Klaus (Hg.): Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft Bd. I. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1997
[Wolf, 1923]
Wolf, Herman: Versuch einer Geschichte des Geniebegriffs in der deutschen Ä sthetik des
18. Jahrhunderts. Band I Von Gottsched bis auf Lessing. Heidelberg: Carl Winter`s Universitätsbuchhandlung, 1923
[...]
1 [Gottsched, 1972]: S. 36
2 [Gottsched, 1972] S. 50
3 ebd. S. 51
4 ebd. S 55
5 ebd. S. 38
6 ebd. S. 39
7 ebd. S. 42
8 ebd. S. 43
9 [Schmidt, 1988] S. 12
10 [Gottsched, 1972] S. 44
11 [Schmidt, 1988] S. 33
12 [Gottsched, 1972] S. 85
13 ebd. S. 58
14 [Gottsched, 1972] S. 62
15 ebd. S. 63
16 ebd. S. 65
17 ebd. . 85
18 ebd. S. 83
19 ebd. S. 94
20 ebd. S. 46
21 ebd. S. 48
22 ebd. S. 115
23 ebd. S. 112
24 [Weimar, 1997] S. 701
25 [Herder, 1999] S. 65
26 ebd. S. 183
27 ebd. S. 67
28 ebd. S. 68
29 ebd. S. 69
30 ebd. S. 185
31 ebd. S. 77
32 ebd. S. 81
33 ebd. S. 84
34 ebd. S. 86
35 [Schmidt, 1988] S. 135
36 [Herder, 1999] S. 87
37 ebd. S. 77
38 ebd. S. 76
39 ebd. S. 80
40 ebd. S. 78
41 ebd. S. 83
42 [Schmidt, 1988] S. 131
43 [Herder, 1999] S. 82
44 [Kant, 1990] S. 15
45 ebd. S. 36
46 ebd. S. 155
47 ebd. S. 355
48 ebd. S. 50
49 ebd. S. 358
50 ebd. S. 156
51 ebd. S. 154
52 ebd. S 159
53 ebd. S. 160
54 ebd. S. 161
55 ebd. S. 163
56 ebd. S. 164
57 ebd. S. 167
58 [Saatröwe, 1971] S. 110
59 [Kant, 1990] S. 173
60 [Saatröwe, 1971] S. 112
61 [Kant, 1990] S. 167
62 ebd. S 168
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema der Analyse "Die Entwicklung vom Poeten zum Genie im 18. Jahrhundert - aufgezeigt anhand von Gottsched, Herder und Kant"?
Die Analyse untersucht die Entwicklung des Verständnisses von Dichtern und deren Rolle im 18. Jahrhundert, von der traditionellen Auffassung des "Poeten" hin zur Vorstellung des "Genies". Sie betrachtet die Ansichten von Gottsched, Herder und Kant als Schlüsselfiguren dieser Entwicklung.
Welche Autoren werden in der Analyse untersucht und welche Werke werden hauptsächlich betrachtet?
Die Analyse konzentriert sich auf Johann Christoph Gottsched (Versuch einer critischen Dichtkunst vor die Deutschen), Johann Gottfried Herder ("Shakespear - Aufsatz") und Immanuel Kant (Kritik der Urteilskraft).
Was war Gottscheds Auffassung vom "Poeten"?
Gottsched propagierte eine Regelpoetik, die sich gegen den Barock richtete und die Vernunft und Nachahmung der Natur betonte. Der Poet sollte einen guten Charakter, guten Geschmack und Intellektualität besitzen ("poeta doctus") und sich an den Regeln der klassischen Tradition orientieren.
Wie unterscheidet sich Herders "Genie"-Konzept von Gottscheds "Poeten"?
Herder, beeinflusst vom Sturm und Drang, stellte dem rationalen Denken Gottscheds eine antirationale Einstellung entgegen. Er idealisierte das Genie als einen schöpferischen, von Natur inspirierten Künstler, der sich nicht an Regeln halten muss und Shakespeare als das Inbegriff des Genies darstellt.
Welche Rolle spielt der Begriff der "Natur" in Herders "Genie"-Konzept?
Für Herder ist das Genie eng mit der Natur verbunden. Das Genie ahmt nicht nur die Natur nach, sondern ist selbst ein Ausdruck der Natur, der originell und frei von künstlichen Regeln schöpft.
Wie versucht Kant, die extremen Positionen von Gottsched und Herder zu vereinen?
Kant versucht in seiner Kritik der Urteilskraft, die rationale Tradition der Aufklärung (vertreten durch Gottsched) mit dem Irrationalismus des Sturm und Drang (vertreten durch Herder) zu verbinden. Er führt den Begriff des "Geschmacks" als regulierende Kraft ein und manifestiert das Genie im Transzendentalen.
Welche Rolle spielt die "Urteilskraft" in Kants Theorie des Genies?
Kant weist dem Genie die Urteilskraft zu. Die Urteilskraft ist das Vermögen zu beurteilen, ob das Besondere unter eine allgemeine Regel fällt. Durch die Urteilskraft erhalten die Einbildungskraft und der Verstand des Genies die Fähigkeit, ein harmonisches Zusammenspiel zu erzeugen.
Was sind die vier Eigenschaften, die Kant einem Genie zuschreibt?
Kant nennt vier Eigenschaften, die ein Genie ausmachen: Originalität, Exemplarität (Vorbildlichkeit), die Fähigkeit, die Regel als Natur zu geben (ohne wissenschaftliche Erklärung) und den Bezug zur schönen Kunst (im Gegensatz zur Wissenschaft).
Was bedeutet die "Transzendentalität des Genies" bei Kant?
Kant manifestiert das Genie im Übersinnlichen und sieht es als Produkt einer Synthese von Einbildungskraft und Verstand. Diese Synthese wird apriorisch von einer synthetischen Instanz bewirkt, welche Kant als "Vermögen zur Darstellung ästhetischer Ideen bezeichnet." Demnach hat das Schöne der Kunst im Übersinnlichen seinen letzten Grund und Ursprung.
Welche Bedeutung hat die Analyse für das Verständnis der deutschen Literaturgeschichte?
Die Analyse zeigt, wie sich das Verständnis von Dichtern und Literatur im 18. Jahrhundert von einer regelgebundenen, rationalistischen Sichtweise zu einer Betonung der individuellen Schöpferkraft und des Genies entwickelt hat. Diese Entwicklung hat die deutsche Literatur nachhaltig beeinflusst.
- Quote paper
- Ulrike Zeitler (Author), 2000, Die Entwicklung vom Poeten zum Genie im 18. Jahrhundert - aufgezeigt anhand von Gottsched, Herder und Kant, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99534