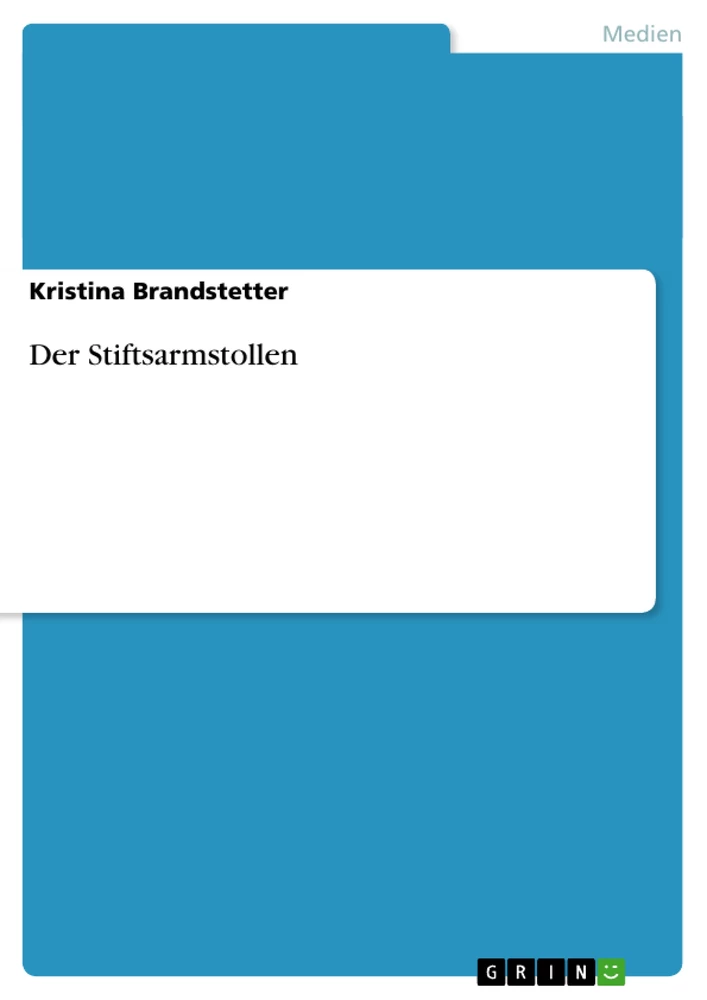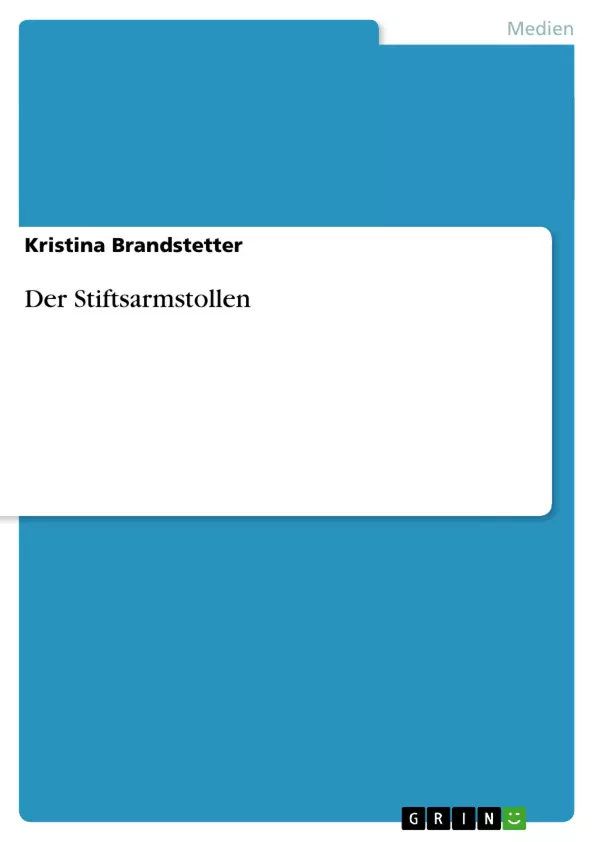Der Stiftsarmstollen
Salzburg ist nicht umsonst ein großer Touristenmagnet. Kaum eine andere österreichische Stadt strotzt von dermaßen zahlreichen historischen Bauten und Sehenswürdigkeiten. Ein historisches Juwel, dass lange Zeit zu unbeachtet blieb, schlummert tief im Berg und wartet darauf, entdeckt zu werden: Der Stiftsarmstollen. Erbaut im Jahre ist er ein Denkmal frühmittelalterlicher Baukunst, dass jedoch selbst den meisten Einheimischen bislang verborgen blieb. Die Wasserwerksgenossenschaft Stiftsarmstollen, die sich um seine Erhaltung kümmert, hat diesem Zustand zusammen mit der Hypobank Salzburg endlich ein Ende gesetzt. Gerade viele Schulklassen nehmen das Angebot, eine nicht alltägliche Reise durch die Geschichte zu machen, gerne wahr. Gerade drei Wochen pro Jahr ist der Stollen begehbar, und zwar in der Zeit der sogenannten ,,Almabkehr", die traditionsgemäß am Beginn des Herbstes angesiedelt ist, um die Wartungsarbeiten, die bei einem Bauwerk dieses Alters natürlich anfallen, durchführen zu können. Sie haben Ihre Gummistiefel und die Regenjacke an? Taschenlampe griffbereit? Gut. Lassen Sie Sich mitnehmen, auf eine Reise in die Vergangenheit, als Salzburg noch eine Stadt fest in geistlicher Hand war.
Salzburg bedurfte bis ins 13. Jahrhundert keiner eigentlichen Befestigung. Die Stadt schmiegte sich eng zwischen das breite Flussbett der Salzach und die angrenzenden Berge. Die Lage der Stadt brachte neben dem Vorteil eines natürlichen Schutzes aber auch einen deutlichen Nachteil: In dem vom Mönchsberg umschlossenen Altstadtbereich gab es keine Bäche und nur sehr spärliche Quellen. Die Versorgung mit Nutz- und Trinkwasser war daher mehr als problematisch. Gerade das Wasser hatte aber im Mittelalter einen noch höheren Wert, als es heute darstellt. Nutzwasser wurde nicht nur für die Landwirtschaft, sondern auch für den Betrieb von Mühlen, dringend benötigt. Die Mühlen sicherten die Versorgung mit dem damaligen Hauptnahrungsmittel: Getreide. Noch heute führt ein Stadtteil Salzburgs, einst der älteste Vorort, diesen Namen, nämlich Mülln. Der Mühlbach von Mülln selbst war nie ein natürliches Gewässer, sondern wurde schon im Frühmittelalter durch eine Bachableitung künstlich hergestellt. Was wurde damit bezweckt? Außerhalb der Stadt selbst gab es sehr wohl auch Mühlen, die an den zahlreichen Bächen angesiedelt waren. Im Falle einer Belagerung oder eines anderen Ausnahmezustandes wären die Bürger aber von ihrem kostbaren Nass abgeschnitten gewesen, was in diesem Falle einem Todesurteil gleichgekommen wäre.
Dem wussten aber findige Mönche abzuhelfen. Die beiden größten Grundherren innerhalb der Stadt Salzburgs waren damals die Abtei St. Peter und das Salzburger Domkapitel. Beide unterhielten große landwirtschaftliche Nutzflächen, den ,,Frauengarten"(heute Sitz der Universität) und das Kaiviertel. Für diese großräumige Landwirtschaft war eine entsprechende Wasserversorgung unumgehbar. Dazu kam die latente Gefahr eines Großbrandes. Die kleinen dicht aneinandergedrängten Häuser wurden großteils aus Holz erbaut, Stein als Baumaterial zu verwenden, konnten sich nur die Reichsten leisten. Billiges Baumaterial hin oder her, rein bautechnisch gesehen stellte es eine Katastrophe dar. Brach irgendwo ein Brand aus, entwickelte er sich sehr rasch zu einem Inferno, Löschwasser musste also stets griffbereit vorhanden sein. Vielleicht war es der große Stadtbrand 1127, der den Abt Balderich von St. Peter und Domprobst Hermann von Salzburg dazu veranlasste, ein für damalige Zeiten außergewöhnlich kühnes Projekt ins Leben zu rufen, um dem ständigen Wassermangel in der Stadt abzuhelfen. Sie beschlossen einen Stollen durch den Mönchsberg zu graben, um dadurch in der Lage zu sein, ständig große Wassermengen in die Stadt zu leiten. Sie beauftragten einen Baumeister namens Albert mit der Bauleitung, ihm zur Seite standen neben Facharbeitern auch zahlreiche Novizen der beiden Klöster, die wohl etwas unfreiwillig in den Stollenbau abkommandiert wurden. Schließlich mussten sich die Armen mit Spitzhacke, Hammer und Meißel als Werkzeuge begnügen und die Arbeit im Stollen war nicht gerade einfach. Von Albert wird vermutet, dass er sich schon als Steinmetz beim Wiederaufbau des abgebrannten Domes hervorgetan hatte und somit mit dieser Aufgabe betreut wurde. Der Stollen wurde von der stadtabgewandten Seite des Mönchsberg vorgetrieben , die Domherren berichteten, schon nach kurzer Zeit sieben Ellen durchgraben und auch die anschließende Wasserzuleitung hergestellt zu haben. Wieso gerade von dieser Seite begonnen wurde, lässt sich durch die Tektonik erklären. Während der Festungsberg aus Dolomit besteht, das sehr schwer zu bearbeiten ist, ist der Mönchsberg aus Konglomerat aufgebaut, das eine etwas weichere Konsistenz besitzt. Zwischen diesen beiden Gesteinsarten ist eine Schicht wasserführender Gosausandstein eingelagert, die für die Anlage des Stollens von entscheidender Bedeutung war. Da man damals ja keine Vermessungsgeräte besaß, ging man das Ganze ein bisschen anders an. Man bemerkte, dass an einer Stelle des Mönchsberges ständig Wasser austrat, ging der Sache nach und stellte fest, dass auf der anderen Seite des Berges eine Quelle mündete. Die Mönche nahmen ihre Werkzeuge in die Hand und gruben ganz einfach dem Lauf des Wassers nach. Einerseits schuf das eine gewisse Erleichterung, weil der Sandstein weniger kräfteraubend bearbeitet werden musste, andererseits erschwerte es teilweise durch seine Nachgiebigkeit die Arbeit im Stollen, weil es ständig zu Einstürzen kam. Der Stollen musste ständig durch sogenannte Pölzen und den Einzug von gemauerten Gewölben gesichert werden. Die ersten vier Jahre des Baus waren durch überraschende Erfolge gekrönt, bis ein Bergsturz den größten Teil des Stollens wieder verschüttete. Solchermaßen entmutigt, entließ der Abt von St. Peter, der bis dahin die Bauleitung innehatte, den Baumeister und legte die Leitung zurück. Die beiden Klöster hatten vereinbart, sich zu gleichen Kosten am _au zu beteiligen und dafür die gleiche Menge an Wasser abführen zu dürfen. Nach der vorübergehenden Einstellung des Baus bezahlter der Abt jedoch zehn Talente Silber an das Domkapitel, um nach einer möglichen Vollendung des Kanals Wasser in Rohren zu seiner Waschhütte ableiten zu dürfen. Nun übernahm das Domkapitel die Führung, stellte den Baumeister wieder ein und vollendete um 1143 den Stollendurchschlag. Jetzt kam es aber zu einem offenen Konflikt mit den Mönchen von St. Peter, die in einem Racheakt den Großteil des Werkes wieder zerstörten. Nach einem Machtwechsel an der Spitze der beiden Klöster wurde man sich einig und beschloss wieder gemeinsame Sache zu machen. Eine genaue Arbeitsteilung wurde aufgestellt: Die Mönche des Klosters St.Peter hatten für die Zuleitung des Wassers und die Unterhaltung dieses Kanals zu sorgen, dem Domkapitel oblag die Erhaltung des Stollens. Nach gröberen Meinungsverschiedenheiten übernahm das Domkapitel auch den Part des Klosters St.Peter. Wasserzuleitungen wurden errichtet und ausgebaut, die Entwässerung im Falle eines Hochwasser gesichert. Die Anlage eines derartigen Kanalsystems, vor allem aber der Bau des Stollens durch den Mönchsberg in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts ( wir sprechen hier von einer Zeit bevor sogar der Salzbergbau in Dürrnberg begonnen wurde!) war eine einzigartige Leistung.
Alle vergleichbaren Kanalanlagen in deutschen Städten sind erst wesentlich später entstanden, es kann also durchaus als Pionierleistung gesehen werden. Der Stollen, der seit fast über 850 Jahren durchgehend in Betrieb steht, hat eine Länge von 370 Metern, ist im Schnitt etwa 0,80 bis1,2 Meter breit und je nach Art der Einwölbung 1,50 bis 2,20 Meter hoch. Bereits während des Baues und unmittelbar nach der Fertigstellung mussten Gewölbe aus großen Steinquadern eingezogen werden. Die heute noch erhaltenen ältesten Gewölbe haben einen trapezförmigen Querschnitt, die später erneuerten Abschnitte wurden mit einem spitzbogigen Gewölbe versehen. Das gerade macht die Durchwanderung des Stollens so interessant. Hinter jeder Kurve lässt sich etwas anderes entdecken, von versteinerten Bäumen bis hin zu Tropfsteinen.
Zahlreiche Verstürze im Stollen haben zu Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Verlauf geführt. Die außergewöhnlichen Kurven sind daher nicht allein als Strömungsbremsen (das Wasser schießt immerhin mit einer Geschwindigkeit von bis zu 2200ml/sek durch die engen Gänge), sondern auch aus späteren Reparaturen zu erklären. Wenn man genau schaut, entdeckt man immer wieder Jahreszahlen und mit Bleistift hingekritzelte Signaturen der Handwerker, die sich aufgrund der Feuchtigkeit über Jahrhunderte hinweg gehalten haben. Der Boden des Stollens ist mit großen Marmortafeln ausgelegt, die von dem 1602 von Erzbischof Wolf Dietrich von Raitenau geschliffenen Domfriedhof stammen. Untersberger Marmor für einen Kanal Richten Sie Ihr Augenmerk auf diese Platten, so werden sie nicht nur eine Anzahl von Fossilien wie zum Beispiel Ammoniten finden, sondern auch die Überreste der Grabinschriften.
Der ,,Almkanal"
Der Name Almkanal trifft genaugenommen erst seit dem Ende des 13.Jahrhnderts für dieses Kanalsystem zu. Im Jahre 1286 wurde nämlich eine Verbindung zur Alm, heute meist Berchtesgadner- oder Königsseeache genannt, hergestellt und Wasser aus diesem Fluss, der sich als Seeabfluss durch eine gleichmäßige Wasserführung auszeichnet, in das bestehende Kanalsystem abgeleitet. Davor wurde das Wasser lediglich aus den angrenzenden Mooren und Bächen bezogen. Der Name ,,Alm" ist vorrömisch und bedeutet ebenso wie lat. ,,albina" ,,weiß, weißlich". Diese Bezeichnung weißt auf die weiß schäumende Oberfläche des bewegten Wildbaches hin. Die Alm fließt aus dem Königssee über Berchtesgaden und Schellenberg nach Norden. Am ,,Hangenden Stein" macht sie einen überraschenden Knick, wendet sich scharf nach Osten und fließt über Niederalm auf kürzestem Weg in die Salzach. Dieses auffallende Knie könnte darauf hinweisen, dass der natürliche Verlauf des Flusses ein anderer gewesen sein muss und erst später abgelenkt wurde. Eine Reihe kleinerer Gewässer wie zum Beispiel der Leopoldskroner Weiher werden als Überreste des ursprünglichen Flussbettes angesehen. Unter Benutzung dieses alten Flusslaufes wäre es relativ leicht möglich gewesen, eine Verbindung von der Alm zum bestehenden Kanalsystem herstellen.. Die beginnende Austrocknung der Moore und der ständig steigende Wasserbedarf der Stadt führten schließlich zur Durchstichstrecke zwischen St. Leonhard und Eichet, wo die Eichetmühle nördlich das Gerinne begann. Waren es einst Mühlen, Walkereien und Gerbereien, die am meisten von diesem Kanal profitierten, so sind auch noch heute viele Firmen am Verlauf dieses Flusses angesiedelt.
Das kühle und klare Wasser des Almkanals wurde auch als Trinkwasser sowie für Bäder und Spitäler benutzt. Dazu wurde es in Holzleitungen in die Häuser und Brunnen geleitet. Die Verteilerstelle befand sich des notwendigen Gefälles wegen in der Festungsgasse, von wo sich die Leitungen fächerförmig durch die ganze Stadt zogen. Auch eine mittelalterliche Variante der Müllabfuhr wurde entwickelt, durch die Umleitung des Wassers konnte der in die Gassen gekipppte Unrat und Abfall in die Salzach geschwemmt und so drohende Seuchen vermieden werden.
An der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit erhielt der Almkanal auch politische Bedeutung. Ein voreiliges Rücktrittsversprechen, das der Salzburger Erzbischof Bernhard von Rohr Kaiser Friedrich III. gegeben hatte, führte zum verheerenden ,,Ungarischen Krieg". Der Erzbischof hatte sich mit dem Ungarnkönig Matthias Corvinus gegen den Kaiser verbündet, weil dieser seinen Günstling an seiner statt zum Erzbistum verhelfen wollte. Nach zweijährigen erbitterten Kämpfen wurde die Situation des Erzbischofs in der Stadt Salzburg, die von Friedrich begünstigt wurde und im daher zuneigte, immer schwieriger. Um die drohende Resignation zu verhindern, plante der Domprobst Christoph Ebran von Wildenberg ohne das Wissen des Landesfürsten einen Gewaltstreich. Am Rupertusfest (24.September) sollten ungarische Truppen durch den Stollen, der wegen der zu diesem Zeitpunkt fälligen Almabkehr trocken lag, in die Stadt geschleust werden. Dieser Plan, der auf eine Überrumpelung der kaisertreuen Bürgerschaft abzielte, wurde vorzeitig verraten und scheiterte. Schon fünf Tage später musste sich der Erzbischof geschlagen geben.
Der Almkanal heute
Häufig gestellte Fragen zu Der Stiftsarmstollen
Was ist der Stiftsarmstollen?
Der Stiftsarmstollen ist ein historischer Stollen in Salzburg, der im Frühmittelalter erbaut wurde. Er diente der Wasserversorgung der Stadt und gilt als ein Denkmal frühmittelalterlicher Baukunst.
Warum ist der Stiftsarmstollen wichtig?
Bis ins 13. Jahrhundert hatte Salzburg keine eigentliche Befestigung und die Wasserversorgung innerhalb der Stadtmauern war problematisch. Der Stiftsarmstollen löste dieses Problem, indem er Wasser ausserhalb der Stadt in die Stadt leitete und sicherte die Versorgung mit Trink- und Nutzwasser.
Wann wurde der Stiftsarmstollen erbaut?
Der Bau des Stiftsarmstollens begann im 12. Jahrhundert, vermutlich um 1127, und wurde um 1143 fertiggestellt.
Wer war am Bau des Stiftsarmstollens beteiligt?
Abt Balderich von St. Peter und Domprobst Hermann von Salzburg initiierten das Projekt. Ein Baumeister namens Albert leitete den Bau, unterstützt von Facharbeitern und Novizen der beiden Klöster.
Wie wurde der Stiftsarmstollen gebaut?
Der Stollen wurde durch den Mönchsberg gegraben, wobei man sich den natürlichen Wasserlauf zunutze machte. Der Stollenbau war schwierig und erforderte ständige Sicherung durch Pölzen und gemauerte Gewölbe.
Welche Schwierigkeiten gab es beim Bau des Stiftsarmstollens?
Ein Bergsturz verschüttete einen Großteil des Stollens, was zu einer vorübergehenden Einstellung des Baus führte. Später gab es Konflikte zwischen den Klöstern St. Peter und dem Salzburger Domkapitel, die sogar zur Zerstörung von Teilen des Werkes führten.
Wie lang ist der Stiftsarmstollen?
Der Stiftsarmstollen ist etwa 370 Meter lang.
Wie ist der Stiftsarmstollen aufgebaut?
Der Stollen ist im Schnitt etwa 0,80 bis 1,2 Meter breit und 1,50 bis 2,20 Meter hoch. Er ist mit Gewölben aus Steinquadern gesichert, wobei die ältesten Gewölbe einen trapezförmigen Querschnitt haben.
Was ist der Almkanal?
Der Almkanal ist das gesamte Kanalsystem, zu dem der Stiftsarmstollen gehört. Im Jahr 1286 wurde eine Verbindung zur Alm (Berchtesgadner- oder Königsseeache) hergestellt, um die Wasserversorgung zu verbessern.
Welche Bedeutung hatte der Almkanal für Salzburg?
Der Almkanal diente der Trinkwasserversorgung, der Bewässerung, dem Betrieb von Mühlen und der Entsorgung von Abfällen. Er hatte auch eine politische Bedeutung im Zusammenhang mit dem "Ungarischen Krieg".
Wie wurde der Almkanal zur Entsorgung genutzt?
Bürgerhäuser leiteten ihre Fäkalien in den Kanal ein. Durch die Umleitung des Wassers konnte Unrat und Abfall in die Salzach geschwemmt und so drohende Seuchen vermieden werden.
Welche Veränderungen gab es am Almkanal im Laufe der Zeit?
Die zunehmende Verschmutzung führte dazu, dass offene Teile des Kanals geschlossen wurden und Brunnen auf sauberes Wasser umgestellt wurden. Die Anzahl der Wasserrechte am Stiftsarm ging zurück.
Welche Bedeutung hat der Almkanal heute?
Der Almkanal ist heute vor allem aus kulturhistorischer Sicht bedeutend und gilt als ein einzigartiges Beispiel mittelalterlicher Baukunst.
- Quote paper
- Kristina Brandstetter (Author), 2000, Der Stiftsarmstollen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99568