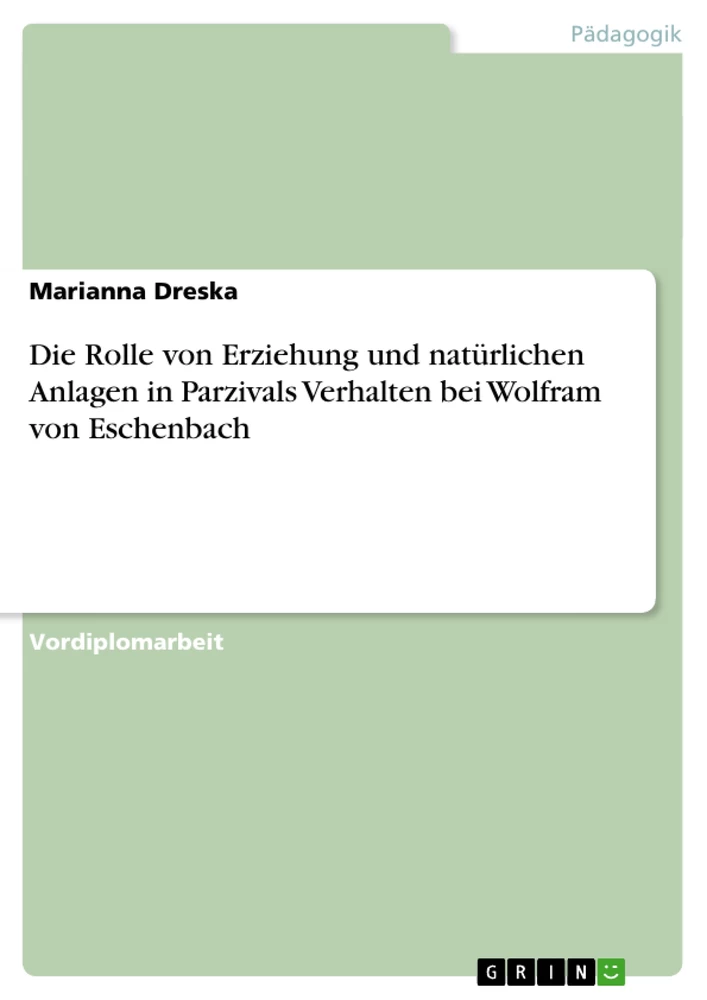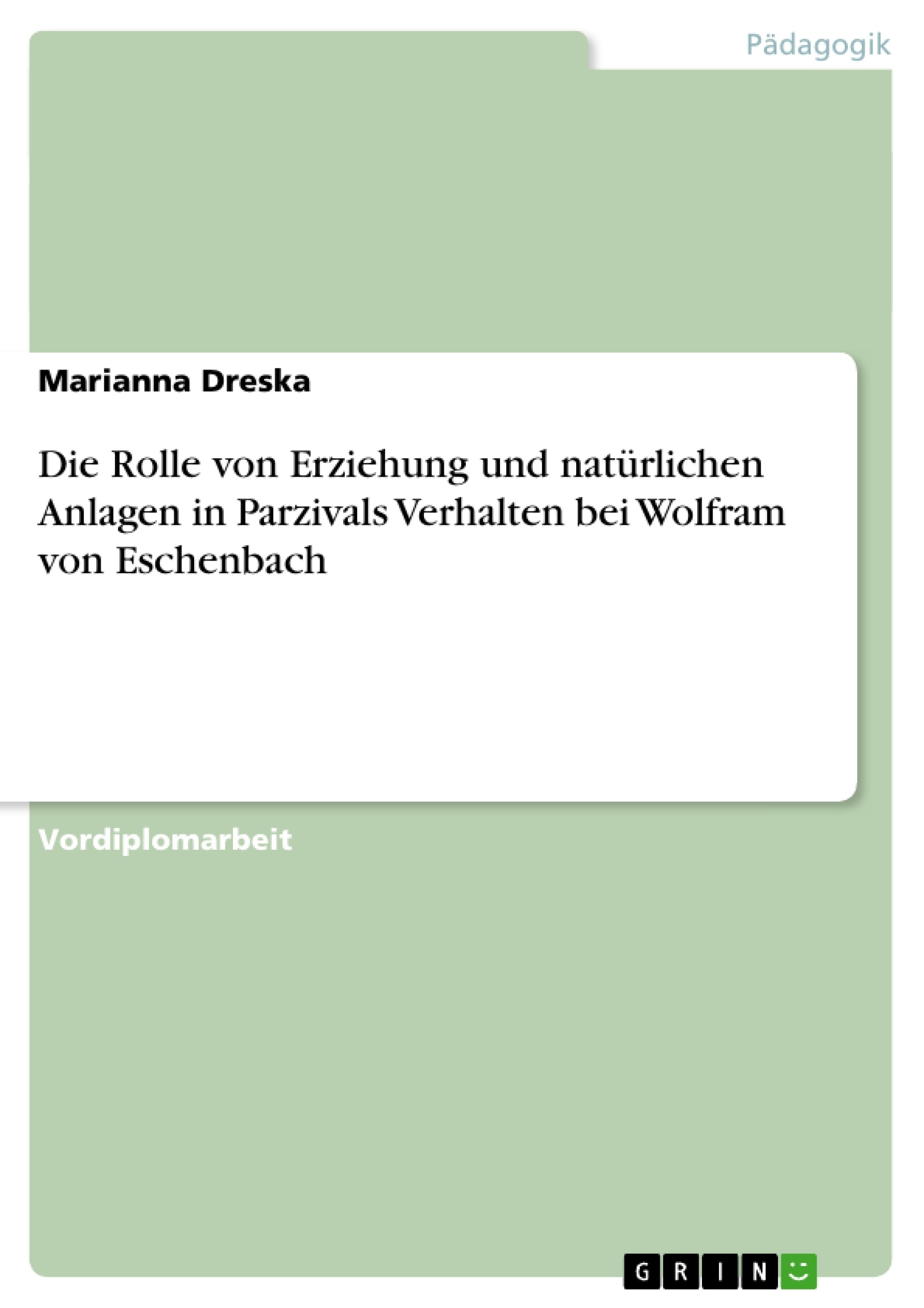Das geistige Leben des Mittelalters ist mit untrennbaren Fäden an das Altertum gebunden. In den literarischen Studien des Schulunterrichts lernte man die lateinischen Autoren kennen, vor allem aber hatten antiken Ideen den Geist des Christentums schon in der Frühzeit befruchtet. Kunst und Wissenschaft des Mittelalters als die Grundlagen der Bildung sind das Erbe des klassischen Altertums. Selbstverständlich ist diese Wirkung auch an den literarischen Werken zu erkennen.
Die Entwicklung der sowohl lateinischen als auch volkssprachlichen Dichtung des Mittelalters muss aber im Zusammenhang mit den geistigen Erneuerungsbewegungen gesehen werden.1 Das neue Interesse, die Unterscheidung der Seelenkräfte und die Beschreibung der Wahrnehmungs- und Erkenntnisprozesse wurde in diesen Dichtungen beschrieben. Dazu gehört auch der ,,Parzival" von Wolfram von Eschenbach. Der neue Gedanke, dass alle wahre Erkenntnis aus dem Inneren kommt, lässt sich in dieser Dichtung erkennen.
Im 12. Jahrhundert wurden die Minne-Lyrik und der Versroman zu den wichtigsten literarischen Gattungen. In Deutschland wurden meistens französische Vorlagen und Vorbilder überarbeitet. Abgesehen von dem ,,Nibelungenlied" sind alle großen deutschen Epen der Zeit um 1200 nach französischen Vorlagen gedichtet. Das höfische Epos wurde in dieser Zeit schon schriftlich aufgezeichnet.2
Obwohl die Klöster noch als Zentrum für Bildung und Kultur dominierten, gewann die Laienbildung eine größere Bedeutung. Der Eintritt der Laien in den Literaturprozess zog Veränderungen in der Literaturgesellschaft nach sich. Die Hauptschriften von Augustinus und anderen bedeutenden antiken Denkern, die Grundzüge ihrer Lehren waren den Gebildeten, wahrscheinlich auch Wolfram von Eschenbach, im 12. Jahrhundert allgemein zugänglich. Für Joachim Bumke gilt die Tatsache als gesichert, dass auch ,,Wolfram vielfachen Zugang zum Bildungsgut seiner Zeit hatte, auch zum lateinischen _...und_ dass er in der Lage war, mit solchem Material umzugehen".3 Von bewusster und systematisch angewandter Kenntnis durch Wolfram kann keine Rede sein, ,,aber die Grundgedanken der Augustinischen Theorien lebten in der Theologie des Augustinismus und im 12. und im beginnenden 13. Jahrhundert, und sie leben in den Grundzügen der katholischen Frömmigkeit Wolframs und seiner Zeit."4
Mit diesen Gedanken im Hintergrund möchte ich den ,,Parzival" von Wolfram von Eschenbach betrachten und analysieren [...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Wolframs Parzival
- II. 1. Kurze Zusammenfassung der Geschichte
- III. Das Versäumnis der Gralsfrage und die Hintergründe
- III. 1. Parzivals Kindheit
- III. 2. Parzivals Art
- III. 3. Parzivals Stumpheit
- III. 4. Die Lehren
- III. 4. 1. Herzeloyde
- III. 4. 2. Gurnemanz
- III. 4. 3. Trevrizent
- IV. Waren die Lehren schuld an Parzivals Versagen?
- IV. 1. Lehrer und Lehren nach Augustinus
- IV. 2. Parzival oder die Lehren
- V. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle von Erziehung und natürlichen Anlagen im Verhalten Parzivals in Wolframs Werk. Die Analyse konzentriert sich auf die Frage, inwieweit Parzivals Versagen an seinen Erziehern und den erhaltenen Lehren liegt oder ob seine Natur eine größere Rolle spielt. Dabei werden Parallelen zwischen augustinischen Erziehungsgedanken und der Erziehung Parzivals gezogen.
- Die Bedeutung der Erziehung im mittelalterlichen Kontext
- Die Rolle von Natur und Erziehung in der Persönlichkeitsentwicklung Parzivals
- Analyse von Parzivals Fehlern und deren Ursachen
- Vergleich mit augustinischen Erziehungsansätzen
- Interpretation von Parzivals Entwicklung im Kontext des Artus-Epos
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext des Werkes im mittelalterlichen geistigen Leben dar und betont die Verbindungen zum klassischen Altertum und den Einfluss geistiger Erneuerungsbewegungen. Sie skizziert das Interesse an der Unterscheidung der Seelenkräfte und Erkenntnisprozessen, wie sie in Wolframs „Parzival“ zum Ausdruck kommen. Die Arbeit kündigt an, Parzivals Versagen im Kontext seiner Erziehung und seiner angeborenen Eigenschaften zu untersuchen und dabei Parallelen zu Augustinus' Theorien zu ziehen.
II. Wolframs Parzival: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über Wolframs „Parzival“, seinen Platz in der mittelalterlichen Literatur und die Quellen, auf denen er basiert. Es betont Wolframs freie Interpretation der Vorlage und hebt die Bedeutung des inneren Weges Parzivals hervor, der der äußeren Handlung Sinn verleiht. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des Helden und der Frage nach der Bedeutung des Artusrittertums.
III. Das Versäumnis der Gralsfrage und die Hintergründe: Dieses Kapitel analysiert die Gründe für Parzivals Versagen, den Gral zu finden. Es untersucht seine Kindheit, seine Wesenszüge (Art und Stumpheit) und die Lehren, die er von Herzeloyde, Gurnemanz und Trevrizent erhält. Es wird untersucht, wie diese Faktoren zu seinem Scheitern beigetragen haben könnten.
IV. Waren die Lehren schuld an Parzivals Versagen?: Dieses Kapitel vertieft die Analyse der Rolle der Erziehung im Kontext von Parzivals Scheitern. Es untersucht Augustinus' Illuminationstheorie und versucht, Parzivals Situation anhand dieser Theorie zu interpretieren. Es wird untersucht, ob die Lehren, die Parzival erhält, ausschlaggebend für sein Versagen waren oder ob andere Faktoren eine größere Rolle spielen.
Schlüsselwörter
Parzival, Wolfram von Eschenbach, Mittelalter, Erziehung, Naturanlage, Augustinus, Illuminationstheorie, Gralsfrage, Artus-Epos, Persönlichkeitsentwicklung, Seelenkräfte, Erkenntnisprozesse.
Häufig gestellte Fragen zu: Wolfram von Eschenbachs Parzival - Erziehung und Naturanlage
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit untersucht die Rolle von Erziehung und angeborenen Anlagen in der Entwicklung und im Verhalten Parzivals in Wolfram von Eschenbachs Werk. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob Parzivals Versagen, den Gral zu finden, auf seine Erziehung und die erhaltenen Lehren zurückzuführen ist oder ob seine Natur eine größere Rolle spielt. Die Arbeit zieht Parallelen zu den Erziehungsgedanken des Augustinus.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Bedeutung der Erziehung im mittelalterlichen Kontext, die Rolle von Natur und Erziehung bei der Persönlichkeitsentwicklung Parzivals, eine Analyse von Parzivals Fehlern und deren Ursachen, einen Vergleich mit augustinischen Erziehungsansätzen und eine Interpretation von Parzivals Entwicklung im Kontext des Artus-Epos. Die Analyse konzentriert sich auf Parzivals Versäumnis bezüglich der Gralsfrage.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: I. Einleitung: Kontextualisierung des Werkes und der Forschungsfrage. II. Wolframs Parzival: Überblick über das Werk und seine Bedeutung in der mittelalterlichen Literatur. III. Das Versäumnis der Gralsfrage und die Hintergründe: Analyse der Gründe für Parzivals Scheitern, unter Berücksichtigung seiner Kindheit, seines Wesens und der Lehren seiner Erzieher (Herzeloyde, Gurnemanz, Trevrizent). IV. Waren die Lehren schuld an Parzivals Versagen?: Vertiefte Analyse der Rolle der Erziehung im Kontext von Parzivals Scheitern unter Einbezug der augustinischen Illuminationstheorie. V. Resümee: Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen.
Wie wird Augustinus in die Analyse einbezogen?
Die Arbeit zieht Parallelen zwischen den augustinischen Erziehungsgedanken und der Erziehung Parzivals. Insbesondere wird Augustinus' Illuminationstheorie herangezogen, um Parzivals Situation und sein Versagen zu interpretieren und die Rolle der erhaltenen Lehren zu bewerten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Die Arbeit wird durch folgende Schlüsselwörter beschrieben: Parzival, Wolfram von Eschenbach, Mittelalter, Erziehung, Naturanlage, Augustinus, Illuminationstheorie, Gralsfrage, Artus-Epos, Persönlichkeitsentwicklung, Seelenkräfte, Erkenntnisprozesse.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf Wolfram von Eschenbachs „Parzival“ und die Werke des Augustinus. Weitere Quellen sind nicht explizit im gegebenen Auszug genannt, könnten aber im vollständigen Text aufgeführt sein.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum gedacht, das sich für mittelalterliche Literatur, insbesondere Wolfram von Eschenbachs „Parzival“, Erziehungsphilosophie und die Wechselwirkung von Natur und Kultur interessiert.
- Quote paper
- Marianna Dreska (Author), 2002, Die Rolle von Erziehung und natürlichen Anlagen in Parzivals Verhalten bei Wolfram von Eschenbach, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9957