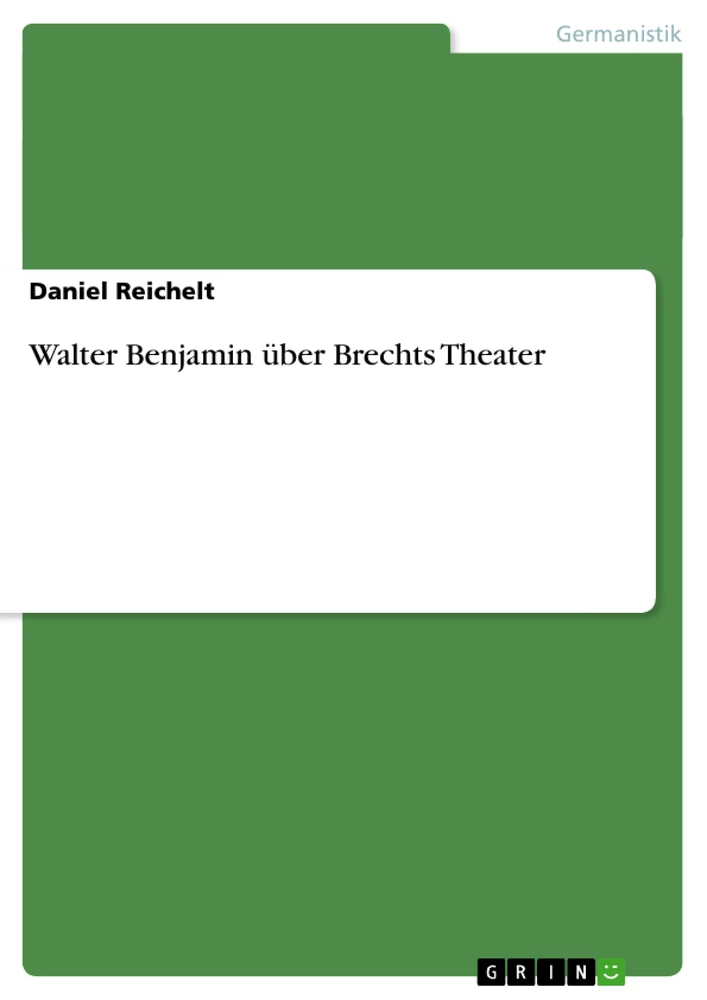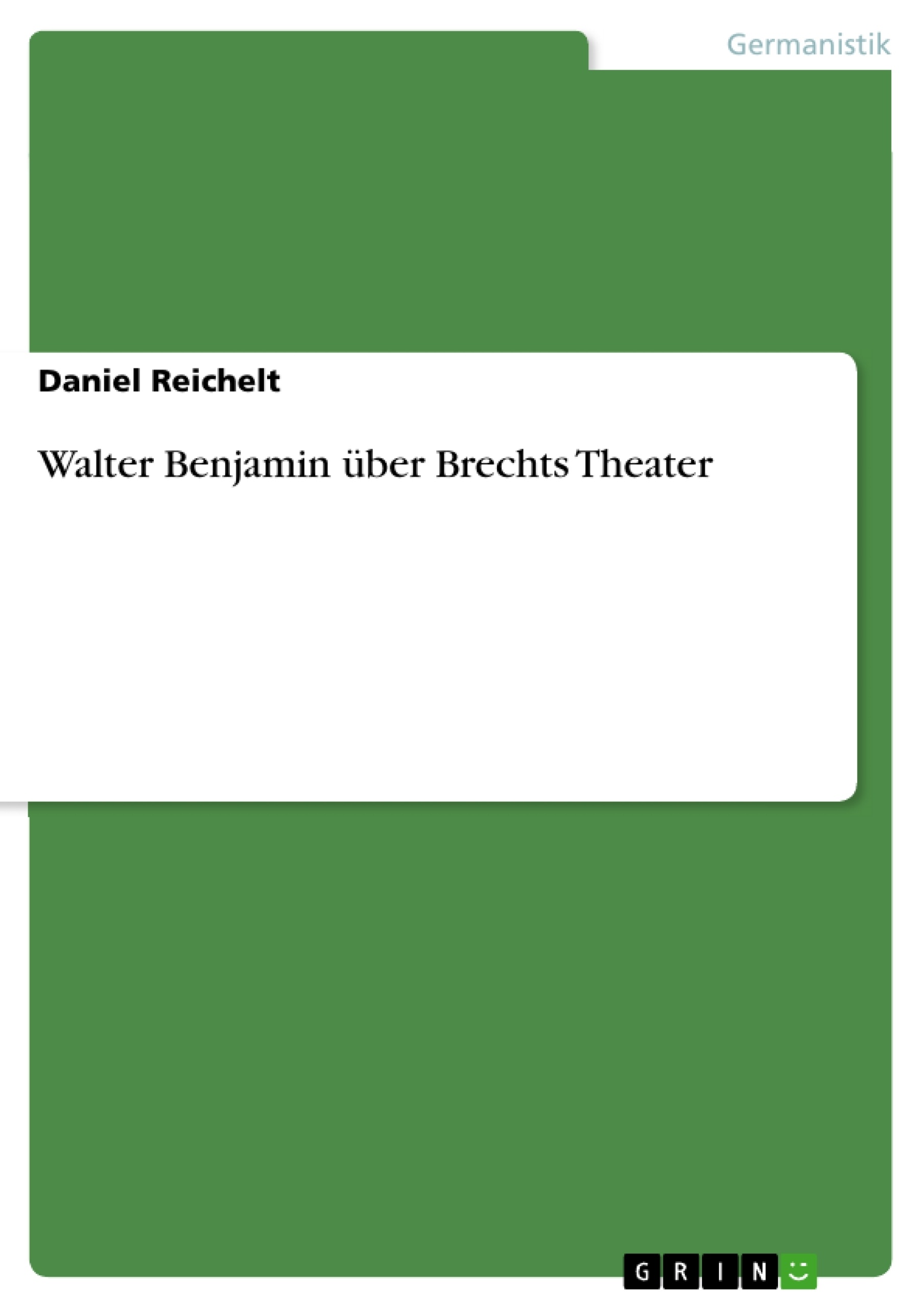Stellen Sie sich vor, die Bühne als Spiegel einer längst vergangenen Welt, in der die "verschüttete Orchestra" eine fundamentale Verschiebung in der Theaterlandschaft ankündigt. Diese bahnbrechende Analyse entführt den Leser in die Tiefen der Brecht'schen Theaterphilosophie, wo die traditionellen Konventionen des Dramas auf den Prüfstand gestellt werden. Entdecken Sie, wie Walter Benjamin die Irrelevanz überkommener Theaterformen anhand des Konzepts der Orchestra, dem heiligen Tanzplatz des antiken Theaters, seziert. Die einstige Bedeutung der Orchestra, die Bühne und Publikum trennte und eine Aura des Erhabenen schuf, weicht im modernen Theater einem profanen Podium. Benjamin argumentiert, dass zeitgenössische Dramen und Opern, die auf veralteten Bühnenapparaten basieren, die Bühne fälschlicherweise als bloßes Instrument zur Inszenierung des Dramas betrachten. Brecht hingegen nutzt das Drama als Werkzeug, um die Theateraufführung im Sinne einer gesellschaftlichen Veränderung zu beeinflussen. Die Studie beleuchtet den Einfluss des Naturalismus und der aristotelischen Poetik, die durch Einfühlung und Distanz die Zuschauer in eine passive Rolle zwängen. Brecht widersetzt sich dieser Denkweise und fordert ein Theater, das Geschichte nicht als unabänderliches Schicksal, sondern als gestaltbaren Prozess betrachtet. Erfahren Sie, wie Brecht ein neues Theater schuf, das sich durch seinen Bezug zur Bühne anstatt zum Drama definiert und somit eine völlig neue Institution verkörpert. Diese tiefgreifende Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen des epischen Theaters enthüllt die Notwendigkeit einer radikalen Neuausrichtung der Theaterpraxis im Angesicht einer sich wandelnden Welt und bietet faszinierende Einblicke in die progressive Kraft des Brecht'schen Theaters als Instrument gesellschaftlicher Veränderung und kritischer Reflexion. Tauchen Sie ein in eine Welt, in der die Bühne nicht nur ein Schauplatz, sondern ein politisches Manifest ist und in der die Kunst die Kraft hat, die Realität neu zu gestalten. Wagen Sie einen Blick hinter die Kulissen einer Revolution, die das Theater für immer verändern sollte, und entdecken Sie die verborgenen Botschaften einer "verschütteten Orchestra", die bis heute nachhallen. Diese Lektüre ist ein Muss für Theaterliebhaber, Studierende der Theaterwissenschaft und alle, die sich für die Schnittstelle von Kunst, Gesellschaft und politischem Wandel interessieren.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Walter Benjamin beginnt seine "Studien zur Theorie des epischen Theaters" mit folgender Feststellung: "Worum es heute im Theater geht, läßt sich genauer mit Beziehung auf die Bühne als auf das Drama bestimmen. Es geht um die Verschüttung der Orchestra." (17). Diese "verschüttete Orchestra" ist der Schlüssel für das Verständnis des gesamten theoretischen Konstrukts des Brecht'schen Theaters, sie steht hier symbolisch für die Irrelevanz althergebrachter Theaterformen.
Die Orchestra (griech.: Tanzplatz) ist der Geburtsort des abendländischen Theaters. Sie war ursprünglich eine den Altar des Dionysos umgebende Fläche, die Raum für kultische Tänze und Gesänge zu Ehren des Gottes bot. Mit dem Heraustreten des Protagonisten aus dem Chor des Dionysoskultes war der Vorläufer der Tragödie entstanden - im antiken Theaterbau bezeichnet die Orchestra dann das Aktionsfeld des Chores, während die Schauspieler sich im Laufe der Zeit gänzlich auf die Skene zurückzogen, einer erhöhten Spielfläche hinter der Orchestra. Der Chor ist jedoch das konstituierende Element der Tragödie: "Die Szene samt der Aktion [wurde] im Grunde und ursprüngleich nur alsVision gedacht [...], die einzige 'Realität' [ist] eben der Chor [...], der die Vision aus sich erzeugt und von ihr mit der ganzen Symbolik des Tanzes, des Tones und des Wortes redet" (Friedrich Nietzsche: Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, Ffm 1987, 72). Wenngleich der Chor schon während der Zeit der griechischen Klassik an Bedeutung erheblich verloren hat, ist er in seiner projizierenden Funktion dennoch im Theater nahezu aller späteren Epochen spürbar geblieben, und zwar durch die ständige Präsenz seiner ursprünglichen Spielfläche, der Orchestra. Sie ist "der Abgrund, der die Spieler vom Publikum wie die Toten von den Lebendigen scheidet, dessen Schweigen im Schauspiel die Erhabenheit, dessen Klingen in der Oper den Rausch steigert, der unter allen Elementen der Bühne die Spuren ihres sakralen Ursprungs am unverwischbarsten trägt [...]" (17). Walter Benjamin konstatiert jedoch die "Verschüttung der Orchestra", behauptet: "[Sie] ist funktionslos geworden. Noch liegt die Bühne erhöht, steigt aber nicht mehr aus einer unermeßlichen Tiefe auf; sie ist Podium geworden. [...] Das ist die Lage"
(17). Weiterhin stellt er fest, daß das Gegenwartstheater zu dieser Erkenntnis noch nicht gelangt ist oder sie absichtlich ignoriert: "Immer weiter werden Tragödien und Opern geschrieben, denen scheinbar ein altbewährter Bühnenapparat zur Verfügung steht, während sie in Wirklichkeit nichts tun, als einen hinfälligen beliefern" (17). Damit einher geht die Liquidierung der Illusion, das Theater gründe sich heute auf Dichtung (vgl. 17). Die Bühne inszeniert nach Brecht (vgl. 17) und Benjamin nicht mehr das dramatische Werk, sondern das Drama ist bloß noch Instrument zur Inszenierung des Bühnenapparates. Bei Brecht sei dieses Wirkungsverhältnis von Bühne und Werk beabsichtigt, mit dem wesentlichen Unterschied, daß der Text nicht den Bühnenapparat sondern die Theateraufführung zum Zwecke der Veränderung des Apparates beliefern solle, während beim Zeittheater die Bühne den nur scheinbar autonomen Text mißbrauche. Beide Theaterphilosophien aber können Benjamins Eingangsthese, das Theater bezöge sich mehr auf die Bühne als auf das Drama, für sich in Anspruch nehmen - Brecht tut dies bewußt, das zeitgenössische Theater jedoch zeige sich diesbezüglich uneinsichtig und reaktionär, was "'ungeheure Folgen'" (17) habe.Wie kommt es aber zu diesem Mißverhältnis zwischen Bühne und Text, von dem das Brecht'sche Theater sich so vehement distanziert? Die einzige Antwort, die Benjamin gibt, ist der Hinweis auf die "verschüttete Orchestra".
Ein Blick auf die Theatertheorien, auf denen die Praxis des Zeittheaters basiert, kann dieses Phänomen näher beleuchten. Es handelt sich um den Naturalismus und den fortdauernden Einfluß der Aristotelischen Poetik. Der Naturalismus geht davon aus, daß Kunst die Wirklichkeit wiedergeben und als Illusion der Wirklichkeit erscheinen soll. Es handelt sich also um eine Identifikation von Kunst und Leben. Aristoteles bringt die Funktionsweise und Wirkungsabsicht des Theaters (der antiken Tragödie) auf die Formel, in der Katharsis (seelische Läuterung) über das Erwecken von Furcht und Mitleid im Zuschauer erreicht wird. Das Mittel hierzu sei die Mimesis (Nachahmung). Beide Theater wirken duch das Prinzip der Einfühlung in die Bühnenfiguren bei gleichzeitiger Distanz zum Geschehen. Was bei der alten Tragödie diese Einfühlung durch Distanz ermöglicht, ist die Orchestra; beim naturalistischen Theater ist es die "vierte Wand". Doch auch die "vierte Wand" läßt die Bühnenhandlung zu einer Projektion werden, die freilich nicht mehr die Vision eines Chores sondern die des Theaterbaus ist, welcher sie in sich behält und niemals freigeben kann. In diesem Sinne ist die "vierte Wand" als eines der zahlreichen Relikte der Orchestra deutbar.
Die Orchestra zwingt den Zuschauer in eine passive Rolle, der ein Weltbild des Unabänderlichen zugrunde liegt. Der Mensch wird 2500 Jahre nach der Geburt der Tragödie noch immer als ein Bestandteil der festgefügten Naturordnung und nicht als gesellschaftliches Wesen wahrgenommen, das die Macht hat seine gesamte Existenz selbst neu zu definieren. Dagegen wehrt sich Brecht (vgl. Jan Knopf: Brecht Handbuch; Stuttgart 1980, Abschnitte "Anti-Aristoteles" und "Anti-Naturalismus" 385 - 86). Für ihn ist Geschichte nicht das Schicksal, das über die Menschen hereinbricht, sondern besteht aus "'Vorgänge[n] hinter den Vorgängen, die das Schicksal bestimmen, das heißt in die tief eingreifend man in das Schicksal der Menschen eingreifen kann [und die] unter Menschen vor sich [gehen]'" (Brecht, zitiert aus: Jan Knopf: Brecht Handbuch, Stuttgart 1980, 386). Die Zeiten haben sich geändert. So wie die Naturwissenschaft die Aristotelische Physik widerlegt hat, muß der gesellschaftswissenschaftliche Fortschritt (also Marx' Philosophie des Materialismus') die gesellschaftlichen Zwänge endlich auch praktisch überwinden.
Ausdruck dieser überkommenen Denkstrukturen der Massen ist bei Benjamin unter anderem der fortbestehende Glaube an die Notwendigkeit der Orchestra. Das technische Zeitalter hat sie verschüttet, nicht etwa eine den Zeitgeschmack mehr ansprechende Ästhetik irgendeines Theaterphilosophen. Die "Verschüttung der Orchestra" ist lediglich Symptom einer veränderten Welt, und diese veränderte Welt allein ist es, auf die das Theater reagieren muß. Demnach kann sich das moderne Theater nur durch den Bezug auf die Bühne anstatt auf das Drama definieren. Das alte Theater funktioniert nicht ohne Orchestra, weshalb erst die Bühne einer neuen Identität bedarf, in die das Drama dann einzufügen ist. Es stellt sich auch die Frage, inwiefern das Theater überhaupt noch eine Existenzberechtigung hat, wo es doch durch die Entwicklung des wissenschaftlichen Fortschritts offensichtlich seiner Spielfläche beraubt wurde. Die Antwort gibt Brecht, indem er ein neues Theater schafft, das mit dem alten nur noch im Namen etwas gemeinsam hat. Das Epische Theater darf somit nicht als Stil mißverstanden werden, es ist vielmehr eine völlig neue Institution. Walter Benjamin schreibt über Brecht: "Unstreitig jedenfalls, daß er unter allen in Deutschland Schreibenden der einzige ist, der sich fragt, wo er seine Begabung ansetzen muß, sie nur da ansetzt, wo er von der Notwendigkeit es zu tun überzeugt ist, und bei jeder Gelegenheit, die diesem Prüfstein nicht entspricht, schlappmacht" (Walter Benjamin: Aus dem Brecht-Kommentar; in: ders.: Versuche über Brecht, (s.o.), 40). Diese Aussage verdeutlicht, wie sehr Brecht sich der Notwendigkeit verpflichtet fühlt, zeigt ihn als unerschütterlichen Pragmatiker. Brecht schreibt seine Dramen nicht als Bettlektüre sondern zum Zwecke der Aufführung, und auch das nur, weil er überzeugt ist, damit etwas bewirken zu können. Die Aufführung ist es, die sein Theater ausmacht.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Walter Benjamins "Studien zur Theorie des epischen Theaters"?
Walter Benjamin beginnt seine Analyse mit der Feststellung, dass es im zeitgenössischen Theater eher um die Bühne als um das Drama selbst geht. Er spricht von der "Verschüttung der Orchestra" als Symbol für die Irrelevanz traditioneller Theaterformen.
Was ist die "Orchestra" und warum ist sie wichtig?
Die Orchestra ist der ursprüngliche Tanzplatz im griechischen Theater, der Ort kultischer Tänze und Gesänge. Sie symbolisiert den Abgrund zwischen Schauspielern und Publikum und trägt die Spuren sakraler Ursprünge. Ihre "Verschüttung" deutet auf eine veränderte Theaterlandschaft hin.
Wie unterscheidet sich das zeitgenössische Theater von Brechts Theaterauffassung?
Benjamin kritisiert, dass das zeitgenössische Theater weiterhin auf überholten Bühnenapparaten basiert und das Drama lediglich zur Inszenierung des Bühnenbilds instrumentalisiert. Brecht hingegen nutzt das Drama bewusst zur Veränderung des Bühnenapparates und zur gesellschaftlichen Veränderung.
Welche Rolle spielen Naturalismus und Aristotelische Poetik im zeitgenössischen Theater?
Naturalismus und die Aristotelische Poetik, die auf Illusion und Katharsis durch Einfühlung setzen, beeinflussen das zeitgenössische Theater. Benjamin sieht in der "vierten Wand" des naturalistischen Theaters ein Relikt der Orchestra, das den Zuschauer in eine passive Rolle zwingt.
Wie positioniert sich Brecht gegen überkommene Denkstrukturen?
Brecht wehrt sich gegen die Vorstellung, dass Geschichte ein unabänderliches Schicksal ist. Er betont die gesellschaftliche Veränderbarkeit und kritisiert Denkstrukturen, die den Menschen als Teil einer festen Naturordnung wahrnehmen.
Was bedeutet die "Verschüttung der Orchestra" im technischen Zeitalter?
Die "Verschüttung der Orchestra" ist laut Benjamin ein Symptom einer veränderten Welt, auf die das Theater reagieren muss. Das moderne Theater muss sich demnach durch den Bezug auf die Bühne anstatt auf das Drama definieren.
Warum schafft Brecht ein neues Theater?
Brecht schafft ein neues Theater, das mit dem alten nur noch im Namen etwas gemeinsam hat, weil er der Überzeugung ist, dass er damit etwas bewirken kann. Sein Episches Theater ist nicht als Stil, sondern als eine völlig neue Institution zu verstehen.
- Quote paper
- Daniel Reichelt (Author), 2000, Walter Benjamin über Brechts Theater, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99652