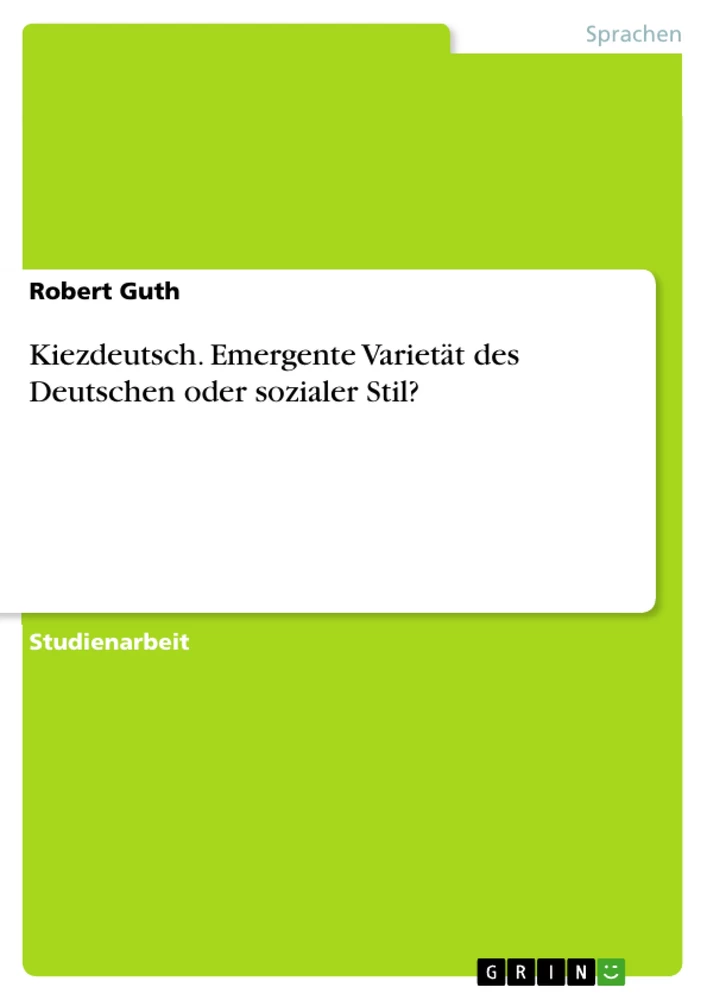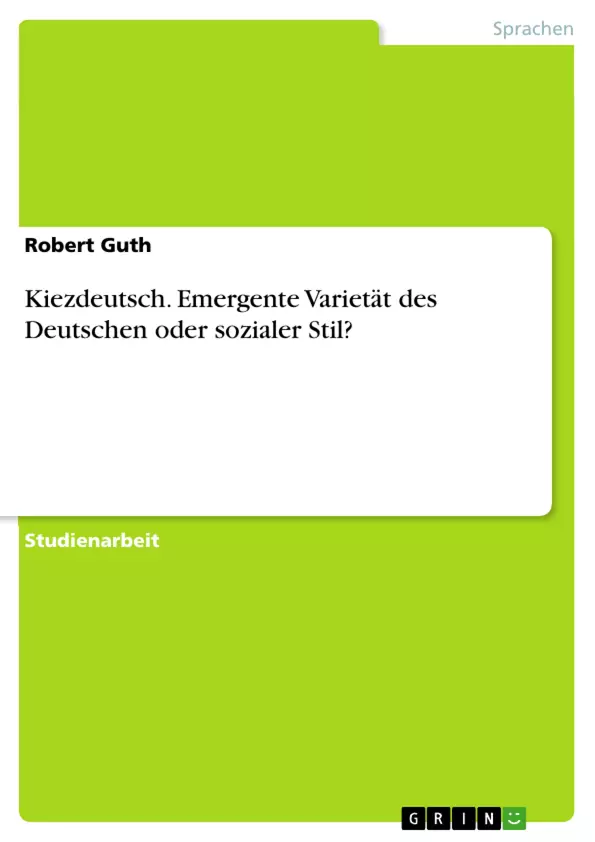Eine Frage, mit der sich die Sprachwissenschaft eingehend beschäftigt, jedoch noch nicht zu einem konkreten Ergebnis gelangen konnte, ist, ob das Kiezdeutsch lediglich ein sozialer Stil oder eine neue emergente Varietät des Deutschen ist.
Auf diese Frage möchte ich in dieser Arbeit eingehen. Eingangs gehe ich auf die Entstehung des Kiezdeutschen ein, danach folgen zunächst einige für das Verständnis der Hausarbeit begriffliche Klärungen, bei denen ich die verschiedenen wissenschaftlichen Termini zunächst definiere und dann voneinander abgrenze. Im Anschluss wende ich mich der zentralen Fragestellung zu, inwiefern man das Kiezdeutsch unter einen sozialen Stil und eine emergente Varietät subsumieren kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffsklärung
- 2.1 Definition - Was ist unter Kiezdeutsch zu verstehen?
- 3 Varietät - Abgrenzung und Definition
- 4 Sozialer Stil - Abgrenzung und Definition
- 5 Kiezdeutsch - emergente Varietät oder sozialer Stil?
- 6 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die sprachliche Erscheinung „Kiezdeutsch“ und beleuchtet die Frage, ob es sich dabei um einen sozialen Stil oder eine emergente Varietät des Deutschen handelt. Die Arbeit analysiert die relevanten linguistischen Konzepte von Varietät und sozialem Stil und setzt diese in Beziehung zum Kiezdeutsch.
- Definition und Abgrenzung von Kiezdeutsch
- Linguistische Definition von Varietät und sozialem Stil
- Analyse des Kiezdeutsch im Hinblick auf Varietäts- und Stilmerkmale
- Diskussion der Herausforderungen bei der Klassifizierung von Kiezdeutsch
- Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Sprachwandel und die Heterogenität des Deutschen ein. Sie stellt die kontroverse Diskussion um neue Sprachformen wie Kiezdeutsch vor und thematisiert die unterschiedlichen Perspektiven auf Sprachentwicklung – von der Angst vor einem „Verfall“ bis zur objektiven Beschreibung linguistischer Prozesse. Die Arbeit skizziert die zentrale Forschungsfrage: Ist Kiezdeutsch ein sozialer Stil oder eine emergente Varietät?
2 Begriffsklärung: Dieses Kapitel liefert eine Definition von Kiezdeutsch, basierend auf wissenschaftlichen Quellen, und beschreibt seinen Ursprung in multiethnischen Stadtvierteln. Es betont, dass der Begriff von Heike Wiese geprägt wurde, die durch Interviews mit Jugendlichen in Berlin-Kreuzberg die Bezeichnung "Kiezdeutsch" geprägt hat. Der Fokus liegt auf der alltagssprachlichen und informellen Natur dieser Sprachform.
3 Varietät – Abgrenzung und Definition: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Definition und Abgrenzung des linguistischen Begriffs „Varietät“. Es legt den Grundstein für die spätere Klassifizierung von Kiezdeutsch, indem es die Kriterien für die Identifizierung einer Sprachvarietät darlegt. Es wird erklärt, wie sprachliche Kombinationen als relativ abgeschlossene Einheiten betrachtet werden können und wie der Begriff der "Varietät" zur Beschreibung sprachlicher Variation dient.
4 Sozialer Stil - Abgrenzung und Definition: Ähnlich wie im vorherigen Kapitel werden die Definition und Abgrenzung des Konzepts "sozialer Stil" in der Linguistik erläutert. Das Kapitel liefert die notwendigen Kriterien zur Unterscheidung zwischen sozialem Stil und Varietät, um die spätere Einordnung von Kiezdeutsch vorzubereiten. Der Fokus liegt auf den soziolinguistischen Aspekten und der sprachlichen Anpassung an soziale Kontexte.
5 Kiezdeutsch - emergente Varietät oder sozialer Stil?: Dieses Kapitel stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit dar und analysiert Kiezdeutsch im Lichte der vorherigen Definitionen von Varietät und sozialem Stil. Es untersucht, welche Merkmale von Kiezdeutsch auf eine Varietät und welche auf einen sozialen Stil hindeuten. Es soll die komplexe Frage der Einordnung dieser Sprachform diskutiert werden.
Schlüsselwörter
Kiezdeutsch, Sprachwandel, Varietät, sozialer Stil, emergente Varietät, Soziolinguistik, Mehrsprachigkeit, Sprachvariation, Urbanität, linguistische Analyse.
Häufig gestellte Fragen zu "Kiezdeutsch: Emergente Varietät oder Sozialer Stil?"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die sprachliche Erscheinung „Kiezdeutsch“ und beleuchtet die Frage, ob es sich dabei um einen sozialen Stil oder eine emergente Varietät des Deutschen handelt. Die Arbeit analysiert die relevanten linguistischen Konzepte von Varietät und sozialem Stil und setzt diese in Beziehung zum Kiezdeutsch.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Abgrenzung von Kiezdeutsch, die linguistische Definition von Varietät und sozialem Stil, die Analyse des Kiezdeutsch im Hinblick auf Varietäts- und Stilmerkmale, die Diskussion der Herausforderungen bei der Klassifizierung von Kiezdeutsch und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Begriffsklärung (inkl. Definition von Kiezdeutsch und dessen Ursprung), Varietät – Abgrenzung und Definition, Sozialer Stil – Abgrenzung und Definition, Kiezdeutsch – emergente Varietät oder sozialer Stil? und Fazit und Ausblick. Jedes Kapitel fasst seine Ergebnisse zusammen.
Was wird unter Kiezdeutsch verstanden?
Der Begriff Kiezdeutsch wird in der Arbeit wissenschaftlich definiert und auf seinen Ursprung in multiethnischen Stadtvierteln zurückgeführt. Es wird betont, dass der Begriff von Heike Wiese geprägt wurde, basierend auf ihren Interviews mit Jugendlichen in Berlin-Kreuzberg. Der Fokus liegt auf der alltagssprachlichen und informellen Natur dieser Sprachform.
Wie werden Varietät und sozialer Stil linguistisch definiert?
Die Arbeit liefert detaillierte Definitionen und Abgrenzungen der linguistischen Begriffe „Varietät“ und „sozialer Stil“. Sie legt die Kriterien für die Identifizierung einer Sprachvarietät und die Unterscheidung zwischen sozialem Stil und Varietät dar, um die spätere Einordnung von Kiezdeutsch zu ermöglichen. Die soziolinguistischen Aspekte und die sprachliche Anpassung an soziale Kontexte werden berücksichtigt.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit bezüglich der Einordnung von Kiezdeutsch?
Das zentrale Kapitel analysiert Kiezdeutsch im Lichte der vorherigen Definitionen von Varietät und sozialem Stil. Es untersucht, welche Merkmale auf eine Varietät und welche auf einen sozialen Stil hindeuten und diskutiert die komplexe Frage der Einordnung dieser Sprachform. Die genaue Schlussfolgerung wird im Kapitel "Kiezdeutsch - emergente Varietät oder sozialer Stil?" und im Fazit präsentiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kiezdeutsch, Sprachwandel, Varietät, sozialer Stil, emergente Varietät, Soziolinguistik, Mehrsprachigkeit, Sprachvariation, Urbanität, linguistische Analyse.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Linguisten, Soziolinguisten, Sprachwissenschaftler und alle, die sich für Sprachwandel, Sprachvariation und die sprachliche Vielfalt im urbanen Raum interessieren.
- Arbeit zitieren
- Diplom-Verwaltungswirt Robert Guth (Autor:in), 2019, Kiezdeutsch. Emergente Varietät des Deutschen oder sozialer Stil?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/997144