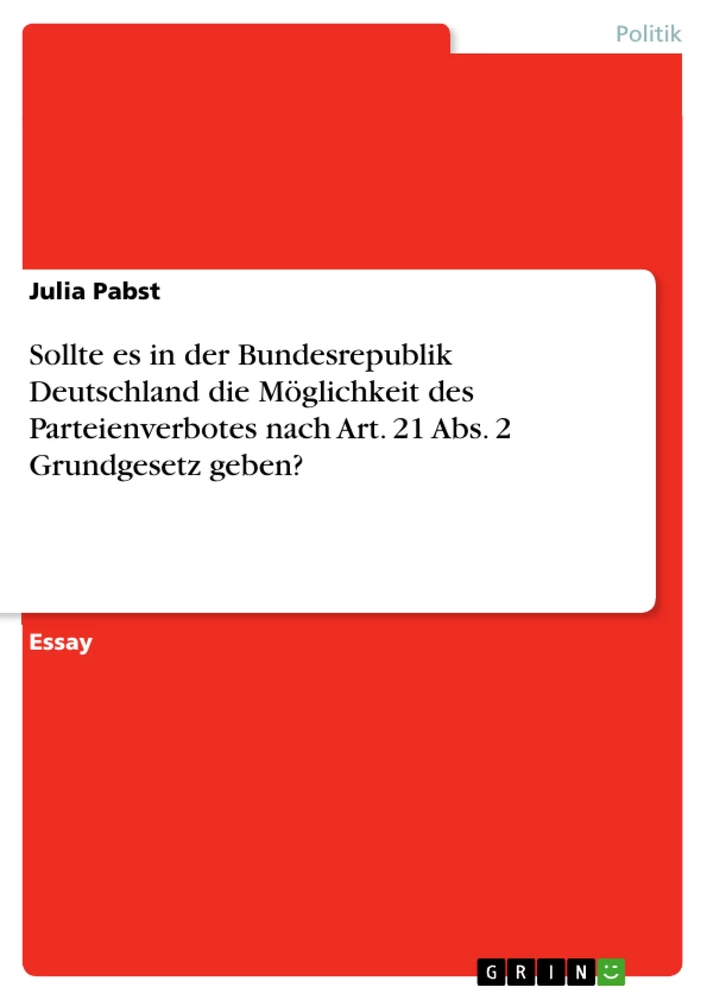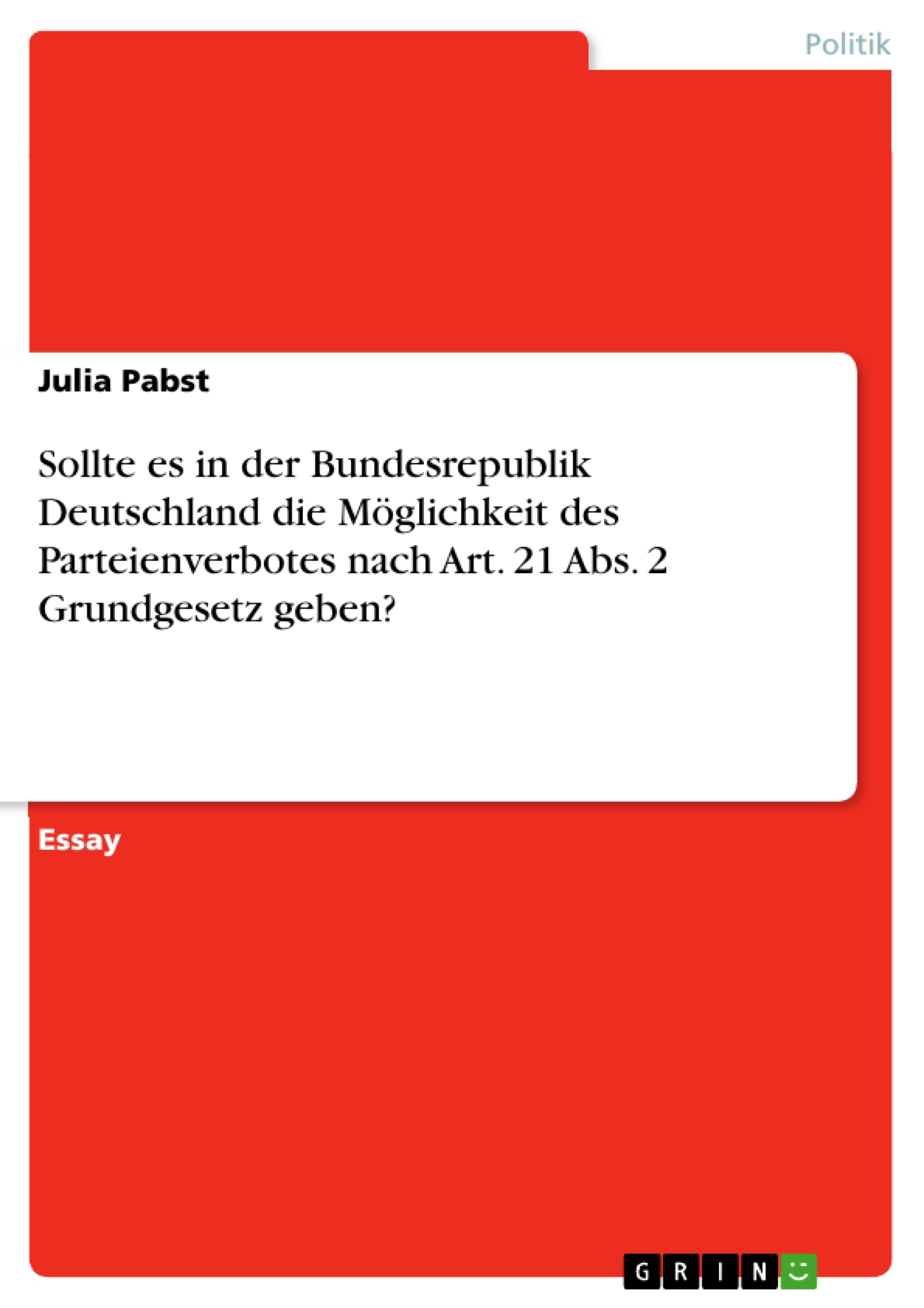Dieser Essay beschäftigt sich mit der Frage, ob es in der Bundesrepublik Deutschland die Möglichkeit geben sollte, eine Partei nach Art. 21 Abs. 2 Grundgesetz verbieten zu können, wenn sie gegen die demokratischen Grundwerte unseres Landes vorgeht.
Bereits das erste Verbotsverfahren der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD) im Jahre 2003, führte dazu, dass die Debatte zu Parteienverboten wieder an Relevanz gewann. Das Verfahren scheiterte. Es wurde neu aufgerollt, als die Mordserien des Nationalsozialistischen Untergrunds aufgedeckt wurden. Aus diesem Grund stellte der Bundesrat einen weiteren Verbotsantrag am 3. Dezember 2013 beim zuständigen Bundesverfassungsgericht (BVerfG). Dieses zweite Verfahren führte jedoch auch zu keinem Verbot und endete im Januar 2017. Das BVerfG begründete seine Entscheidung mit der Unverhältnismäßigkeit eines Verbotes, aber stellte dennoch fest, dass die Partei verfassungsfeindliche Ziele verfolgte.
Inhaltsverzeichnis
- Sollte es in der Bundesrepublik Deutschland die Möglichkeit des Parteienverbotes nach Art. 21 Abs. 2 Grundgesetz geben?
- Argumente gegen ein Parteienverbot
- Freiheitlich-demokratische Grundordnung
- Volkssouveränität
- Ineffektivität
- Hindernisse im Verfahren
- Argumente für ein Parteienverbot
- Verhinderung der Vernichtung der Demokratie
- Klare Stellungnahme der Judikative
- Finanzielle Unterstützung des Staates
- Weniger Menschen würden extreme Werte tolerieren
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob in der Bundesrepublik Deutschland die Möglichkeit des Parteienverbotes nach Art. 21 Abs. 2 Grundgesetz bestehen sollte. Die Autorin analysiert Argumente für und gegen ein Verbot und beleuchtet die rechtlichen und politischen Aspekte dieser Thematik.
- Freiheitlich-demokratische Grundordnung
- Volkssouveränität
- Ineffektivität des Parteienverbotes
- Hindernisse im Verfahren
- Schutz der Demokratie vor extremistischen Parteien
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beginnt mit einer Einleitung, die die historische Entwicklung des Parteienverbotes in Deutschland aufzeigt. Anschließend werden die Argumente gegen ein Verbot dargelegt, die sich auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die Volkssouveränität, die Ineffektivität und die Hindernisse im Verfahren konzentrieren.
Im folgenden Kapitel werden die Argumente für ein Parteienverbot vorgestellt, wobei der Schutz der Demokratie vor extremistischen Parteien, die klare Stellungnahme der Judikative, die finanzielle Unterstützung des Staates und die Reduzierung der Toleranz gegenüber extremen Werten im Vordergrund stehen.
Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung, die die "verfassungsrechtliche Gradwanderung" hervorhebt und die Wichtigkeit der rechtlichen Möglichkeit des Parteienverbotes betont.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Parteienverbot, Art. 21 Abs. 2 Grundgesetz, Demokratie, Rechtsextremismus, Volkssouveränität, Freiheitlich-demokratische Grundordnung, Wehrhafte Demokratie, Rechtliche Rahmenbedingungen und historische Erfahrungen.
Häufig gestellte Fragen
Auf welcher gesetzlichen Grundlage basiert ein Parteienverbot in Deutschland?
Ein Parteienverbot basiert auf Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes (GG).
Warum scheiterte das NPD-Verbotsverfahren im Jahr 2017?
Das Bundesverfassungsgericht stufte ein Verbot als unverhältnismäßig ein, da keine konkreten Anhaltspunkte für eine erfolgreiche Umsetzung der verfassungsfeindlichen Ziele vorlagen.
Was sind die Hauptargumente gegen ein Parteienverbot?
Kritiker führen die Volkssouveränität, die mögliche Ineffektivität (Abtauchen in den Untergrund) und die hohen verfahrensrechtlichen Hürden an.
Welche Argumente sprechen für die Möglichkeit eines Verbots?
Befürworter betonen den Schutz der Demokratie (wehrhafte Demokratie), die Beendigung staatlicher Finanzierung für Extremisten und eine klare moralische Stellungnahme der Judikative.
Was versteht man unter einer „wehrhaften Demokratie“?
Dies ist das Konzept, dass der Staat Instrumente wie das Parteienverbot nutzen darf, um sich gegen Kräfte zu verteidigen, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen wollen.
- Quote paper
- Julia Pabst (Author), 2021, Sollte es in der Bundesrepublik Deutschland die Möglichkeit des Parteienverbotes nach Art. 21 Abs. 2 Grundgesetz geben?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/997401