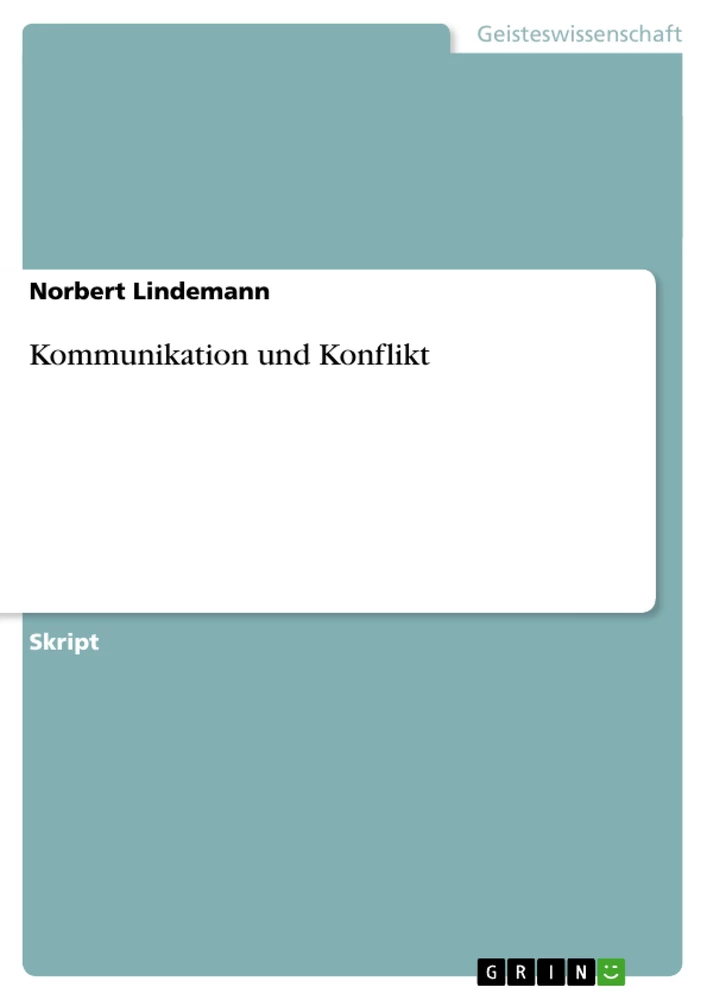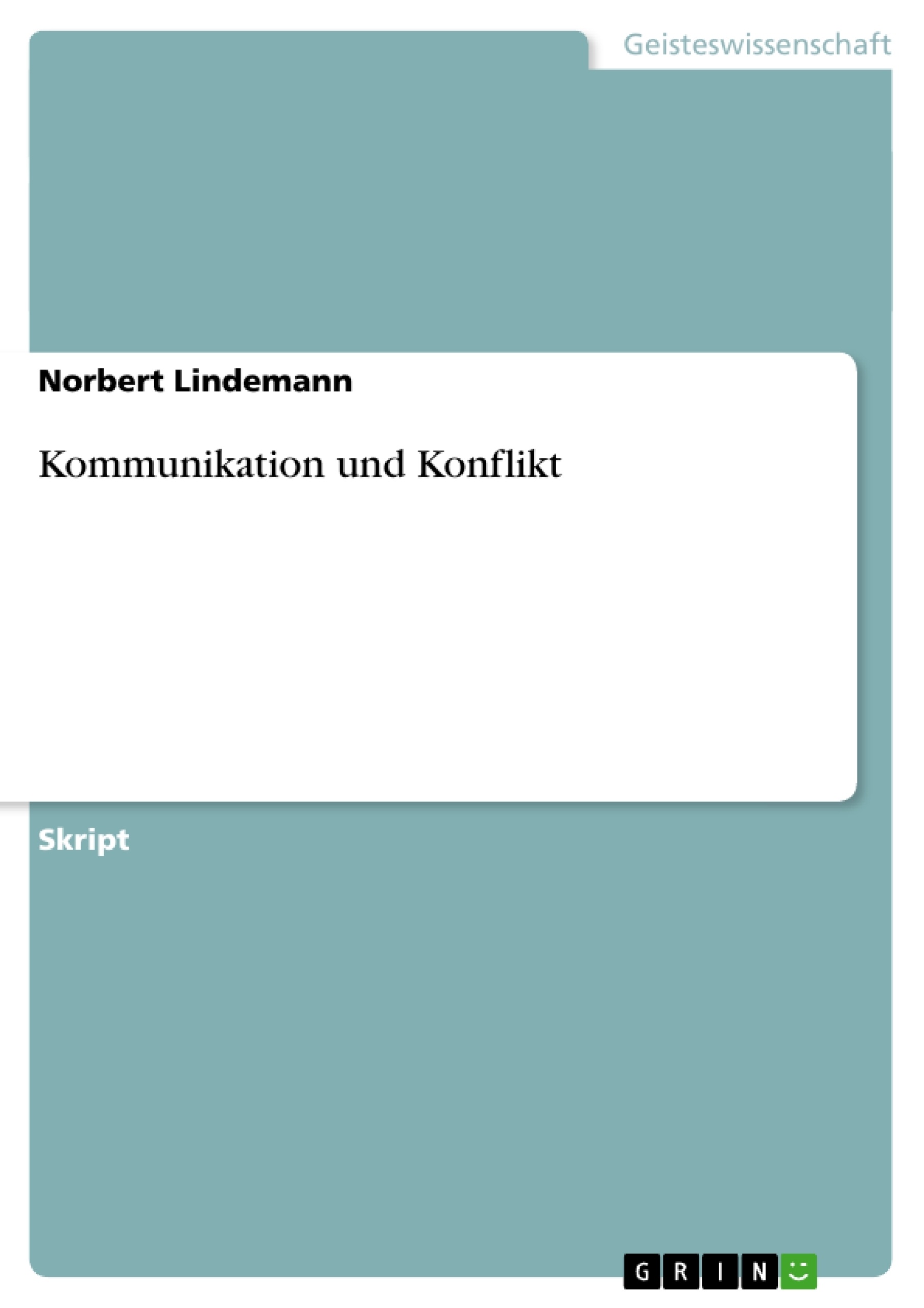Thema: Kommunikation und Konflikt
Das Modell der kooperativen Entscheidungsfindung (nach W.F. Neubauer)
Der Problemlösungsprozeß als Stufenmodell
Das Beratungsgespräch als gemeinsamen Problemlösungsprozeß zu verstehen und diesen auch gemeinsam voranzutreiben erscheint besonders im Hinblick auf den Schulalltag sinnvoll. Dieser bietet fast täglich Situationen, in denen Lehrer und Schüler eine Einigung über ihr ge- meinsames Anliegen, nämlich den Unterricht, erzielen müssen. Der Ansatz des Problemlö- sungsprozesses geht ursprünglich auf Untersuchungen zur Auswirkung von Gruppenentschei- dungen durchK. Lewinzurück und wurde in neuerer Zeit durch Arbeiten vonGoldfriedver- tieft. Dabei wird von der Annahme ausgegangen, daß weder der Berater noch der Klient auf- grund seines individuellen Kenntnisstandes ein erwünschtes Ziel realisieren kann. Der Lehrer beispielsweise verfügt über Kenntnisse, wie das Problem möglicherweise zu lösen ist, weiß aber nicht konkret, worin das eigentliche Problem des Schülers besteht. Dem Schüler mangelt es vielleicht an geeigneten Strategien, die eine Lösung des Problems versprechen. Ziel des Gesprächs muß es deshalb sein, zu einem erfolgreichen Gesprächsabschluß zu gelangen. Zur Strukturierung des Gesprächs dienen 5 aufeinander aufbauende Phasen:
Phase 1: Allgemeine Orientierungsphase
Beim Klienten soll zunächst ein Problembewußtsein entwickelt werden. Er muß sich darüber im Klaren sein, daß Probleme zwangsläufig da sind und daß sie bewältigt werden können. Dabei soll die konkrete Problemsituation möglichst klar herausgestellt und vom Klienten erkannt werden. Um das tatsächliche Problem auch wirklich lösen zu können sollten vorschnelle Lösungen zurückgestellt werden.
Phase 2: Phase der Problemdefinition und Formulierung
Die problematische Situation soll in allen wesentlichen Aspekten erkannt werden und ein konkretes Problem soll formuliert werden.
Phase 3: Phase der Entwicklung von Alternativen
Es sollen verschiedene Lösungswege gesucht werden. Das Zusammentragen unter- schiedlicher Lösungsvorschläge erfolgt dabei zunächst ohne Berücksichtigung der Durchführbarkeit.
Phase 4: Entscheidungsphase
Die Lösungsalternativen werden auf ihre jeweiligen Konsequenzen hin beurteilt und diejenige Strategie wird ausgewählt, die für am besten geeignet gehalten wird.
Phase 5: Phase der Verifikation
Der ausgewählte Lösungsvorschlag wird in die Praxis umgesetzt und auf seine Brauchbarkeit hin überprüft.
Das Modell der kooperativen Entscheidungsfindung
Allgemeine Charakterisierung Herleitungsprinzipien Gesprächsaufbau
1. Rahmenbedingungen
- ungestörte Atmosphäre
- Sitzordnung, die keinen Teilnehmer (z.B. Gesprächsleiter) besonders heraushebt
- genügend Zeit, um in Ruhe realistische Lösungsvorschläge erarbeiten zu können
- Teilnehmerzahl:
- in zu großen Gruppen besteht die Gefahr, daß sich Untergruppen bilden; die Dauer und Intensität der Interaktionen zwischen den Teilnehmern nimmt ab
- in kleinen Gruppen muß das gesamte Meinungsspektrum vertreten sein
2. Allgemeine Informationen
- kurze und knappe Information über die wichtigsten Fakten des Gesprächsanlasses
- keine persönliche Stellungnahme inhaltlicher Art
3. Gemeinsames Anliegen
- auf gemeinsames Interesse der Teilnehmer an einer Konfliktlösung hinweisen
- Interesse des Gesprächsleiters an fairer, von allen akzeptierbarer Lösung erwähnen
- gemeinsame Festlegung von Spielregeln für das weitere Vorgehen
4. Problemanalyse und Zieldefinition
- klare Formulierung des Problems (ggf. Zerlegung in Teilprobleme) und Gegenüber- stellung der widersprüchlichen Positionen
- Ziel des jeweiligen Gesprächs exakt festlegen (ggf. gemeinsam eine Zielhierarchie er- stellen)
5. Abgrenzung des Entscheidungsspielraums
- Klärung der Kompetenzen der Gruppe und des begrenzten Handlungsspielraums (durch evtl. Rechtsrahmen, Vorschriften)
6. Entwicklung von Lösungsansätzen
- grundsätzlich erst die anderen Teilnehmer reden lassen, um eine Identifikation mit dem Problem und die Darstellung der verschiedenen Standpunkte zu ermöglichen
- alle Beiträge inhaltlich aufgreifen, um ihre Bedeutung für die Bewältigung der Prob- lemsituation zu verdeutlichen
- Gefühlsäußerungen ernst nehmen, aufgreifen und den sachlichen Inhalt verbalisieren
- möglichst alle Teilnehmer an der Diskussion beteiligen (zurückhaltende Teilnehmer zur Mitarbeit ermutigen und sehr aktive Teilnehmer bremsen)
- strikte Trennung von Meinungsäußerungen und deren Bewertung
- Zwischenergebnisse formulieren (Überblick über verschiedene Standpunkte, Vor- schläge, noch offene Fragen, Fortschritte); Diskussion durch Hinweis auf die Ziele des jeweiligen Gesprächs beim Thema halten
7. Bewertung der Lösungsalternativen und Entscheidung
- Lösungsalternative finden, die realisierbar ist und von allen Teilnehmern gleicher- maßen akzeptiert werden kann
- ggf. weitere alternative Lösungsvorschläge entwickeln und auf ihre Realisierbarkeit hin überprüfen
8. Abschluß des Gesprächs
- Zusammenfassung aller wichtigen Ergebnisse des Gesprächs; auch eine deutliche Erarbei- tung der Problemsituation ohne akzeptierbare Lösung stellt einen Erfolg dar
Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen
Übungen
Literatur:
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Modell der kooperativen Entscheidungsfindung (nach W.F. Neubauer)?
Das Modell beschreibt einen Problemlösungsprozess in Stufen, der besonders für den Schulalltag geeignet ist, wo Lehrer und Schüler sich über den Unterricht einigen müssen. Es basiert auf der Idee, dass weder Berater (z.B. Lehrer) noch Klient (z.B. Schüler) allein das Problem lösen können, sondern ein gemeinsamer Problemlösungsprozess notwendig ist.
Welche Phasen umfasst das Modell der kooperativen Entscheidungsfindung?
Das Modell besteht aus 5 Phasen:
- Allgemeine Orientierungsphase: Entwicklung eines Problembewusstseins.
- Phase der Problemdefinition und Formulierung: Konkrete Formulierung des Problems.
- Phase der Entwicklung von Alternativen: Suche nach verschiedenen Lösungswegen.
- Entscheidungsphase: Beurteilung der Lösungsalternativen und Auswahl der besten Strategie.
- Phase der Verifikation: Umsetzung und Überprüfung des ausgewählten Lösungsvorschlags in der Praxis.
Welche Rahmenbedingungen sind für ein kooperatives Entscheidungsgespräch wichtig?
Wichtige Rahmenbedingungen sind eine ungestörte Atmosphäre, eine neutrale Sitzordnung, genügend Zeit und eine angemessene Teilnehmerzahl.
Wie sollte der Gesprächsaufbau bei einer kooperativen Entscheidungsfindung aussehen?
Der Gesprächsaufbau umfasst folgende Punkte:
- Rahmenbedingungen schaffen
- Allgemeine Informationen geben
- Ein gemeinsames Anliegen formulieren
- Problemanalyse und Zieldefinition
- Entscheidungsspielraum abgrenzen
- Lösungsansätze entwickeln
- Lösungsalternativen bewerten und entscheiden
- Das Gespräch abschließen
Was sind die Aufgaben des Gesprächsleiters bei der Entwicklung von Lösungsansätzen?
Der Gesprächsleiter sollte die Teilnehmer zuerst reden lassen, ihre Beiträge aufgreifen, Gefühlsäußerungen ernst nehmen, alle Teilnehmer beteiligen, Meinungsäußerungen und Bewertungen trennen und Zwischenergebnisse formulieren.
Was ist das Ziel der Entscheidungsphase?
Das Ziel ist es, eine Lösungsalternative zu finden, die realisierbar ist und von allen Teilnehmern akzeptiert werden kann.
Was sollte bei Abschluss des Gesprächs beachtet werden?
Alle wichtigen Ergebnisse des Gesprächs sollten zusammengefasst werden. Auch wenn keine akzeptable Lösung gefunden wurde, ist die deutliche Erarbeitung der Problemsituation ein Erfolg.
Wo finde ich weiterführende Literatur zu diesem Thema?
Neubauer, W.F., Gampe, H. & Knapp, R. (1992). Konflikte in der Schule. Möglichkeiten und Grenzen kooperativer Entscheidungsfindung. Neuwied: Luchterhand.
- Arbeit zitieren
- Norbert Lindemann (Autor:in), 2000, Kommunikation und Konflikt, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99752