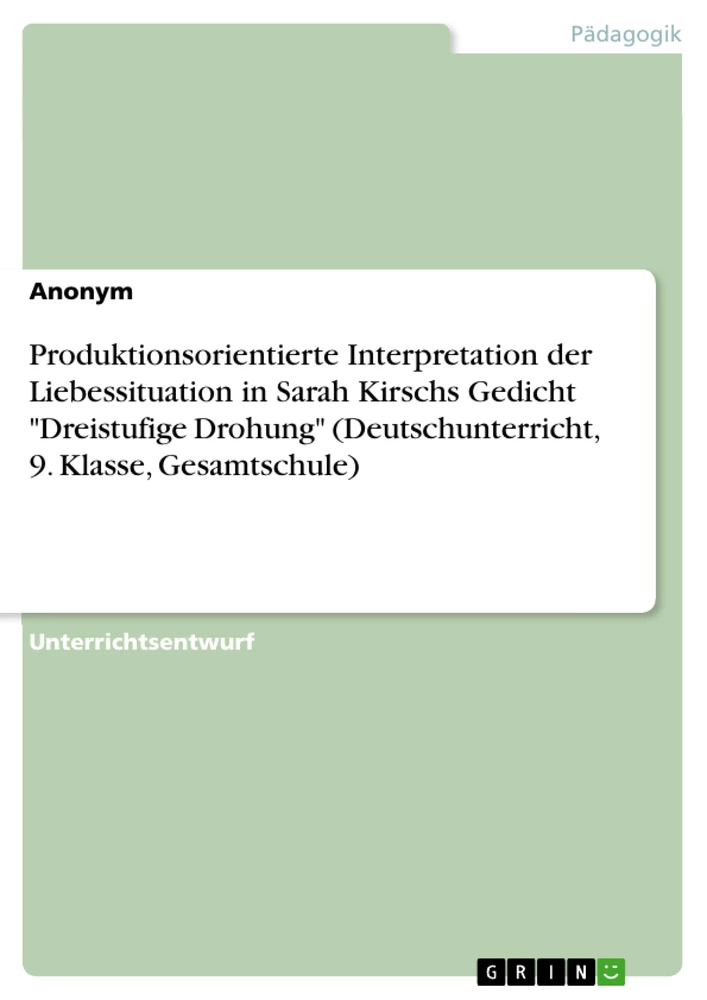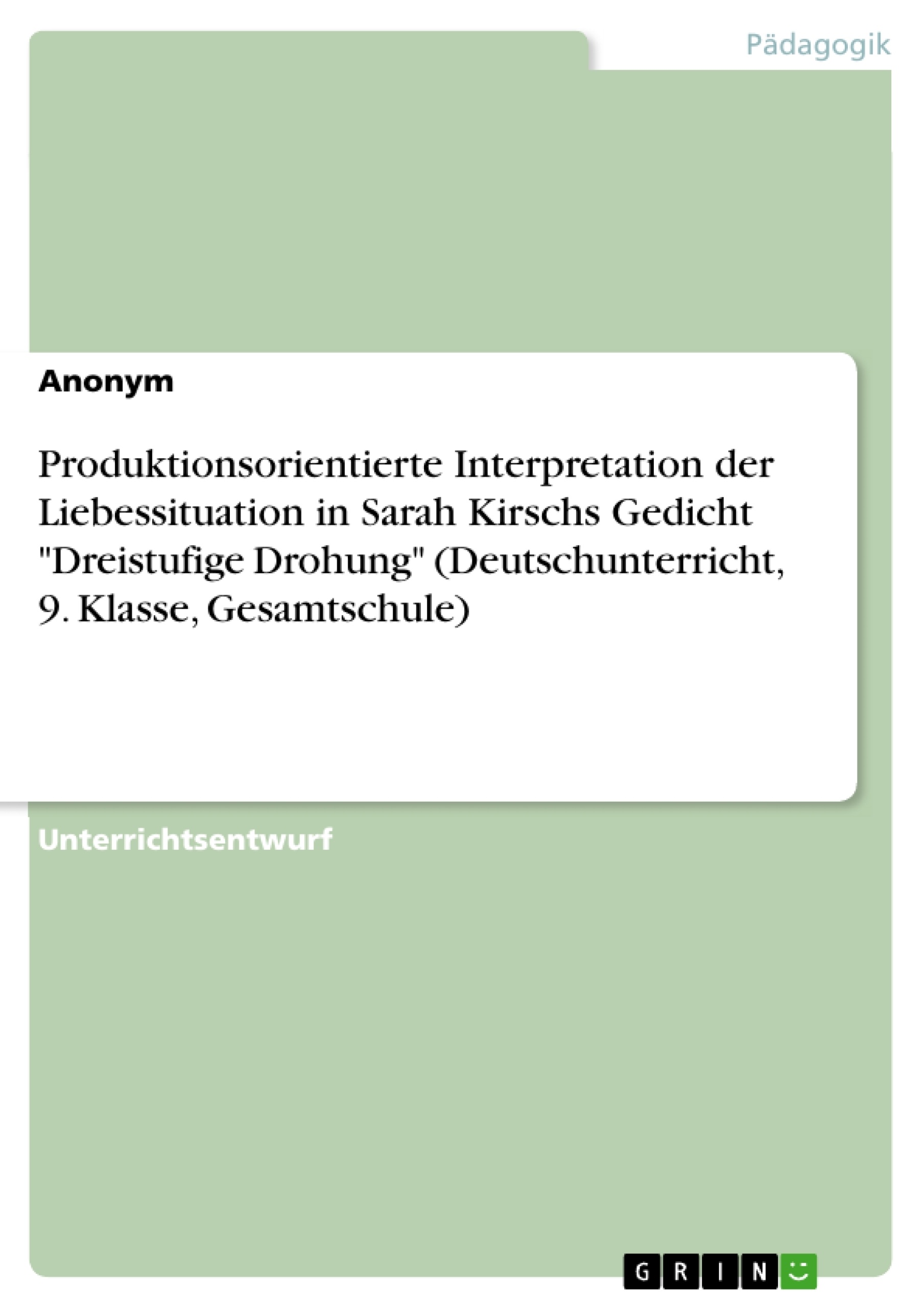Die Unterrichtseinheit beschreibt eine produktionsorientierte Interpretation der Liebessituation in Sarah Kirschs Gedicht "Dreistufige Drohung" in Partnerarbeit. Die Schülerinnen und Schüler sollen die dritte Strophe des Gedichts "Dreistufige Drohung" vor dem Hintergrund ihrer arbeitsteiligen Analyse kooperativ gestalten und mit dem Originalende vergleichen.
Dazu sollen die Schülerinnen und Schüler die Korrespondenz zwischen Form, Sprache und Inhalt im Gedicht "Dreistufige Drohung" nachvollziehen. Sie zeigen dies, indem Sie ihre Analysen präsentieren. Anschließend bereiten sie ihre eigene Produktion der letzten Strophe vor. Sie zeigen dies, indem sie mögliche Inhalte diskutieren und notieren. Sie gestalten eine eigene dritte Strophe unter Berücksichtigung der Analyse. Sie zeigen dies, indem sie diese auf einem Folienstreifen notieren und vorstellen. Abschließend identifizieren die SuS Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den eigenen Schülerprodukten und dem Originalende des Gedichts, indem sie diese diskutieren.
Inhaltsverzeichnis
- Teil I - Darstellung der längerfristigen Unterrichtszusammenhänge
- Tabellarische Auflistung der Stundenthemen innerhalb der längerfristigen Unterrichtszusammenhänge
- Ausgewählte Aspekte der längerfristigen Unterrichtszusammenhänge
- Teil II - Schriftliche Planung der Unterrichtsstunde
- Ziele und angestrebte Kompetenzen
- Didaktische Schwerpunkte
- Geplanter Verlauf des Unterrichts
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Unterrichtsentwurf beschreibt eine Unterrichtsstunde im Fach Deutsch für die 9. Klasse zum Gedicht "Dreistufige Drohung" von Sarah Kirsch. Das Ziel ist die produktionsorientierte Interpretation der Liebessituation im Gedicht durch die Schüler*innen. Dabei wird die Analyse des Gedichts als Grundlage für die kreative Gestaltung einer eigenen Gedichtstrophe genutzt.
- Analyse lyrischer Texte
- Produktionsorientierter Umgang mit Texten
- Interpretation von Liebesdarstellungen in der Lyrik
- Zusammenhang von Form, Sprache und Inhalt in Gedichten
- Kooperative Textarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Teil I - Darstellung der längerfristigen Unterrichtszusammenhänge: Dieser Teil bietet einen Überblick über den bisherigen Verlauf der Unterrichtsreihe zur Liebeslyrik. Es wird die chronologische Abfolge der behandelten Gedichte und Themen dargestellt, von klassischer Liebe über unglückliche Liebe bis hin zu freundschaftlicher Liebe. Die Tabelle zeigt die behandelten Gedichte, Kompetenzen und den Unterrichtsinhalt. Der zweite Abschnitt beschreibt den Übergang von der Ausbildungslehrerin zum Studienreferendar und die eigenverantwortliche Gestaltung des Unterrichtsverlaufs ab der Klassenarbeit. Die Wahl des modernen Gedichts "Dreistufige Drohung" wird begründet, sowie der Fokus auf die produktionsorientierte Arbeit am Ende der Reihe.
Teil II - Schriftliche Planung der Unterrichtsstunde: Dieser Teil beinhaltet die detaillierte Planung der Unterrichtsstunde zum Gedicht "Dreistufige Drohung". Die Stundenzielsetzung fokussiert auf die kooperative Gestaltung der dritten Strophe des Gedichts durch die Schüler*innen und den Vergleich mit dem Original. Teilziele konkretisieren die erwarteten Lernergebnisse, welche die Nachvollziehung der Korrespondenz zwischen Form, Sprache und Inhalt, die Vorbereitung der eigenen Produktion und die Identifizierung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen Schülerprodukten und Original umfassen. Die angestrebten Kompetenzen orientieren sich am Kernlehrplan Deutsch.
Schlüsselwörter
Liebeslyrik, Sarah Kirsch, „Dreistufige Drohung“, Gedichtanalyse, Produktionsorientierung, Kooperative Textarbeit, Form-Inhalt-Korrespondenz, sprachliche Mittel, Interpretation, Kernlehrplan, Kompetenzen.
Häufig gestellte Fragen zum Unterrichtsentwurf "Dreistufige Drohung"
Was ist der Inhalt des Unterrichtsentwurfs?
Der Unterrichtsentwurf beschreibt eine Deutschstunde der 9. Klasse zum Gedicht "Dreistufige Drohung" von Sarah Kirsch. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der produktionsorientierten Interpretation des Gedichts durch die Schüler*innen, wobei sie eine eigene Gedichtstrophe gestalten.
Welche Themen werden im Unterricht behandelt?
Der Unterricht behandelt die Analyse lyrischer Texte, den produktionsorientierten Umgang mit Texten, die Interpretation von Liebesdarstellungen in der Lyrik, den Zusammenhang von Form, Sprache und Inhalt in Gedichten und die kooperative Textarbeit. Der Entwurf gliedert sich in zwei Teile: Teil I befasst sich mit dem längerfristigen Unterrichtszusammenhang innerhalb der Reihe zur Liebeslyrik, während Teil II die detaillierte Planung der einzelnen Unterrichtsstunde zum Gedicht "Dreistufige Drohung" darstellt.
Wie ist der Unterrichtsentwurf aufgebaut?
Der Entwurf ist in zwei Teile gegliedert. Teil I gibt einen Überblick über die bisherige Unterrichtsreihe zur Liebeslyrik, inklusive einer tabellarischen Darstellung der behandelten Gedichte und Themen. Er beschreibt auch den Übergang von der Ausbildungslehrerin zum Studienreferendar und die Begründung der Wahl des Gedichts "Dreistufige Drohung". Teil II beinhaltet die detaillierte Planung der Unterrichtsstunde, inklusive Stundenzielsetzung, Teilzielen, angestrebten Kompetenzen und dem geplanten Unterrichtsverlauf. Der Fokus liegt auf der kooperativen Gestaltung der dritten Strophe des Gedichts durch die Schüler*innen.
Welche Ziele werden mit dem Unterricht verfolgt?
Das Hauptziel ist die produktionsorientierte Interpretation der Liebessituation im Gedicht "Dreistufige Drohung" durch die Schüler*innen. Die Schüler sollen die Analyse des Gedichts als Grundlage für die kreative Gestaltung einer eigenen Gedichtstrophe nutzen. Konkrete Teilziele umfassen die Nachvollziehung der Korrespondenz zwischen Form, Sprache und Inhalt, die Vorbereitung der eigenen Produktion und den Vergleich der Schülerprodukte mit dem Original.
Welche Kompetenzen sollen die Schüler erwerben?
Die angestrebten Kompetenzen orientieren sich am Kernlehrplan Deutsch und umfassen Fähigkeiten in der Gedichtanalyse, der produktionsorientierten Textarbeit, der Interpretation von Liebesdarstellungen und der kooperativen Textarbeit. Die Schüler sollen den Zusammenhang zwischen Form, Sprache und Inhalt in Gedichten verstehen und ihre eigenen Interpretationen kreativ umsetzen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Unterrichtsentwurf?
Schlüsselwörter sind: Liebeslyrik, Sarah Kirsch, „Dreistufige Drohung“, Gedichtanalyse, Produktionsorientierung, kooperative Textarbeit, Form-Inhalt-Korrespondenz, sprachliche Mittel, Interpretation, Kernlehrplan, Kompetenzen.
Wie wird der Zusammenhang zum bisherigen Unterricht hergestellt?
Teil I des Unterrichtsentwurfs stellt den Zusammenhang zum bisherigen Unterricht her, indem er den Verlauf der Unterrichtsreihe zur Liebeslyrik beschreibt. Es wird die chronologische Abfolge der behandelten Gedichte und Themen dargestellt, von klassischer Liebe über unglückliche Liebe bis hin zu freundschaftlicher Liebe. Die Tabelle zeigt die behandelten Gedichte, Kompetenzen und den Unterrichtsinhalt.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2021, Produktionsorientierte Interpretation der Liebessituation in Sarah Kirschs Gedicht "Dreistufige Drohung" (Deutschunterricht, 9. Klasse, Gesamtschule), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/997569