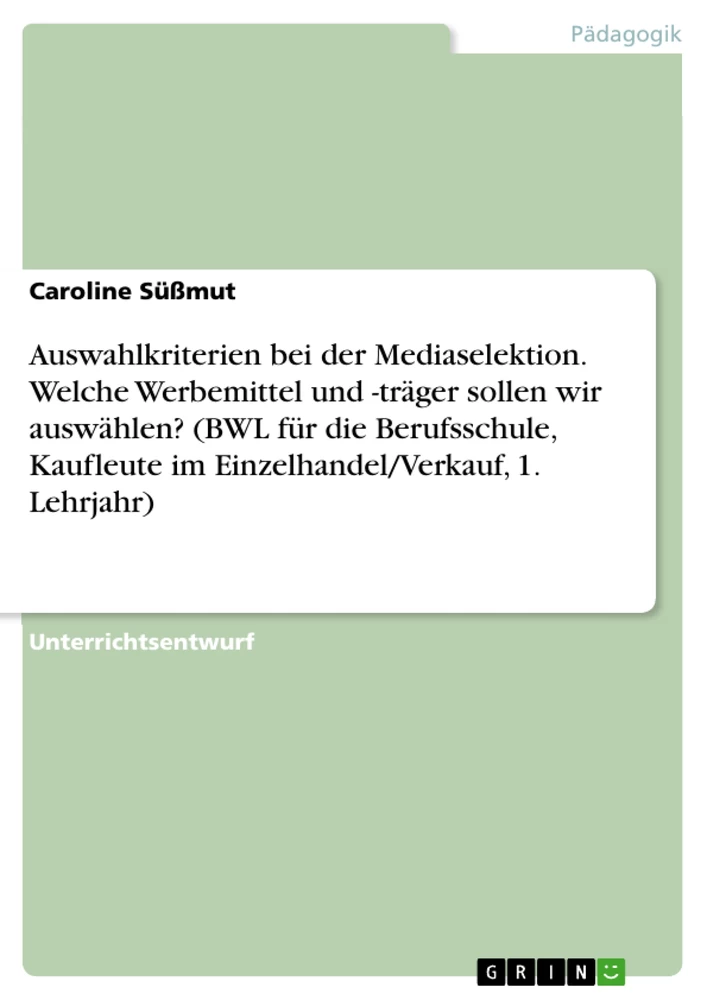Im Zentrum der Unterrichtsstunde steht die Auswahl geeigneter Werbemittel und -träger für die geplante Sportkampagne "Fußball-Weltmeisterschaft 2014". Dazu ermitteln und vergleichen die Schüler verschiedene quantitative Auswahlkriterien in arbeitsteiliger Gruppenarbeit, die als Basis für die Wahl der Werbeträger/Werbemittel dienen.
Um dem geforderten handlungsorientierten Unterricht der Berufsschule gerecht zu werden, wurde eine Lernsituation geschaffen, welche den beruflichen Kontext der Auszubildenden abbildet und auf konkretes Handeln abzielt.4 Die Lernsituation trägt die ganze Unterrichtseinheit im Lernfeld 5. Hierfür wurde auf das Modellunternehmen der Center Warenhaus GmbH aus dem Lehrbuch zurückgegriffen, welches den Schülern6 bereits aus dem Lernfeld 4 bekannt ist.
Im Fokus der Lernsituation und der geplanten Unterrichtsstunde steht die im Rahmenlehrplan geforderte Zielformulierung:7 Die Schüler erstellen einen Werbeplan. Sie entwickeln Werbemaßnahmen unter Beachtung rechtlicher, wirtschaftlicher und ethischer Grenzen der Werbung und beurteilen den Erfolg der Werbemaßnahmen. Sie skizzieren und bewerten den Einsatz von verschiedenen Maßnahmen im Verkaufsalltag zur Unterstützung der Werbung.
Inhaltsverzeichnis
- Rahmenbedingungen
- Schulische und unterrichtliche Rahmenbedingungen
- Lerngruppe und Lernvoraussetzungen
- Didaktische Entscheidungen und Entwicklung der Lernaufgabe
- Analyse des Sachverhalts und didaktische Reduktion
- Gestaltung der Lernaufgabe
- Konzeptionelle Schwerpunktsetzung
- Zielformulierung
- Kompetenzen
- Methodisch-didaktische Gestaltung der Lernhandlung
- Einstieg und Motivation
- Problemstrukturierung
- Erarbeitung
- Präsentation
- Reflexion
- Transfer/Ausstieg
- Freiräume und Besprechungsschwerpunkte
- Lernschleife
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Unterrichtsentwurf im Fach Betriebswirtschaft für Kaufleute im Einzelhandel zielt darauf ab, den Schülern die Auswahlkriterien bei der Mediaselektion für eine Werbemaßnahme näher zu bringen. Die Schüler sollen lernen, einen Werbeplan zu erstellen und dabei verschiedene Werbemittel und -träger unter Berücksichtigung rechtlicher, wirtschaftlicher und ethischer Aspekte auszuwählen und zu bewerten.
- Mediaselektion und Auswahlkriterien für Werbemittel
- Entwicklung eines Werbeplans für eine Sportkampagne
- Anwendung der AIDA-Formel in der Werbegestaltung
- Analyse von Werbemaßnahmen und deren Erfolg
- Berücksichtigung rechtlicher, wirtschaftlicher und ethischer Grenzen der Werbung
Zusammenfassung der Kapitel
Rahmenbedingungen: Dieses Kapitel beschreibt den schulischen und unterrichtlichen Kontext des Unterrichtsentwurfs. Es wird auf den Rahmenlehrplan für Kaufleute im Einzelhandel Bezug genommen und die Lernsituation, basierend auf dem Modellunternehmen Center Warenhaus GmbH, erläutert. Der Fokus liegt auf der Erstellung eines Werbeplans für eine Sportkampagne zur Fußball-Weltmeisterschaft 2014, wobei die Mediaselektion im Mittelpunkt der Unterrichtsstunde steht. Die Schüler sollen quantitative Auswahlkriterien ermitteln und vergleichen, um geeignete Werbeträger und Werbemittel auszuwählen. Die didaktische Abschnittsplanung, die den zeitlichen Rahmen und die Lernaufgaben für die gesamte Unterrichtseinheit (17 Stunden) detailliert beschreibt, wird ebenfalls vorgestellt. Die enge Verknüpfung mit dem Lehrbuch und der handlungsorientierten Methodik der Berufsschule wird hervorgehoben.
Analyse des Sachverhalts und didaktische Reduktion: (Kapitelbeschreibung fehlt im Ausgangstext, kann hier aufgrund fehlender Information nicht ergänzt werden)
Gestaltung der Lernaufgabe: (Kapitelbeschreibung fehlt im Ausgangstext, kann hier aufgrund fehlender Information nicht ergänzt werden)
Konzeptionelle Schwerpunktsetzung: Dieses Kapitel beschreibt die Zielsetzung und die methodisch-didaktische Gestaltung der Lernhandlung. Es werden die Kompetenzen der Schüler im Umgang mit Werbeplanung, Mediaselektion und der Berücksichtigung von rechtlichen, wirtschaftlichen und ethischen Aspekten der Werbung definiert. Die einzelnen Phasen der Unterrichtsstunde (Einstieg, Erarbeitung, Präsentation, Reflexion, Transfer) werden detailliert dargestellt und mit entsprechenden Methoden und Materialien verknüpft. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendung des Gelernten in Form der Entwicklung eines Werbeplans und der Auswahl geeigneter Werbemittel und -träger für die geplante Sportkampagne.
Lernschleife: (Kapitelbeschreibung fehlt im Ausgangstext, kann hier aufgrund fehlender Information nicht ergänzt werden)
Schlüsselwörter
Mediaselektion, Werbeplan, Werbemittel, Werbeträger, Werbebudget, AIDA-Formel, Marketing, Verkaufsförderung, Fußball-Weltmeisterschaft 2014, quantitative Auswahlkriterien, rechtliche, wirtschaftliche und ethische Aspekte der Werbung, Center Warenhaus GmbH, handlungsorientierter Unterricht.
Häufig gestellte Fragen zum Unterrichtsentwurf "Mediaselektion im Einzelhandel"
Was ist der Gegenstand dieses Unterrichtsentwurfs?
Dieser Unterrichtsentwurf für Kaufleute im Einzelhandel konzentriert sich auf die Mediaselektion im Rahmen der Planung einer Werbemaßnahme. Die Schüler lernen, einen Werbeplan zu erstellen und dabei verschiedene Werbemittel und -träger unter Berücksichtigung rechtlicher, wirtschaftlicher und ethischer Aspekte auszuwählen und zu bewerten. Der Entwurf bezieht sich auf eine fiktive Sportkampagne zur Fußball-Weltmeisterschaft 2014 im Kontext des Modellunternehmens Center Warenhaus GmbH.
Welche Themen werden im Unterrichtsentwurf behandelt?
Die zentralen Themen sind Mediaselektion und die dazugehörigen Auswahlkriterien, die Entwicklung eines Werbeplans, die Anwendung der AIDA-Formel, die Analyse von Werbemaßnahmen und deren Erfolg, sowie die Berücksichtigung rechtlicher, wirtschaftlicher und ethischer Aspekte der Werbung. Der Entwurf umfasst die quantitative Ermittlung und den Vergleich von Auswahlkriterien für Werbeträger und Werbemittel.
Welche Kapitel beinhaltet der Unterrichtsentwurf?
Der Entwurf gliedert sich in die Kapitel „Rahmenbedingungen“, „Analyse des Sachverhalts und didaktische Reduktion“, „Gestaltung der Lernaufgabe“, „Konzeptionelle Schwerpunktsetzung“ und „Lernschleife“. Während die Kapitel „Rahmenbedingungen“ und „Konzeptionelle Schwerpunktsetzung“ detailliert beschrieben sind, fehlen die Beschreibungen der Kapitel „Analyse des Sachverhalts und didaktische Reduktion“, „Gestaltung der Lernaufgabe“ und „Lernschleife“ im vorliegenden Text.
Wie ist der Unterrichtsentwurf strukturiert?
Der Entwurf beginnt mit einem Inhaltsverzeichnis, gefolgt von der Zielsetzung und den Themenschwerpunkten. Danach werden die einzelnen Kapitel zusammengefasst, wobei der Fokus auf den didaktischen Entscheidungen und der methodisch-didaktischen Gestaltung der Lernhandlung liegt. Schließlich werden Schlüsselwörter genannt, die den Inhalt des Entwurfs zusammenfassen.
Welche methodisch-didaktischen Aspekte werden berücksichtigt?
Der Entwurf betont einen handlungsorientierten Unterricht mit einer klaren Phasenstruktur (Einstieg, Erarbeitung, Präsentation, Reflexion, Transfer). Es werden konkrete Methoden und Materialien zur Umsetzung der Lernziele vorgeschlagen. Die enge Verknüpfung mit dem Lehrbuch und dem Rahmenlehrplan für Kaufleute im Einzelhandel wird hervorgehoben.
Welche Kompetenzen sollen die Schüler erwerben?
Die Schüler sollen Kompetenzen im Umgang mit Werbeplanung, Mediaselektion und der Berücksichtigung von rechtlichen, wirtschaftlichen und ethischen Aspekten der Werbung erwerben. Sie sollen lernen, einen Werbeplan zu entwickeln, geeignete Werbemittel und -träger auszuwählen und Werbemaßnahmen zu analysieren.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für den Unterrichtsentwurf?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Mediaselektion, Werbeplan, Werbemittel, Werbeträger, Werbebudget, AIDA-Formel, Marketing, Verkaufsförderung, Fußball-Weltmeisterschaft 2014, quantitative Auswahlkriterien, rechtliche, wirtschaftliche und ethische Aspekte der Werbung, Center Warenhaus GmbH und handlungsorientierter Unterricht.
- Quote paper
- Caroline Süßmut (Author), 2013, Auswahlkriterien bei der Mediaselektion. Welche Werbemittel und -träger sollen wir auswählen? (BWL für die Berufsschule, Kaufleute im Einzelhandel/Verkauf, 1. Lehrjahr), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/997950