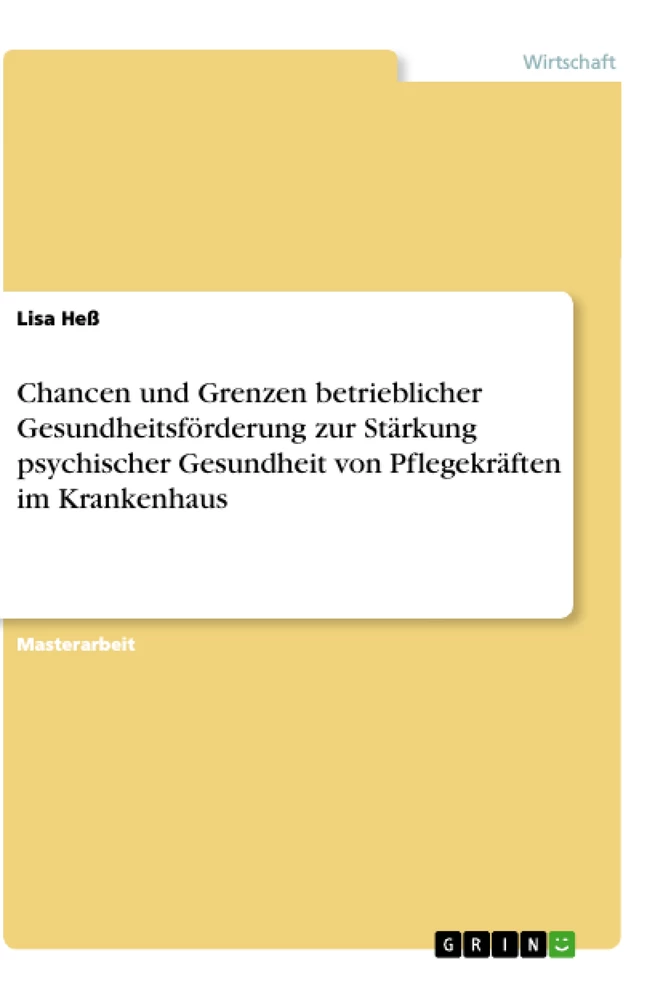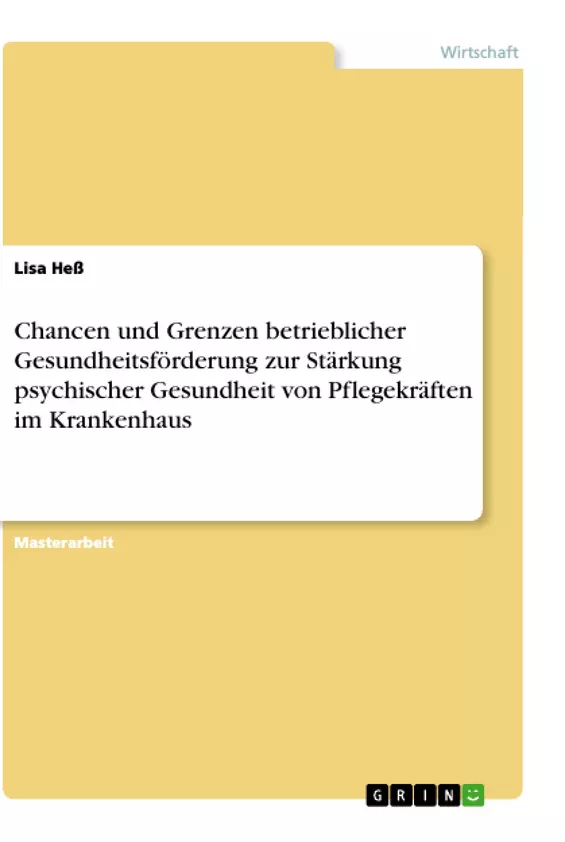Diese Arbeit soll einen Überblick über die psychosozialen Arbeitsbedingungen und die psychische Gesundheit von Pflegekräften in deutschen Krankenhäusern geben. Zusätzlich soll dargestellt werden, welche Folgen sich dadurch für das jeweilige Krankenhaus ergeben und inwieweit die Folgen durch Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung vermieden oder begrenzt werden können.
Zunächst werden hierzu theoretische Modelle erläutert, die den Zusammenhang von Areitsbedingungen und psychischer Gesundheit aufzeigen. Mit Hilfe des Modells der beruflichen Gratifikationskrisen von Siegrist (1996) werden die spezifischen Arbeitsbedingungen von Pflegekräften im Krankenhaus dargestellt, um mögliche Handlungsfelder für betriebliche Gesundheitsförderung aufzuzeigen. Nach einer Begriffsbestimmung betrieblicher Gesundheitsförderung und einer Abgrenzung zum betrieblichen Gesundheitsmanagement, wird die Evidenz zur Wirtschaftlichkeit von Interventionen zur Stärkung der psychischen Gesundheit in einer systematischen Übersichtsarbeit zusammengefasst. Auf Basis der Ergebnisse werden abschließend Handlungsempfehlungen für die Implementierung und Umsetzung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements im Krankenhaus zur Stärkung der psychischen Gesundheit von Pflegekräften und den damit verbundenen Chancen und Grenzen gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Konzepte vom Zusammenhang von Arbeit und psychischer Gesundheit
- 2.1 Theoretische Modelle vom Zusammenhang psychosozialer Belastungen und psychischer Gesundheit
- 2.1.1 Das Anforderungs-Kontroll-Modell
- 2.1.2 Modell der Gratifikationskrisen
- 2.2 Psychische Gesundheit und psychosoziale Arbeitsbedingungen von Pflegekräften im Krankenhaus
- 2.1 Theoretische Modelle vom Zusammenhang psychosozialer Belastungen und psychischer Gesundheit
- 3. Maßnahmen betrieblicher Gesundheitsförderung zur Stärkung psychischer Gesundheit
- 3.1 Begriffsbestimmung und Abgrenzung zum betrieblichen Gesundheitsmanagement
- 3.2 Betriebliche Maßnahmen zur Förderung psychischer Gesundheit
- 3.3 Betriebliche Gesundheitsförderung im Krankenhaus
- 4. Systematische Übersichtsarbeit: Forschungsstand ökonomischer Evaluation betrieblicher Gesundheitsförderungsmaßnahmen zur Stärkung psychischer Gesundheit
- 4.1 Methodik
- 4.2 Ergebnisse
- 4.2.1 Studiencharakteristika
- 4.2.2 Qualität
- 4.2.3 Ergebnisse
- 4.3 Zusammenfassung
- 5. Handlungsempfehlungen zur Implementierung und Umsetzung von betrieblicher Gesundheitsförderung zur Stärkung der psychischen Gesundheit von Pflegekräften im Krankenhaus
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Zusammenhang von Arbeit und psychischer Gesundheit von Pflegekräften im Krankenhaus und untersucht die Möglichkeiten der betrieblichen Gesundheitsförderung zur Stärkung der psychischen Gesundheit dieser Berufsgruppe. Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über die theoretischen Grundlagen, die aktuelle Forschung und die praktischen Handlungsmöglichkeiten der betrieblichen Gesundheitsförderung im Kontext der psychischen Gesundheit von Pflegekräften zu liefern.
- Theoretische Modelle des Zusammenhangs von Arbeit und psychischer Gesundheit
- Psychische Belastungen und Arbeitsbedingungen von Pflegekräften im Krankenhaus
- Konzepte und Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung
- Forschungsstand zur ökonomischen Evaluation von Gesundheitsförderungsmaßnahmen
- Handlungsempfehlungen für die Implementierung von betrieblicher Gesundheitsförderung im Krankenhaus
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Dieses Kapitel führt in die Thematik der Arbeit und psychischen Gesundheit von Pflegekräften im Krankenhaus ein und erläutert die Relevanz des Themas.
- Kapitel 2: Konzepte vom Zusammenhang von Arbeit und psychischer Gesundheit
Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene theoretische Modelle, die den Zusammenhang zwischen psychosozialen Belastungen am Arbeitsplatz und psychischer Gesundheit erklären. Es werden das Anforderungs-Kontroll-Modell und das Modell der Gratifikationskrisen vorgestellt und auf die Situation von Pflegekräften übertragen.
- Kapitel 3: Maßnahmen betrieblicher Gesundheitsförderung zur Stärkung psychischer Gesundheit
Dieses Kapitel definiert den Begriff der betrieblichen Gesundheitsförderung und grenzt ihn vom betrieblichen Gesundheitsmanagement ab. Es werden verschiedene Maßnahmen vorgestellt, die zur Förderung der psychischen Gesundheit von Arbeitnehmern eingesetzt werden können, insbesondere im Kontext von Pflegekräften im Krankenhaus.
- Kapitel 4: Systematische Übersichtsarbeit: Forschungsstand ökonomischer Evaluation betrieblicher Gesundheitsförderungsmaßnahmen zur Stärkung psychischer Gesundheit
Dieses Kapitel analysiert die aktuelle Forschung zu ökonomischen Evaluationen von betrieblichen Gesundheitsförderungsmaßnahmen, die sich auf die Stärkung der psychischen Gesundheit fokussieren. Die Methodik der Übersichtsarbeit wird erläutert und die Ergebnisse der Analyse zusammengefasst.
- Kapitel 5: Handlungsempfehlungen zur Implementierung und Umsetzung von betrieblicher Gesundheitsförderung zur Stärkung der psychischen Gesundheit von Pflegekräften im Krankenhaus
Dieses Kapitel formuliert konkrete Handlungsempfehlungen für die Implementierung und Umsetzung von betrieblicher Gesundheitsförderung zur Stärkung der psychischen Gesundheit von Pflegekräften im Krankenhaus. Es werden verschiedene Aspekte der Gestaltung und Durchführung von Gesundheitsförderungsprogrammen berücksichtigt.
Schlüsselwörter
Psychische Gesundheit, Pflegekräfte, Krankenhaus, Betriebliche Gesundheitsförderung, Arbeitsbedingungen, Psychosoziale Belastungen, Anforderungs-Kontroll-Modell, Modell der Gratifikationskrisen, Ökonomische Evaluation, Handlungsempfehlungen, Implementierung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Belastungen erleben Pflegekräfte im Krankenhaus?
Pflegekräfte sind hohen psychosozialen Belastungen ausgesetzt, die durch theoretische Modelle wie das Anforderungs-Kontroll-Modell oder das Modell der Gratifikationskrisen erklärt werden können.
Was ist der Unterschied zwischen BGF und BGM?
Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) umfasst konkrete Maßnahmen zur Gesundheitsstärkung, während Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) die strukturelle Integration in die Unternehmensführung beschreibt.
Was besagt das Modell der Gratifikationskrisen nach Siegrist?
Es beschreibt ein Ungleichgewicht zwischen hoher beruflicher Anstrengung und niedriger Belohnung (Gehalt, Wertschätzung, Sicherheit), was zu psychischen Erkrankungen führen kann.
Sind Maßnahmen zur Gesundheitsförderung wirtschaftlich?
Systematische Übersichtsarbeiten zeigen, dass ökonomische Evaluationen häufig eine positive Wirtschaftlichkeit von Interventionen zur psychischen Gesundheit belegen.
Welche Handlungsempfehlungen gibt es für Krankenhäuser?
Empfohlen wird die Implementierung eines strukturierten BGM, das gezielt auf die psychosozialen Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte eingeht.
- Citar trabajo
- Lisa Heß (Autor), 2014, Chancen und Grenzen betrieblicher Gesundheitsförderung zur Stärkung psychischer Gesundheit von Pflegekräften im Krankenhaus, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/998085