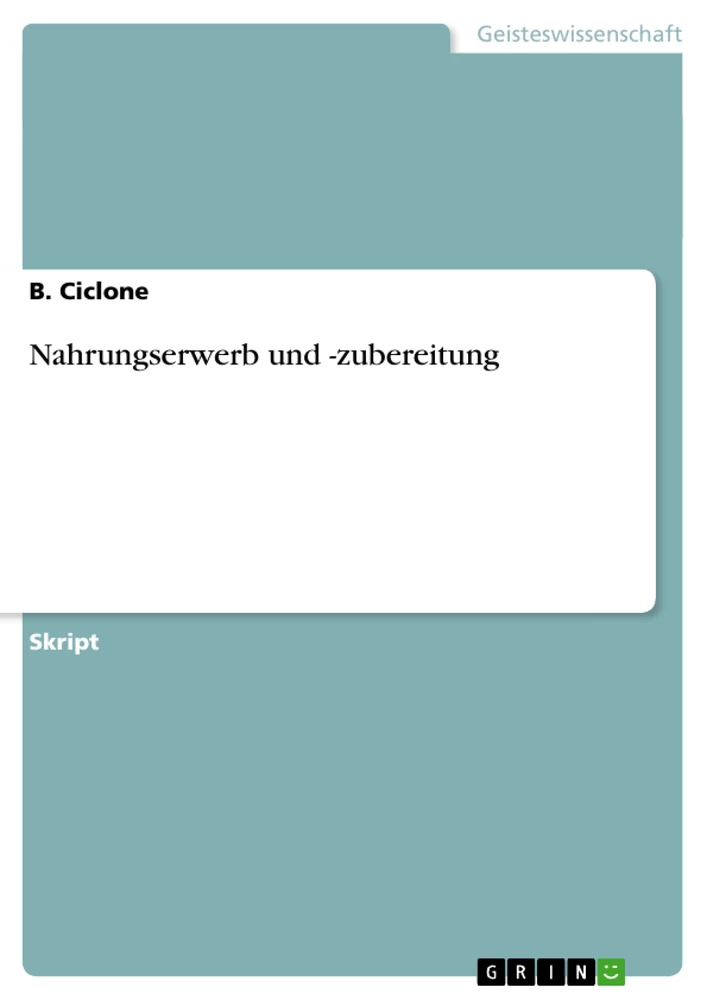Stellen Sie sich eine Welt vor, in der das Überleben von der Kunst der Anpassung an die Launen der Natur abhängt, eine Welt, in der die Verbindung zwischen Mensch und Umwelt das tägliche Leben bestimmt. Dieses Buch entführt Sie in die faszinierende Welt traditioneller Nahrungsgewinnung und -zubereitung, jenseits der Grenzen moderner Supermärkte und bequemer Kochmethoden. Wir erkunden, wie indigene Völker durch Sammeln, Jagen und Ackerbau ihren Lebensunterhalt sichern und dabei ein tiefes Verständnis für ihre jeweilige Ökozone entwickeln. Von den eisigen Weiten der Arktis, wo Inuit sich von Fleisch und Fisch ernähren und pflanzliche Nährstoffe aus Rentier-Mägen gewinnen, bis zu den tropischen Regionen, wo der Erdofen und das Garen in Bananenblättern kulinarische Meisterleistungen hervorbringen, erleben wir die Vielfalt menschlicher Einfallsreichtum. Tauchen Sie ein in die Welt der Geschmäcker, die durch kulturelle Prägung und soziale Normen geformt werden, und entdecken Sie, warum bestimmte Lebensmittel in einer Kultur als Delikatesse gelten, während sie in einer anderen abgelehnt werden. Erfahren Sie mehr über die Bedeutung von Feuer und Kochgeschirr, von einfachen Aschegruben bis hin zu ausgeklügelten Zweikammeröfen, und wie diese Technologien die Entwicklung menschlicher Gesellschaften beeinflusst haben. Begleiten Sie uns auf einer Reise, die uns zu den Wurzeln unserer Ernährung führt und uns die Bedeutung von Nachhaltigkeit, Respekt vor der Natur und der Wertschätzung kultureller Vielfalt vor Augen führt. Einblicke in traditionelle Bodenbearbeitungstechniken, von der Brandrodung bis zum Einsatz von Grabstöcken und Pflügen, offenbaren die enge Beziehung zwischen Mensch und Land. Die Untersuchung von Sitten und Gebräuchen im Zusammenhang mit der Nahrungszubereitung und -konsumation bietet einen faszinierenden Einblick in die spirituelle und soziale Bedeutung von Lebensmitteln in verschiedenen Kulturen. Entdecken Sie die Weisheit indigener Völker und lassen Sie sich inspirieren, über unsere moderne Beziehung zu Lebensmitteln nachzudenken. Dieses Buch ist eine Hommage an die menschliche Anpassungsfähigkeit, die Vielfalt kulinarischer Traditionen und die Bedeutung einer nachhaltigen Lebensweise, ein Muss für alle, die sich für Anthropologie, Ethnologie, traditionelle Kochkunst und die Bewahrung kulturellen Erbes interessieren. Eine fesselnde Reise durch die Welt der Ernährung, die den Leser dazu anregt, über die globalen Herausforderungen der Ernährungssicherheit und die Bedeutung des Respekts vor traditionellem Wissen nachzudenken. Eine tiefgründige Auseinandersetzung mit den vielfältigen Strategien des menschlichen Überlebens und der kulturellen Identität, die in der Kunst der Nahrungszubereitung und -konsumation verwurzelt sind.
Nahrungserwerb und -zubereitung
1. Nahrungserwerb und -zubereitung, Gar- und Kochmethoden
Wichtig ist das Bauerntum in Verbindung mit einer gemischten Wirtschaft, wobei der Schwerpunkt im Bodenbau liegt, welcher durch Jagd, Fallenstellen und Fischerei ergänzt wird. Dieser gemischtwirtschaftliche Ansatz ist die Voraussetzung für den Nahrungserwerb und für ihre Zubereitung
1.1. Einführung in die Aspekte
Auch im außereuropäischen Bereich gibt es eine Fülle von Nahrungsmitteln: Zerealien, Fleisch, Fisch, Milch, usw. Wichtig ist eine optimale Anpassung an die Ökozonen, bzw. Klimazonen, da die Naturvölker aus diesen nicht ausbrechen können. Durch diesen aktiven Anpassungsprozeß, welcher Kreativität voraussetzt, wird das Überleben gesichert, bzw. ein guter Standart gewährleistet. Das Zusammenspiel zwischen Mensch und Umwelt ist ein wichtiger Faktor bei der Anpassung auf die Lebensgestaltung.
Die Voraussetzung für das Garen und Kochen ist das Feuer; wichtige Faktoren, die den Speisezettel der sogenannten Naturvölker bestimmen sind die Wirtschaftsform und die Umwelt.
Beispiele für Nahrung:
Inuit: Fleisch und Fisch; pflanzliche Nahrung wird in Form von verdauten Produkten aus Rentiermägen gewonnen
Afrikanische Viezüchter: viele Milchprodukte (Surplus), wenig Fleisch; das Vieh wird eher als Tauschobjekt für Zerealien verwendet
Indien: Vegetarier; alle Berufsgruppen, welche sich mit Tieren, bzw. deren Schlachtung beschäftigen, sind Out-Kasten
Vorderasien: Milchprodukte
Wichtig bei der Ernährund ist der Geschmack. Dieser ist verschieden ausgeprägt und stellt eine qualitative Wertigkeit dar, d.h. er ist subjektiv und kulturdeterminiert. Er stellt einen Lernprozeß dar, in welchem jedes Kind durch Inkulturation über die Eßgewohnheiten seiner Gesellschaft oder Gruppe unterrichtet wird. Normen und Werte spielen im Rahmen dieser Überlegung eine wesentliche Rolle.
Chinesen essen z.B. keinen Käse, da dieser aus vergorener Milch besteht; dafür gelten vergorene Eier, als Delikatesse. Die Gärung wird durch Vergraben herbeigeführt.
Wichtige Aspekte der Nahrungsbeschaffung sind das Sammeln und Züchten. Bodenbauern züchten, d.h. sie bauen an, und produzieren somit meist Zerealien und Knollenfrüchte (bei uns z.B. Kartoffeln, im tropischen Bereich Maniok). Im gemischtwirtschaftlichen Bereich ist die Klein- und Großtierhaltung vorrangig. Kleintiere (z.B. Hühner) spielen nicht nur als Nahrungsmittel eine große Rolle, sondern auch bei Opferritualen oder Orakeln. Auch diese Opfertiere werden meistens nach der Zeremonie bei einem gemeinsamen Mahl verspeist.
Als Großtiere bezeichnen wir: Kuh, Kamel, Pferd, Esel, u.ä.
Das Sammeln bezieht sich auf nicht selbst Produziertes, z.B. Gräser, Pilze, Früchte... In der Nahrungsmittelbeschaffung spielt auch der Bereich des Wildes eine wichtige Rolle. Das Fangen und Jagen des Wildes ist der aktive Bereich und das Erlegen durch Fallen der passive.
1.2. Gar- und Kochmethoden
Sie setzen sehr viel Wissen und technologisches Können voraus, z.B. Holzverarbeitung, Keramikproduktion, Bambusbearbeitung, Flechten, Metallurgie...
Im Paläolithikum wurde nur direkt in der Asche oder im Feuer gekocht, aber ab der sogenannten ,,neolithischen Revolution" beginnt jedoch die Keramikproduktion und einhergehend entwickelten sich somit neue und höherstehende Gar- und Kochmethoden.
Jene, die danach immer noch rohes Fleisch aßen, wurden mit Schimpfworten bedacht, z.B.: Eskimo bedeutet ,,Rohfleischfresser", stammt von den nordamerikanischen Indianern gegeben, die das Wort im Sinne eines Schimpfwort verwendeten Inuit bedeutet so viel wie ,,wir Menschen" und wird von den Eingeborenen selbst gebraucht. Dies nennen wir ein ethnozentrisches Weltbild.
1.2.1. Rösten in Glut und Asche (garen)
Gemüse, Fleisch, o.ä. wird in Asche gelegt und gegart, der verkohlte äußere Teil wird abgeschabt und der innere Teil verzehrt
1.2.2. Braten am Spieß
Die Nahrung wird auf einen Spieß gesteckt und ins Feuer gehalten
1.2.3. Garen in Folie
Die Nahrung wird in Blätter (v.a. eignen sich Bananenblätter) gewickelt und in der Glut erwärmt. Diese Methode ist besonders in den Tropen verbreitet. Indem man die Blätter mit Öl bestreicht, kann man hier eine Verbesserung erreichen.
1.2.4. Erdofen
Eine 1,5 bis 2 Meter tiefe Grube wird ausgehoben und darin wird ein Feuer mit Holz entfacht. Darauf werden normale oder Lavasteine gelegt, wobei diese mit feuchten Bananenbaumstrunken als Filter abgedeckt werden. Darauf wird das Gargut gelegt, mit Blättern abgedeckt und zum Schluß wird alles mit Erde abgeschlossen. Nun wird der Erdofen etwa 1,4 - 2 Stunden luftdicht ,,still gehalten" und anschließend geöffnet. Diese Art von Ofen kommt v.a. in Ozeanien vor, aber auch bei den Nordwest-Indianern und in Afrika.
1.2.5. Kochkiste
1.2.5.1. autochtoner Bereich: eine alte Öltonne wird wie ein Erdofen verwendet, jedoch mit einem zugebundenen Sack, anstelle eines Erdloches
1.2.5.2. Europa: nicht zum Garen, sondern als Warmhaltevorrichtung; etwa eine Art ,,Thermosystem"
1.2.6. Kochen in Bambusgefäßen
Dazu verwendet man ein Bambusrohr, ein silikathaltiges Gras, welches einen großen Hohlkörper besitzt und schlecht brennt. Man bindet es oben zu und stellt es in Feuer, es kann mehrmals verwendet werden.
In Indonesien wird es zugestöpselt und mit einem Ventil versehen, funktioniert somit nach dem Prinzip des Druckkochtopfes und eignet sich sowohl für flüssige als auch für feste Speisen.
1.2.7. Kochen mit heißen Steinen
Steine werden im Feuer heiß gemacht, mit einer Schlinge herausgeholt, mit einem Wedel von der Asche gesäubert und in einen ledernen oder hölzernen Behälter geworfen, welcher mit sowohl flüssiger als auch fester Nahrung gefüllt sein kann. Hier finden wir das Prinzip des Tauchsieders. Voraussetzung für diese Methode ist jedoch das Vorhandensein von Gefäßen und sie wird vor allem von mobilen Gruppen angewandt.
1.2.8. Kochen auf drei Steinen
Dies ist sicherer als das Kochen mit vier oder mehreren Steinen, das diese instabiler sind. Auch hier benötigt man feuerbeständiges Geschirr aus Metall oder Keramik.
1.2.9. Kochen mit Öfen
1.2.9.1. Coalpot
Er wurde durch Afrikaner aus dem Maghreb in die Neue Welt gebracht und besteht aus Keramik oder heute teilweise aus Metall. In der Karibik ist er jedoch inzwischen im Aussterben begriffen; dies steht mit dem Arbeitsverlust der Töpferinnen in Verbindung, daher spezialisieren sich diese auf kleine Coalpots in Form von Souvenirware, in etwa als Aschenbecher, o.ä. Jedoch in Afrika ist er noch sehr weit verbreitet. Er besteht aus einem Tonstumpf, der unten einen Kammer hat, in welche die Asche fällt, während sich oben, getrennt durch einen Lochrost, die Holzkohle befindet. Diese Holzkohlen-Kammer hat vorne einige Löcher, die eine Luftzufuhr ermögliche.
1.2.9.2. Einkammerofen
Er ist im außereuropäischen Bereich weit verbreitet, vor allem bei den Fladen- Essern. Es ist ein Backofen mit nur einer Kammer und heute noch bei uns in Pizzerie zu sehen. Das Hineingeben der Nahrung wird als ,,einschließen" bezeichnet. Im außereuropäischen Bereich findet man den Einkammerofen vor allem in Vorderasien.
2.2.9.3. Zweikammerofen
Er besteht aus einer Feuerungs- und einer Garkammer, das Feuer schlägt durch einen Rost nach oben, wo die Töpfe stehen. Auch beim Dörren und Räuchern wird dieser Ofen verwendet.
1.2.10. Kochplatte
Sie besteht aus einer, an den Rändern leicht nach unten gebogenen Metall- oder Keramikplatte, die auf drei Steinen liegt und etwas eingefettet wird. Danach wird in der Mitte Teig aufgeschüttet, der durch die Neigung an den Rand rinnt. Somit entstehen z.B. Fladen. Diese Methode ist im außereuropäischen Bereich weit verbreitet, vor allem dort, wo es Metall gibt (Türkei, Vorderasien, aber auch in Afrika [Sudan, Äthiopien...])
1.2.11. Ergänzungen
Wir finden hier drei Arten der Konservierung, dörren, räuchern und pökeln, welches auch als einsalzen bezeichnet wird. Geräuchert werden z.B. Fische, da diese beim Transport in heißen Regionen verderben würden (oft in Verbindung mit Einsalzen). Somit werden sie kurzfristig, d.h. für einige Wochen haltbar gemacht.
Beim Salz unterscheiden wir zwischen pflanzlichem und mineralischem Salz. In den Tropen wird pflanzliches Salz durch das Verbrennen von salzhaltigen Pflanzen gewonnen, die Asche ist somit salzig.
Mineralisches Salz wird in Afrika in Salzpfannen durch Austrocknen gewonnen oder im Salzbergwerk durch auswaschen oder auslaugen.
Salz ist sehr wichtig für den Menschen, aber auch für Tiere, da durch das Schwitzen viele Mineralien verloren gehen. In Afrika wurde damit Fernhandel betrieben; vom Norden kam das Salz, und der Süden gab dafür Gold (,,Salz für Gold" ). Dieser sogenannte Saharahandel war eine Männerdomäne, aber in Matriarchaten auch von Frauen im Nahbereich beherrscht.
Exkurs zu den Gewürzen: im außereuropäischen Bereich wird viel schärfer gegessen. Dies ist vor allem für die Darmflora wichtig (Desinfektion).
1.3. Koch- und Essgeschirre
Sie bestehen vorwiegend aus Keramik und Metall, aber auch aus Holz und Kürbissen (Kalebassen).
Holz, Kalebassen: Löffel, Quirl, Gabel, Schüsseln, u.ä. Häufig bei den Nomaden zu finden. Im außereuropäischen Bereich wird viel mit Händen gegessen und daher werden Schüsseln mit Wasser zur Reinigung der Hände gereicht, vor allem im Orient. Die Gabel hat sehr oft rituelle Verwendung.
Die Kava ist eine Schüssel, welche in Indonesien für rituellen Drogengenuß verwendet wird
Tische, Hocker: Die Tische sind meist niedrig, da man im außereuropäischen Bereich vorwiegend am Boden sitzt. Hocker dienen vor allem für ältere Menschen, aber auch als kultische Objekte, z.B. der Häuptlingstuhl, der zur Inthronisation dient.
1.4. Sitten und Gebräuche
Es gibt eine Vielzahl von Sitten und Gebräuchen, die in Verbindung mit der Nahrungszubereitung und -konsumation stehen. Die Herstellung ist z.B. mit vielen Tabus und Vorschriften belegt. Beim Huhn wird der erste Blutstropfen auf den Boden geschüttet, beim Hirsebier vor der Kosumtion ebenfalls einige Tropfen.
Es gibt auch Völker, bei denen das Ahnentier nicht erlegt werden darf oder bei denen morgens gekocht und mittags geschlechtlich getrennt gegessen wird (Polynesien).
1. Bodenbaugeräte
Unter Bodenbau versteht man die Nutzung des Bodens durch Bearbeitung, Düngung, Aussaat und Wasserregulierung für die Saat, Pflege und Ernte landwirtschaftlicher Kulturpflanzen. Bei der Bearbeitung des Bodens unterscheidet man roden, umbrechen und glätten. Als Universalgeräte sind der Grabstock und die Hacke anzusehen, der Grabstock wird meist nach dem Prinzip der Druckperkussion angewandt, beim Zerschlagen der Schollen jedoch nach dem der Schwungperkussion.
Grundsätzlich gibt es vier Kriterien zum Einsatz der Bodenbaugeräte:
- Anbaufläche (hart, weich, Hanglage, Ebene )
- Kulturpflanzen (davon hängt z.B. die Oberflächentiefe ab)
- Anbau und Erntezeit (Bodenbeschaffenheit, Klima...)
- Arbeitsteilung (z.B. geschlechtliche...)
Im Rahmen der Ergologie werden zwar die Geräte, aber nicht die Methoden des Bodenbaus erörtert. Die Ackerbaugeräte wirken zumeist mit Perkussion, eine Ausnahme wäre teilweise der Rechen.
1.1. Werkzeuge zum Roden
Axt, Beil und Haumesser sind die wichtigsten Rodungsgeräte, heute ist jedoch auch die Kettensäge weit verbreitet; In Afrika wird auch der Grabstock verwendet. Zum Einebnen, bzw. zum gleichmäßigen Verteilen der Asche nach der Brandrodung wird auch ein Rechen eingesetzt.
Brandrodung: Gerodet werden Primär- und Sekundärwald, Büsche, kleine Bäume und Sträucher werden in Brand gesteckt, größere Bäume werden vorher geschlagen. Mit der anfallenden Asche ist zugleich eine gewisse Düngung verbunden. Man kann nun 10-15 Mal anbauen, bevor der Boden erschöpft ist und eine neue Fläche gerodet werden muß. Die Brandrodung hat zwei ganz große Nachteile:
- Der Brand kann leicht außer Kontrolle geraten
- Die dünne Humusschicht wird durch Erosion (Wind und Wasser) schnell abgetragen, was in der Folge zu schweren ökologischen Konsequenzen führt. Flüsse werden schlammig, das wiederum verändert die Flora und Fauna.
Schwendbau: Dieser wird oft mit Brandrodungsfeldbau gleichgesetzt, obwohl beide technisch verschieden sind und soziale und ökologische Folgen haben. Schwenden bedeutet das Entfernen des Bewuchses über der Erde, Roden schließt die Entfernung der Wurzeln mit ein. Daher schützt das Schwenden den Boden vor Erosion und ermöglicht schnelleren Nachwuchs, macht aber wegen der Wurzeln den Einsatz des Pfluges unmöglich.
1.2. Werkzeuge zum Lockern und Umbrechen
1.2.1. Grabstock
Dieser stellt ein ,,allround" Gerät dar und beruht auf Druckperkussion, eine Ausnahme stellt hier jedoch das Zerschlagen der Scholle der, hier wird mit Schwungperkussion gearbeitet. Die Anwendung dieses Gerätes ist nicht geschlechtsbezogen. Große Grabstöcke werden von mehreren Menschen gemeinsam verwendet, um große zusammenhängende Schollen zu zerschlagen. Er wirkt als Hebel; man stößt ihn senkrecht in das Erdreich und zieht ihn in Richtung des Körpers. Die Länge liegt zwischen 1-2 Metern, in der Südsee sogar bis 4 Meter. Er kann rundum zugespitzt oder einseitig abgeschrägt sein, wird aus Holz oder Bambus hergestellt und zuweilen im Feuer gehärtet. Eine technische Verbesserung stellt eine ruderblattförmige Gestaltung des unteren Endes dar (siehe hier auch Grabscheit). In Afrika oder Südostasien sieht man oft aufgesetzte Spitzen aus Eisen.
Grabscheit: Stock mit verbreitertem Arbeitsteil, kann oben ein Griffstück haben (tellerartiger Knauf).
1.2.2. Spaten
Der Spaten hat ein deutlich abgesetztes Blatt und ist oft aus einem Stück gearbeitet. Beim voll ausgeprägten Spaten ist das Blatt jedoch angesetzt. Beim Arbeiten wird die Wirkung durch Fußdruck auf das Blatt verstärkt. Er stellt eine technische Weiterentwicklung des Grabstockes dar.
Unterschied zwischen Spaten und Schaufel:
Spaten: Blatt in einer Ebene mit dem Griff
Schaufel: Knick zwischen Griff und Blatt
Ziehspaten: von zwei oder mehreren Leuten bedient, kommt vor allem in Asien, bzw. Zentralasien vor
In Mikronesien und Melanesien gibt es einen Zeremonialspaten, der im rituellen Bereich verwendet wird.
1.2.3. Gabelspaten
Dabei handelt es sich um einen zweizinkigen Gabelspaten, bei dem die Zinken und der Stiel in einer Ebene liegen. Zu finden ist er in der Türkei, Afghanistan und China.
1.2.4. Furchenstock
Er funktioniert nach dem Prinzip der Schaufel, die Spitze kann symmetrisch oder asymmetrisch ausgebildet sein und wird von zwei Personen bedient.
1.2.5. Hacke (Erd- oder Feldhacke)
Im allgemeinen ist an einem Holzstiel ein Blatt im spitzen Winkel angesetzt; es gibt sie auch als winkelig gebogenes Holz in einfacher Form bei den Maori in Neuseeland. Das Material des Blattes kann aus Eisen, hartem Holz, Knochen, Muschelschalen oder Stein sein. Letzteres Material finden wir z.B. in der Südsee, wo traditionellerweise kein Eisen verwendet wird. Eine Sonderform ist das Kniebeil, wo das Blatt im rechten Winkel angesetzt ist, zu finden z.B. in der Südsee.
1.2.6. Pflug
Der Pflug ist ein komplexes Gerät und besteht aus mehreren Teilen. Er ist aus Keil und Hebeln zusammengesetzt und sein technisches Prinzip erfordert zwei Kraftquellen:
- Horizontale: durch Zug am Pflugbaum oder Grindel in der Arbeitsrichtung durch Mensch oder Tier
- Vertikale: durch Druck auf die Lenkstange oder Sterze
Die einfachsten Pflüge bestehen aus einem nur wenig gekrümmten Stock, der mit einem Strick gezogen wird.
Terminologie des Pfluges:
1. Sterze: auch als Lenkstange bezeichnet, über die der Bauer den Druck ausübt
2. Pflugbaum: Zugvorrichtung, sie verläuft parallel zum Erdboden und wird auch als Grindel bezeichnet
3. Pflugschar: ist vor der Sohle angebracht und dient zum Aufwühlen und Wenden des Bodens
4. Sohle: wird den Boden entlanggeschleift
5. Griessäule: tritt beim Rahmenpflug selten auf; der Begriff kommt aus dem Alt- oder Mittelhochdeutschen ,,griesen", was soviel wie zerreiben, zerstoßen oder zermalmen bedeutet.
Der einfache Grabstock kann auch als Pflug verwendet werden, indem er in der Vertikalen gedrückt und zur horizontalen gezogen wird. Man verbindet also hier den Druck und den Zuge auf die einfachste Art. Dies nennt man Schwingpflug. Das selbe gilt auch für die Erdhacke.
Werth baut hier auf dem Evolutionsgedanken auf und behauptet, daß es eine logische Verbindung von der Entwicklung des Grabstockes über die Hacke zum Pflug gibt.
Die Volkskunde unterscheidet zwischen:
Pflug: Wendepflug (legt Erde mit Scholle um)
Arl: Furchenreißer und kein Wendepflug
Es gibt folgende Arten von Pflügen:
- Schwingpflug: Grabstock als Pflug o Hackpflug: Hacke als Pflug
- Sohlpflug: Sterze und Sohle sind aus einem Stück, der Grindel ist in einem Winkel eingezapft
- Krümelpflug
- Wendepflug: der Boden wird nicht nur geritzt und aufgewühlt, sondern die Scholle wird auch gewendet
- Vierkantpflug: oder auch ,,Rahmenpflug" genannt; seine kennzeichnenden Bauteile sind Grindel, Sterze, Sohle und Griessäule
1.3. Geräte zum Ebnen und Glätten des Bodens
1.3.1. Geräte zum Zerschlagen der Scholle
1.3.1.1. Grabstock (Ozeanien)
1.3.1.2. Spaten (Afrika)
1.3.1.3. Hacke (dieselben Gebiete, aber auch Indien und Vorderasien)
1.3.1.4. spezielle keulen-, stößel- oder hammerartige Schollenbrecher, welche vereinzelt aus allen Kontinenten bekannt sind, z.B. vierzinkige Hacken in Ostasien, Holzrechen und Kratzhölzer bei den Maori in Neuseeland
2.3.2. Eggen und andere Glättbehelfe mit Deichsel oder Zugseil
2.3.2.1. Strauchwerkegge: drei- oder vierseitiger Rahmen mit Strauchwerk oder Reisig durchflochten, tritt sporadisch in allen asiatischen Hochkulturen auf.
2.3.2.2. Ackerschleppe: besteht nur aus einem mehr oder weniger breiten Brett, das Vorkommen weitgehend wie bei der Strauchwerkegge; die leiterartige Ackerschleppe ohne Zähne findet sich vom Mittelmeerraum bis Vorderindien
2.3.2.3. Rechenegge: dies ist eine einbalkige Egge mit Zähnen, die sich vom üblichen Rechen durch einen schweren Balken und kräftigeren Zähnen, vielfach aus Eisen, unterscheidet. Man findet sie vor allem in Südost- und Ostasien
2.3.2.4. Rahmenegge: diese besteht aus einem liegenden, mindestens vierbalkigen Rahmen und ist an der Unterseite mit Zähnen besetzt. Diese ostasiatische Form kommt auch, zur Gänze aus Bambus gefertigt, auf den Philippinen vor.
2.3.2.5. Feldwalze: zu finden von Kleinasien bis in den Fernen Osten und wird zum Glätten der Felder und zum Eindrücken der Saat verwendet. Kommt in Ostasien auch in Form der Stachelwalze vor. Beide Varianten werden mit der Hand gezogen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptthemen von "Nahrungserwerb und -zubereitung"?
Das Dokument behandelt den Nahrungserwerb und die Zubereitung von Speisen, insbesondere bei Naturvölkern und im Kontext verschiedener Kulturen. Es untersucht, wie Menschen ihre Nahrung beschaffen (z.B. durch Jagd, Sammeln, Ackerbau), wie sie diese zubereiten (Gar- und Kochmethoden) und welche kulturellen Sitten und Gebräuche damit verbunden sind. Auch die verwendeten Werkzeuge und Geräte werden betrachtet.
Welche Gar- und Kochmethoden werden im Text beschrieben?
Der Text beschreibt verschiedene Gar- und Kochmethoden, wie z.B. Rösten in Glut und Asche, Braten am Spieß, Garen in Folie, Erdofen, Kochkiste, Kochen in Bambusgefäßen, Kochen mit heißen Steinen, Kochen auf drei Steinen und Kochen mit Öfen (Coalpot, Einkammerofen, Zweikammerofen). Auch Kochplatten und Konservierungsmethoden wie Dörren, Räuchern und Pökeln werden erwähnt.
Welche Rolle spielt das Feuer bei der Nahrungszubereitung?
Das Feuer ist eine grundlegende Voraussetzung für das Garen und Kochen von Nahrungsmitteln. Die Wirtschaftsform und die Umwelt beeinflussen den Speisezettel der Völker. Durch Feuer können die Menschen Nahrungsmittel besser aufschließen und somit verwertbarer machen.
Wie wird die Bedeutung des Geschmacks in verschiedenen Kulturen behandelt?
Der Geschmack wird als subjektiv und kulturdeterminiert beschrieben. Er ist ein Lernprozess, in dem Kinder durch Inkulturation die Essgewohnheiten ihrer Gesellschaft erlernen. Normen und Werte spielen eine wesentliche Rolle bei der Ausbildung des Geschmacks. Das Dokument nennt Beispiele, wie unterschiedliche Kulturen bestimmte Lebensmittel bevorzugen oder ablehnen (z.B. Käse in China).
Welche Werkzeuge werden im Bodenbau verwendet?
Der Text beschreibt verschiedene Werkzeuge für den Bodenbau, darunter Axt, Beil, Haumesser, Grabstock, Spaten, Gabelspaten, Furchenstock, Hacke und Pflug. Es wird auch auf Geräte zum Ebnen und Glätten des Bodens eingegangen, wie z.B. Eggen und Feldwalzen.
Was ist Brandrodung und welche Folgen hat sie?
Brandrodung ist das Abbrennen von Primär- und Sekundärwald, Büschen, kleinen Bäumen und Sträuchern zur Gewinnung von Ackerland. Die Asche dient als Dünger. Die Brandrodung kann jedoch ökologische Konsequenzen haben, wie z.B. unkontrollierte Brände, Erosion der Humusschicht und Verschlammung von Flüssen.
Was ist der Unterschied zwischen einem Spaten und einer Schaufel?
Der Spaten hat ein Blatt in einer Ebene mit dem Griff, während die Schaufel einen Knick zwischen Griff und Blatt aufweist.
Welche Arten von Pflügen werden unterschieden?
Der Text unterscheidet zwischen Schwingpflug, Sohlpflug, Krümelpflug, Wendepflug und Vierkantpflug (Rahmenpflug).
Welche Konservierungsmethoden werden im Text erwähnt?
Der Text erwähnt Dörren, Räuchern und Pökeln (Einsalzen) als Konservierungsmethoden. Geräuchert werden z.B. Fische, um sie für den Transport in heißen Regionen haltbar zu machen.
Welche Rolle spielt Salz in der Ernährung und im Handel?
Salz ist wichtig für den Menschen und für Tiere, da durch das Schwitzen Mineralien verloren gehen. In Afrika wurde mit Salz Fernhandel betrieben; vom Norden kam das Salz, und der Süden gab dafür Gold (,,Salz für Gold").
Welche Koch- und Essgeschirre werden verwendet?
Koch- und Essgeschirre bestehen vorwiegend aus Keramik und Metall, aber auch aus Holz und Kürbissen (Kalebassen). Im außereuropäischen Bereich wird viel mit Händen gegessen und daher werden Schüsseln mit Wasser zur Reinigung der Hände gereicht.
Welche Sitten und Gebräuche sind mit der Nahrungszubereitung und -konsumation verbunden?
Es gibt eine Vielzahl von Sitten und Gebräuchen, die in Verbindung mit der Nahrungszubereitung und -konsumation stehen. Die Herstellung ist z.B. mit vielen Tabus und Vorschriften belegt. Es gibt auch Völker, bei denen das Ahnentier nicht erlegt werden darf oder bei denen morgens gekocht und mittags geschlechtlich getrennt gegessen wird.
- Citar trabajo
- B. Ciclone (Autor), 2000, Nahrungserwerb und -zubereitung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99838