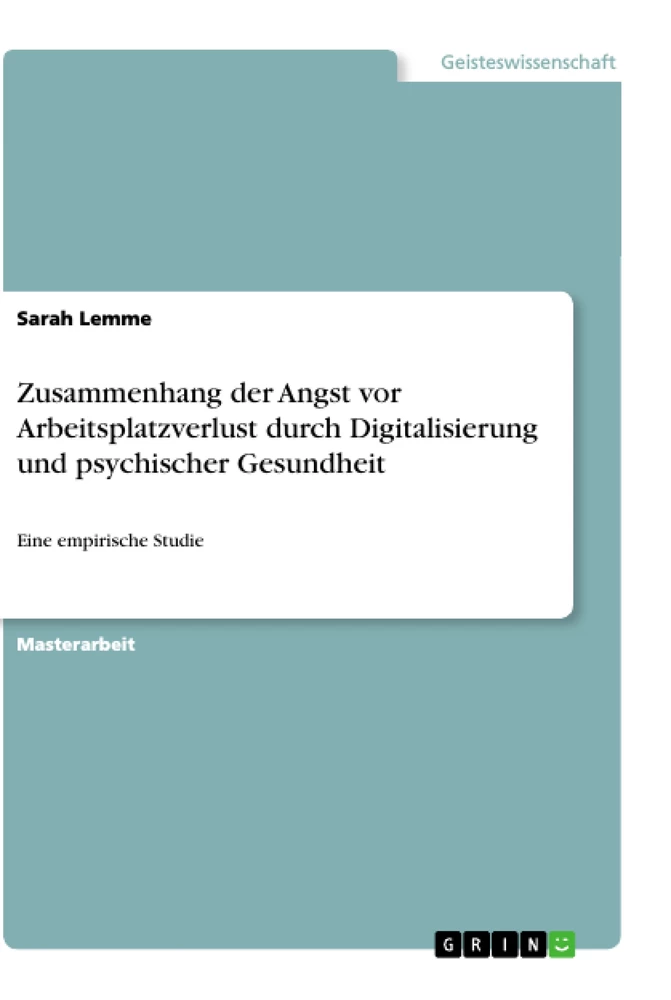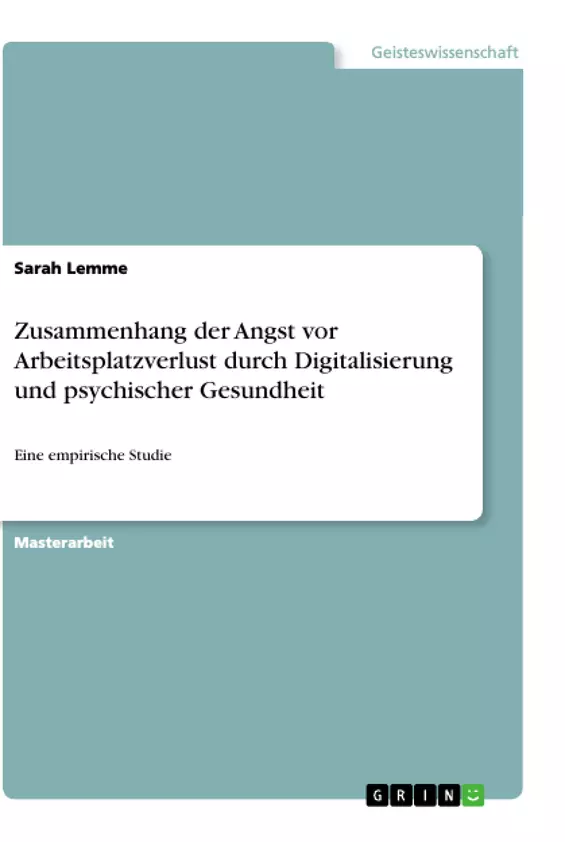Die Digitalisierung ist in den letzten Jahrzehnten einer der maßgeblichen Treiber für Veränderungen in der Arbeitswelt geworden. Kaum ein Arbeitnehmender kommt ohne Computer und Telefon aus und viele Arbeitsmöglichkeiten werden stetig unabhängiger von Ort und Zeit. Die digitale Vernetzung führt zu zunehmenden Änderungen und vor allem zu mehr Zeitdruck, beschleunigten Prozessen sowie höheren Qualifikationsanforderungen an Arbeitnehmende. Daher stellt sich die Frage, ob diese Veränderungen zu einer Angst vor Arbeitsplatzverlust durch Digitalisierung führen können und ob aufgrund der Nichtbeherrschung von digitalen Technologien Schamgefühle entstehen und die psychische Gesundheit sinkt. Diese Studie untersuchte daher, ob es einen Zusammenhang zwischen der Angst vor Arbeitsplatzverlust durch Digitalisierung und der psychischen Gesundheit, genauer gesagt emotionaler Erschöpfung und Wohlbefinden, gibt.
Weiterhin wurde untersucht, ob Scham als ein Moderator des eben genannten Zusammenhangs wirkt. An der querschnittlichen Online-Studie, welche vom 13.02.-13.03.2020 durchgeführt wurde, nahmen insgesamt 280 Probanden zwischen 19-61 Jahren (M = 34.73; SD = 10.248) teil. Die Ergebnisse zeigten einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Angst vor Arbeitsplatzverlust durch Digitalisierung und emotionaler Erschöpfung sowie Wohlbefinden. Weiterhin zeigte sich, dass auch Scham einen Zusammenhang mit diesen drei Variablen aufweist. Jedoch konnte Scham in der weiteren Analyse nicht als Moderator des Zusammenhangs zwischen Angst vor Arbeitsplatzverlust durch Digitalisierung und der psychischen Gesundheit bestätigt werden. Aufgrund der nicht repräsentativen Stichprobe müssen alle Ergebnisse vorsichtig interpretiert werden. Dennoch zeigte sich, dass Arbeitgeber die Ängste und Schamgefühle ihrer Arbeitnehmenden wahrnehmen sollten und sie bei anstehenden Veränderungen im digitalen Wandel bestmöglich unterstützen und begleiten sollten.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theorie
- 2.1 Arbeit 4.0 und Digitalisierung
- 2.1.1 Historisches zur Digitalisierung
- 2.1.2 Digitalisierung
- 2.1.3 Neuere Arbeitsformen bzw. was sich verändert
- 2.2 Psychische Gesundheit
- 2.3 Angst vor Arbeitsplatzverlust
- 2.3.1 Angst
- 2.3.2 Technostress
- 2.4 Scham
- 2.5 Hypothesen
- 3 Methode
- 3.1 Versuchsdesign
- 3.2 Messinstrumente
- 3.3 Durchführung
- 3.4 Stichprobe
- 4 Ergebnisse
- 4.1 Bereinigung des Datensatzes und Skalenbildung
- 4.2 Teststatistische Untersuchung der Items zum Thema Scham
- 4.3 Auswertung der Hypothesen 1 und 2
- 4.4 Auswertung der Hypothesen 3 und 4
- 5 Diskussion
- 5.1 Ergebnisdiskussion der Hypothesenauswertung
- 5.2 Stärken und Schwächen der vorliegenden Studie
- 5.3 Implikationen für zukünftige Forschung und den Arbeitsalltag
- 5.4 Fazit
- 6 Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen der Angst vor Arbeitsplatzverlust durch Digitalisierung und der psychischen Gesundheit von Arbeitnehmern. Sie analysiert die Auswirkungen der digitalen Transformation auf die Arbeitswelt und untersucht, ob die Angst vor Arbeitsplatzverlust durch den Einsatz neuer Technologien zu negativen Auswirkungen auf die emotionale Erschöpfung und das Wohlbefinden von Arbeitnehmern führt. Zusätzlich wird untersucht, ob Schamgefühle als ein Moderator dieses Zusammenhangs wirken.
- Digitalisierung der Arbeitswelt
- Angst vor Arbeitsplatzverlust durch Digitalisierung
- Psychische Gesundheit von Arbeitnehmern (emotionale Erschöpfung und Wohlbefinden)
- Schamgefühle in Bezug auf den Umgang mit digitalen Technologien
- Moderatorrolle von Scham im Zusammenhang zwischen Angst vor Arbeitsplatzverlust und psychischer Gesundheit
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Dieses Kapitel stellt die Relevanz des Themas dar und führt in die Thematik der Digitalisierung der Arbeitswelt und ihre möglichen Auswirkungen auf Arbeitnehmer ein. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die Digitalisierung zu Angst vor Arbeitsplatzverlust und Schamgefühlen führen kann und wie dies die psychische Gesundheit beeinflusst.
- Kapitel 2: Theorie: Dieses Kapitel bietet eine theoretische Grundlage für die Arbeit. Es werden verschiedene Konzepte wie Arbeit 4.0, Digitalisierung, psychische Gesundheit, Angst vor Arbeitsplatzverlust, Technostress und Scham erläutert.
- Kapitel 3: Methode: Dieses Kapitel beschreibt das Forschungsdesign, die verwendeten Messinstrumente, die Durchführung der Studie und die Stichprobe.
- Kapitel 4: Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten statistischen Analysen. Es werden die Zusammenhänge zwischen der Angst vor Arbeitsplatzverlust, emotionaler Erschöpfung, Wohlbefinden und Scham untersucht.
- Kapitel 5: Diskussion: Dieses Kapitel interpretiert die Ergebnisse und diskutiert deren Bedeutung. Es werden die Stärken und Schwächen der Studie sowie die Implikationen für zukünftige Forschung und den Arbeitsalltag beleuchtet.
Schlüsselwörter
Digitalisierung, Arbeit 4.0, Angst vor Arbeitsplatzverlust, psychische Gesundheit, emotionale Erschöpfung, Wohlbefinden, Scham, Technostress, Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), Online-Studie, Moderatorvariable.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst die Digitalisierung die psychische Gesundheit am Arbeitsplatz?
Die Studie zeigt, dass Angst vor Arbeitsplatzverlust durch Digitalisierung signifikant mit höherer emotionaler Erschöpfung und geringerem Wohlbefinden korreliert.
Was versteht man unter „Technostress“?
Technostress bezeichnet die psychische Belastung, die durch die Unfähigkeit entsteht, mit neuen digitalen Technologien Schritt zu halten oder deren Anforderungen zu bewältigen.
Welche Rolle spielt Scham in diesem Zusammenhang?
Schamgefühle können entstehen, wenn Arbeitnehmer glauben, digitale Technologien nicht zu beherrschen. Die Studie untersuchte Scham als potenziellen Moderator für psychische Belastungen.
Konnte Scham als Moderator bestätigt werden?
Obwohl Scham mit Angst und Gesundheit zusammenhängt, konnte sie in dieser spezifischen Analyse nicht als Moderator des Zusammenhangs zwischen Angst und psychischer Gesundheit bestätigt werden.
Was sollten Arbeitgeber tun, um ihre Mitarbeiter zu unterstützen?
Arbeitgeber sollten Ängste und Schamgefühle ernst nehmen und ihre Belegschaft durch gezielte Begleitung und Schulungen im digitalen Wandel unterstützen.
- Quote paper
- Sarah Lemme (Author), 2020, Zusammenhang der Angst vor Arbeitsplatzverlust durch Digitalisierung und psychischer Gesundheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/998570