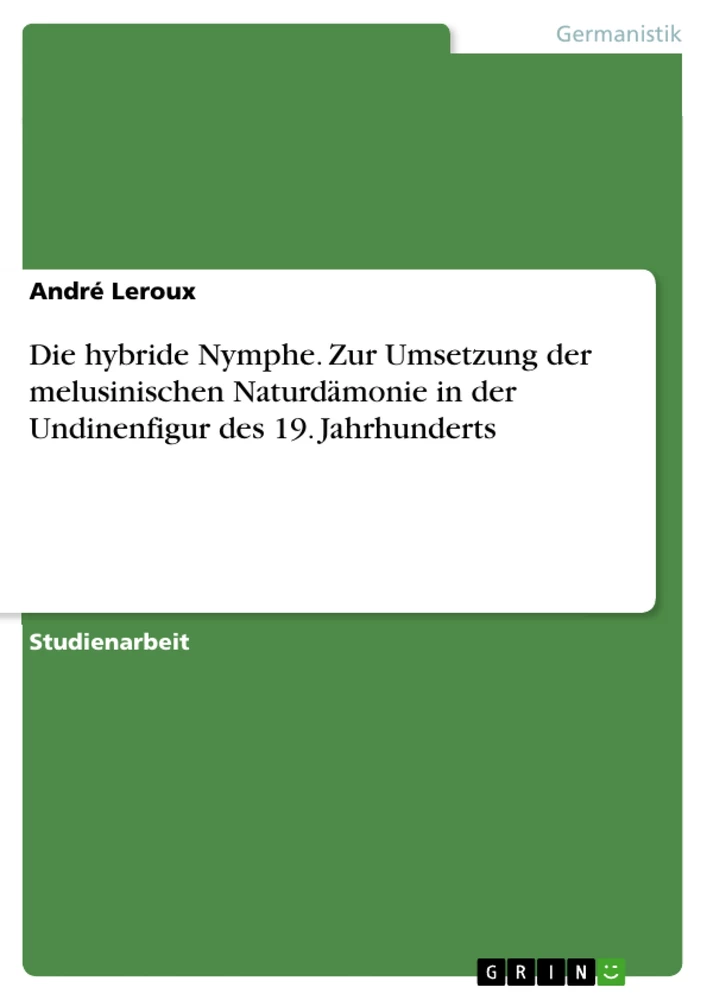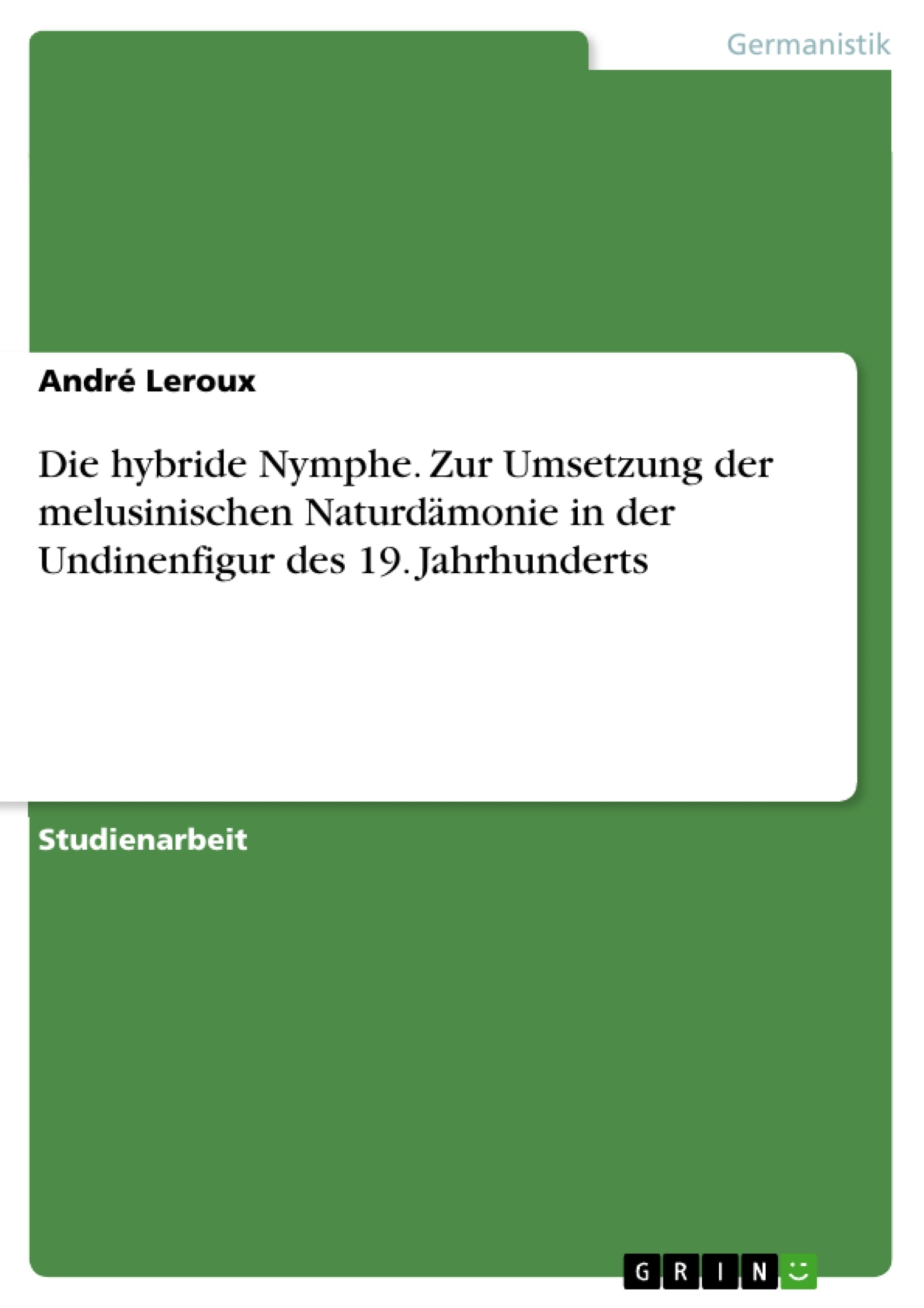Kern der Untersuchung bildet die Frage der Verortung der Undinenfigur innerhalb des Entdämonisierungsprozesses. Wohnt ihr die melusinische Naturdämonie noch inne, oder stellt sie einen davon losgelösten Neuentwurf der Wasserfrau dar?
Auf diesem Verständnis aufbauend, wird im Folgenden der Grad der Verwandtschaft der zwei Figuren Melusine als Undine zueinander einer näheren Betrachtung unterzogen. Hierbei nimmt der Aspekt der Naturdämonie (vor allem deren regressivem Wandel) eine Schlüsselrolle ein. Zunächst folgt an dieser Stelle ein motivgeschichtlicher Überblick, welcher das Argument für die Fluidität des Mythos im Allgemeinen und die Regression der Naturdämonie im Besonderen bildet. Im Anschluss wird ebenjene Regression u. a. anhand des Beispiels der undinischen Wasserfrauen in Fouqués Undine und ferner Hans Christian Andersens "Die Kleine Meerjungfrau" im Vergleich zu Thürings "Melusine" untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Fluidität der Wasserfrau: ein motivgeschichtlicher Überblick
- 3. Die Zähmung der Wasserfrau: zur Reduktion der Naturdämonie
- 4. Die Hybridisierung der Wasserfrau: zur Umsetzung der Naturdämonie
- 5. Abschlussreflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die Verwandtschaft zwischen der Figur der Melusine aus Thüring von Ringoltingens Roman Melusine und der Undinenfigur im 19. Jahrhundert, insbesondere in Friedrich de la Motte Fouqués Erzählung Undine und Hans Christian Andersens Die Kleine Meerjungfrau. Die Arbeit analysiert die Entwicklung der Naturdämonie in der Figur der Wasserfrau und untersucht, inwiefern die Undinenfigur als Neuentwurf oder als Weiterentwicklung der melusinischen Naturdämonie verstanden werden kann.
- Die Verwandtschaft zwischen Melusine und Undine als Wasserfrauenfiguren
- Der Wandel der Naturdämonie in der Wasserfrau
- Die Bedeutung der Mahrtenehe für die Charakterisierung der Wasserfrau
- Die Inszenierung des Erstauftritts der Wasserfrau in verschiedenen Texten
- Die Frage nach der Verortung der Undinenfigur innerhalb des Entdämonisierungsprozesses
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Hausarbeit ein und stellt die Fragestellung vor. Es analysiert den Erstauftritt von Melusine und Undine und zeigt die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihrer Darstellung. Das zweite Kapitel bietet einen motivgeschichtlichen Überblick über die Wasserfrau und ihren Wandel von einer Schreckensgestalt zu einer verzauberten Frau. Es wird die Regression der Naturdämonie im Verlauf der Motivgeschichte beleuchtet. Das dritte Kapitel analysiert die Reduktion der Naturdämonie in verschiedenen Texten, u.a. an Hand des Beispiels der undinischen Wasserfrauen in Fouqués Undine und Andersens Die Kleine Meerjungfrau im Vergleich zu Thürings Melusine.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit den Themen Wasserfrau, Naturdämonie, Mahrtenehe, Melusine, Undine, Hybridisierung, Entdämonisierung, Motivgeschichte, Fluidität und literarische Figurenanalyse. Sie betrachtet die Entwicklung der Wasserfrau als literarische Figur im Kontext der mittelalterlichen und modernen Literatur und untersucht die verschiedenen Aspekte, die sich auf die Darstellung der Naturdämonie auswirken.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern der Untersuchung zur Undinenfigur?
Die Arbeit untersucht, ob die Undinenfigur des 19. Jahrhunderts noch die ursprüngliche melusinische Naturdämonie besitzt oder ob sie eine entdämonisierte Neuschöpfung darstellt.
Welche literarischen Werke werden verglichen?
Verglichen werden Thüring von Ringoltingens „Melusine“, Friedrich de la Motte Fouqués „Undine“ und Hans Christian Andersens „Die Kleine Meerjungfrau“.
Was versteht man unter „Entdämonisierung“ in diesem Kontext?
Damit ist der Prozess gemeint, in dem die Wasserfrau von einer bedrohlichen, dämonischen Naturkraft zu einer eher „gezähmten“ oder romantisierten literarischen Figur wird.
Was ist eine „Mahrtenehe“?
Die Mahrtenehe ist ein literarisches Motiv, bei dem ein Mensch ein übernatürliches Wesen (wie eine Wasserfrau) heiratet, wobei die Ehe meist an das Einhalten eines bestimmten Tabus gebunden ist.
Welche Rolle spielt die Hybridisierung der Wasserfrau?
Die Arbeit analysiert die Figur als Hybridwesen zwischen Mensch und Naturdämon und wie diese Doppelnatur im 19. Jahrhundert literarisch umgesetzt wurde.
Wie wandelt sich das Motiv der Wasserfrau historisch?
Das Motiv zeigt eine hohe Fluidität: Es entwickelt sich von mittelalterlichen Schreckensgestalten hin zu komplexen Figuren der Romantik und Moderne.
- Citation du texte
- André Leroux (Auteur), 2020, Die hybride Nymphe. Zur Umsetzung der melusinischen Naturdämonie in der Undinenfigur des 19. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/998726