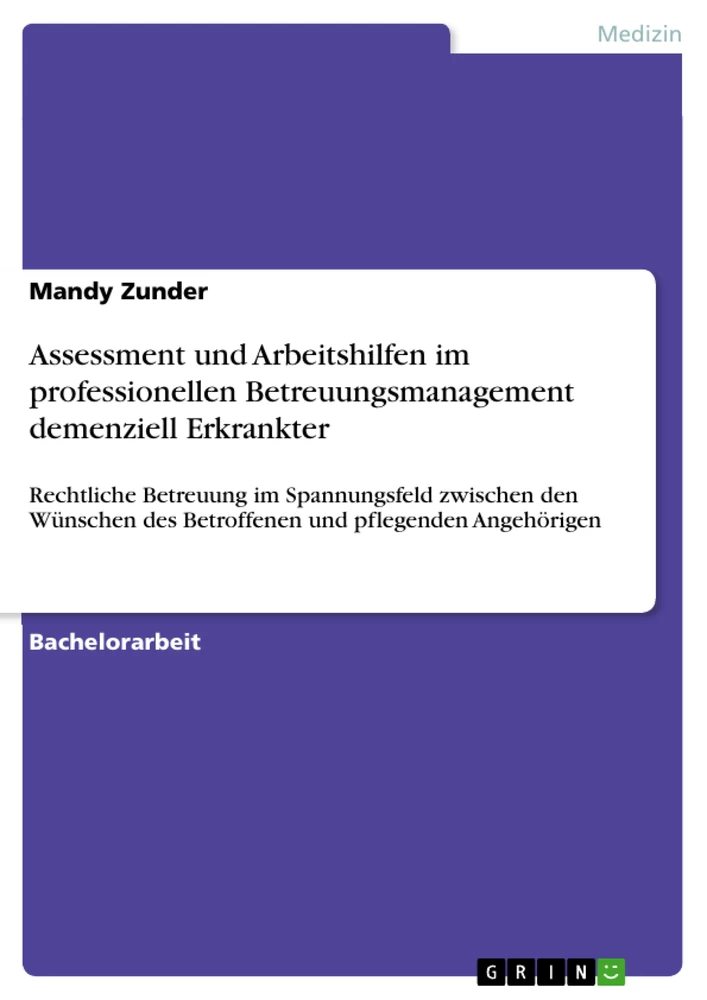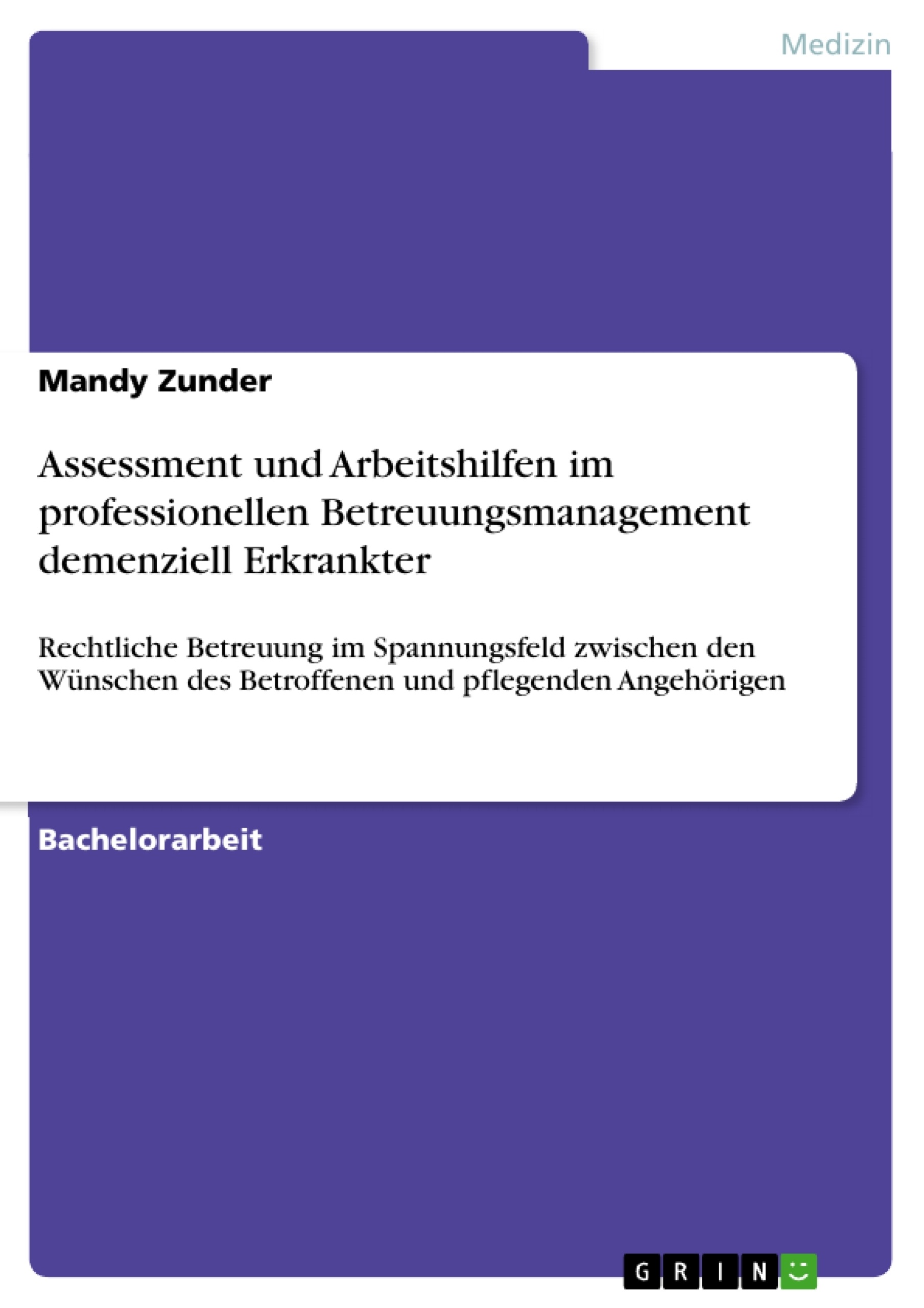Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Erstellung einer Arbeitshilfe für das Betreuungsmanagement mit demenziell erkrankten Betroffenen in Form eines Assessmentbogens, welcher die Einschätzung der Problem- und Bedarfslagen der Klienten erleichtert, strukturiert und die Grundlage der nachfolgenden Hilfeplanung darstellt. Es soll herausgearbeitet werden, was speziell bei dieser Klientel zu beachten ist und deshalb mithilfe einer solchen Arbeitshilfe erfasst werden sollte. Es wird dazu ein Blick auf die Pflege eines Demenzerkrankten geworfen und was davon abgeleitet werden kann. Außerdem sollen die Leitlinien der rechtlichen Betreuung Beachtung finden.
Die Arbeit des rechtlichen Betreuers erfordert eine gewissenhafte und professionelle Arbeitsweise. Immer das Wohl des Betroffenen im Blick gilt es, Angelegenheiten entsprechend der zugewiesenen Aufgabenkreise zu regeln, Abwägungen und Entscheidungen zu treffen. Die Betreuungsführung soll transparent und nachvollziehbar gestaltet sein. Die Planung des Unterstützungs- und Versorgungssystems für den Betroffenen soll, an dessen individuellen Bedürfnissen orientiert sein. Wichtig ist die Effizienz der eigenen Arbeit des rechtlichen Betreuers, aber auch die Effizienz und Effektivität in Bezug auf die organisierten Hilfen für den Betroffenen.
Für die Betreuungsführung gilt es fachlichen Standards gerecht zu werden, um ein professionelles Betreuungsmanagement zu gewährleisten. Hier hat sich das Case Management als Methode bewährt und wird Berufsbetreuern empfohlen, um sowohl ihre Arbeit als auch den Versorgungs- und Unterstützungsprozess wirkungsvoll und nachhaltig zu gestalten. Durch CM können Arbeitsschritte übersichtlich und plausibel dargestellt und im weiteren Verlauf gezielter geplant werden. Die Erkrankung Demenz ist durch einen fortschreitenden Prozess und einem irreversiblen Verlauf gekennzeichnet. Die Informationen, Wünsche und Bedürfnisse dieses Personenkreises lassen sich oft nicht ohne weiteres durch ein Gespräch mit dem Betroffenen einholen. Der Umfang der Betreuungsarbeit wächst zunehmend, wodurch auch die Arbeit des rechtlichen Betreuers zunimmt. Dieser kommt nicht umhin, seine Arbeitsweise dementsprechend zu gestalten. Der Fokus liegt auf dem Betroffenen mit seinen Fähigkeiten und Ressourcen und den Defiziten. Jedoch reicht dies in der Praxis des Betreuungsmanagements demenziell Erkrankter erfahrungsgemäß nicht aus. Sind die pflegenden Angehörigen maßgeblich am Erfolg der gesetzten Ziele beteiligt?
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DER BETREUUNGSVEREIN DESSAU-ROBLAU
- STADT DESSAU-ROBLAU
- VORSTELLUNG DES VEREINS
- Mitarbeiter und Arbeitsbereiche
- Betreuungszahlen
- CASE MANAGEMENT
- KONZEPT UND PROZESS
- BETREUUNGSARBEIT UND QUALITÄT
- CASE MANAGEMENT IN DER BETREUUNGSPRAXIS
- VOM CASE MANAGEMENT ZUM BETREUUNGSMANAGEMENT
- FALLSTEUERUNG
- KOMPETENZEN DES BETREUERS
- ZUSAMMENFASSUNG PRAXISARBEIT 2
- DEMENZ
- DAS KRANKHEITSBILD DEMENZ
- ZUSAMMENFASSUNG PRAXISARBEIT 1
- Inhalt der Arbeit
- Schlussfolgerung der Arbeit
- Gewonnene Erkenntnisse für die Betreuungsarbeit
- BETREUUNGSMANAGEMENT BEI BETREUTEN MIT DEMENZ
- VOM KONZEPT ZUR ANWENDUNG
- WILLE UND WOHL DES DEMENZERKRANKTEN
- BESONDERHEITEN DER FALLARBEIT
- Risiken und Gefährdungsmomente
- Kommunikation
- Die Arbeit des Betreuers
- DIE ROLLE DER ANGEHÖRIGEN
- ASSESSMENT
- ARBEITSHILFE FÜR DAS ASSESSMENT
- UNTERSCHEIDUNG NACH VERSORGUNGS- UND BESORGUNGSBEDARF
- Besorgungsbedarf
- Versorgungsbedarf
- BEDÜRFNISSE DES BETROFFENEN
- Selbstverwirklichung
- ICH-Bedürfnisse
- Soziale Bedürfnisse
- Sicherheitsbedürfnisse
- Physiologische Bedürfnisse
- EINTEILUNG UNTER ZUHILFENAHME VON PFLEGERISCHEN GESICHTSPUNKTEN
- EINTEILUNG NACH DEM VORBILD DES MDK
- EINTEILUNG NACH EMPFEHLUNGEN VON RODER
- AMPELSYSTEM
- DEFIZITE
- ZUSAMMENFASSUNG
- UNTERSCHEIDUNG NACH VERSORGUNGS- UND BESORGUNGSBEDARF
- ERSTELLUNG DES ASSESSMENTBOGENS
- Biografie
- Erkrankungen und Diagnostik
- Körperlicher Bereich
- Kognitiver Bereich
- Emotionaler Bereich
- Materielles Umfeld
- Wünsche und Bedürfnisse
- Rehabilitation
- Weitere Ressourcen und Stärken
- Einschränkungen und Risiken
- FAZIT
- AUSBLICK UND EMPFEHLUNGEN
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Bedeutung von Assessment und Arbeitshilfen im professionellen Betreuungsmanagement demenziell Erkrankter. Sie analysiert die rechtliche Betreuung im Spannungsfeld zwischen den Wünschen des Betroffenen und pflegenden Angehörigen und untersucht die Herausforderungen, die sich aus der komplexen Situation für die Betreuungsarbeit ergeben.
- Rechtliche Betreuung im Spannungsfeld zwischen Wünschen des Betroffenen und pflegenden Angehörigen
- Assessment-Instrumente und deren Bedeutung im Betreuungsmanagement
- Entwicklung und Anwendung von Arbeitshilfen für die Betreuungsarbeit mit demenziell Erkrankten
- Sicherung der Qualität und Nachhaltigkeit der Betreuungsarbeit
- Herausforderungen und Lösungsansätze für die Betreuungsarbeit in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Relevanz des Themas Betreuungsmanagement im Kontext der steigenden Anzahl demenziell erkrankter Menschen dar. Sie erläutert die Ausgangssituation und definiert die Zielsetzung der Arbeit.
- Der Betreuungsverein Dessau-Roßlau: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über den Betreuungsverein Dessau-Roßlau und seine Arbeit. Es werden die Mitarbeiter, Arbeitsbereiche und Betreuungszahlen vorgestellt.
- Case Management: Dieses Kapitel erläutert das Konzept und den Prozess des Case Managements in der Betreuungsarbeit. Es werden die Aufgaben und Ziele des Case Managements sowie die Anforderungen an die Betreuer dargestellt.
- Case Management in der Betreuungspraxis: Dieses Kapitel behandelt die praktische Anwendung des Case Managements in der Betreuungspraxis. Es werden die Herausforderungen und Möglichkeiten der Fallsteuerung, die Kompetenzen des Betreuers und die Erfahrungen aus der Praxisarbeit beleuchtet.
- Demenz: Dieses Kapitel beleuchtet das Krankheitsbild der Demenz und die damit verbundenen Herausforderungen für die Betreuungsarbeit. Es werden verschiedene Aspekte der Erkrankung, die Auswirkungen auf den Alltag des Betroffenen und die Rolle der Angehörigen erörtert.
- Betreuungsmanagement bei Betreuten mit Demenz: Dieses Kapitel setzt sich mit den Besonderheiten der Betreuungsarbeit für demenziell erkrankte Menschen auseinander. Es werden verschiedene Konzepte und Methoden des Betreuungsmanagements vorgestellt und deren Anwendung in der Praxis diskutiert.
- Assessment: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Bedeutung des Assessments in der Betreuungsarbeit. Es werden verschiedene Assessment-Instrumente und deren Einsatzmöglichkeiten vorgestellt.
- Arbeitshilfe für das Assessment: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Arbeitshilfe für das Assessment von demenziell erkrankten Menschen. Es werden verschiedene Aspekte des Assessments beleuchtet und konkrete Handlungsempfehlungen für die Praxis gegeben.
Schlüsselwörter
Betreuungsmanagement, Demenz, Assessment, Arbeitshilfe, Case Management, Rechtliche Betreuung, Angehörige, Betreuer, Bedürfnispyramide, Lebensbereiche, Fallsteuerung, Ressourcen, Stärken, Risiken, Lebensqualität.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel eines Assessments bei Demenzerkrankten?
Das Assessment dient dazu, die individuellen Problem- und Bedarfslagen strukturiert zu erfassen, um eine gezielte Hilfeplanung zu ermöglichen.
Warum wird Case Management für Berufsbetreuer empfohlen?
Case Management hilft dabei, Arbeitsschritte transparent zu gestalten und den Versorgungs- und Unterstützungsprozess effizient und nachhaltig zu steuern.
Welche Rolle spielen Angehörige im Betreuungsmanagement?
Pflegende Angehörige sind oft maßgeblich am Erfolg der Betreuungsziele beteiligt und müssen daher in den Prozess einbezogen werden.
Was muss beim Willen eines Demenzerkrankten beachtet werden?
Da Bedürfnisse oft nicht mehr verbal geäußert werden können, sind Biografiearbeit und die Ermittlung des mutmaßlichen Willens zentral für eine gewissenhafte Betreuung.
Was beinhaltet der in der Arbeit entwickelte Assessmentbogen?
Er erfasst Bereiche wie Biografie, kognitive und emotionale Fähigkeiten, das materielle Umfeld sowie spezifische Risiken und Ressourcen des Betroffenen.
- Quote paper
- Mandy Zunder (Author), 2020, Assessment und Arbeitshilfen im professionellen Betreuungsmanagement demenziell Erkrankter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/999056