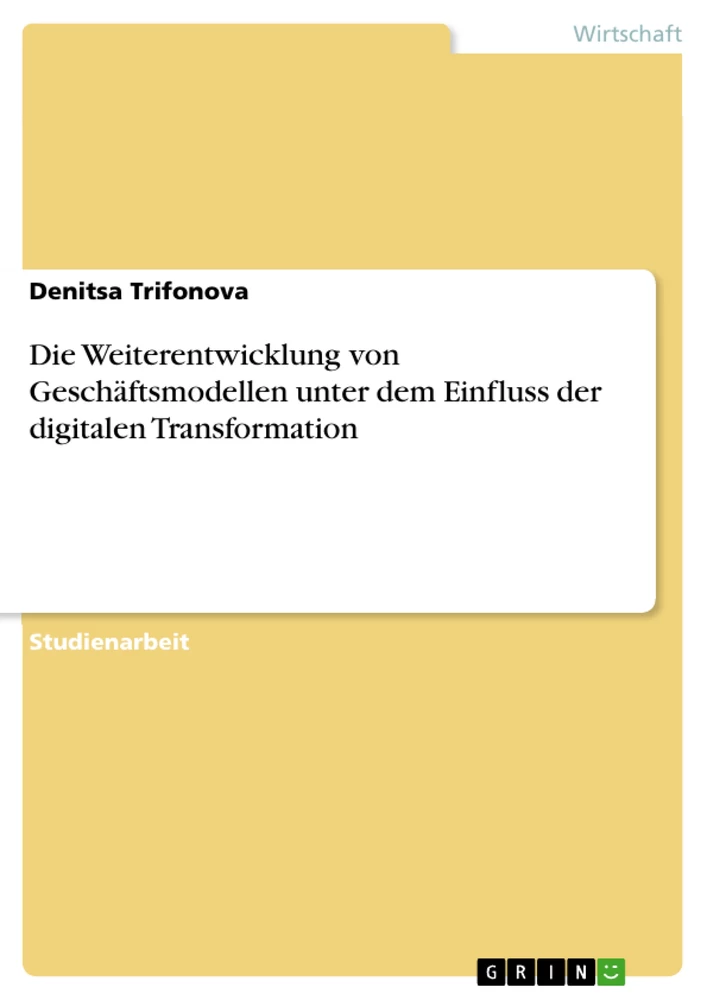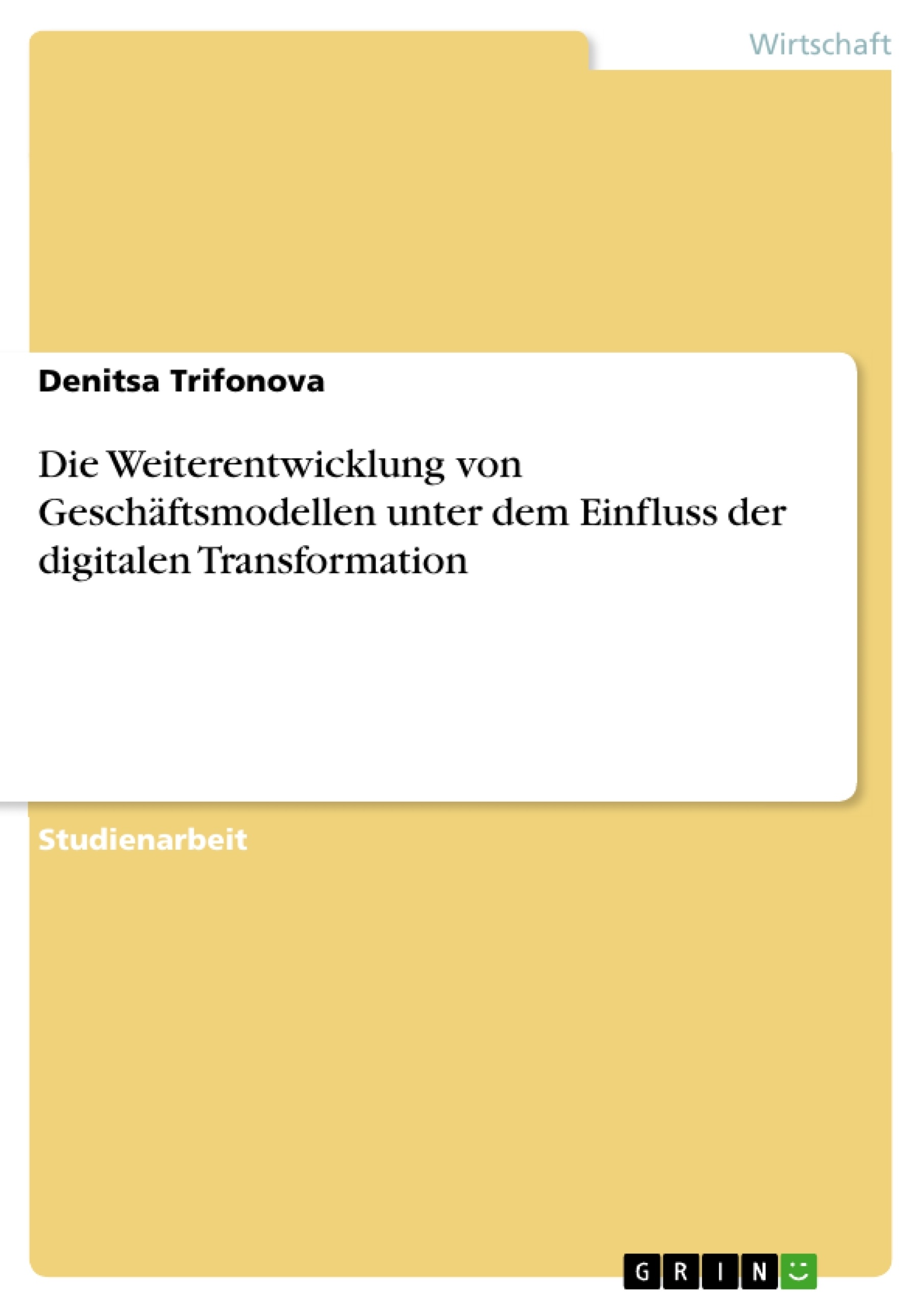Ziel dieses Assignments ist es, geeignete Geschäftsmodelle (GM) vorzustellen, die eine erfolgreiche Geschäftsmodellinnovation (GMI) ermöglichen. Die Modelle werden ausführlich erklärt und miteinander verglichen. Anhand einer fiktiven Fallstudie wird die GMI konzipiert. Da die Führungskraft, eine wichtige Rolle in der digitalen Transformation einnimmt, wird diese erklärt und beurteilt.
Um die Ziele dieser Arbeit zu erreichen, erfolgt in Kapitel 2 eine Erläuterung der Begriffe Digitalisierung und digitale Transformation, Geschäftsmodell und Innovation. Im anschließenden Kapitel werden Geschäftsmodelle dargestellt, verglichen und im Kapitel 5 anhand einer fiktiven Fallstudie angewendet. Außerdem wird die Rolle der Führungskraft im Rahmen der digitalen Transformation in Kapitel 4 vorgestellt. Zusammenfassung und Reflexion runden die Arbeit im letzten Abschnitt ab.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen
- 2.1 Digitalisierung und digitale Transformation
- 2.2 Geschäftsmodell
- 2.3 Innovation
- 3. Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen
- 3.1 Business Model Canvas
- 3.2 St. Galler Business Model Navigator
- 3.3 Modellanalyse
- 4. Die Rolle der Führungskraft in der Digitalen Transformation
- 5. Fallstudie
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht geeignete Geschäftsmodelle, die eine erfolgreiche Geschäftsmodellinnovation ermöglichen. Sie erklärt und vergleicht verschiedene Modelle und wendet diese anhand einer fiktiven Fallstudie an. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Rolle der Führungskraft in der digitalen Transformation.
- Digitalisierung und digitale Transformation
- Geschäftsmodellinnovation
- Analyse verschiedener Geschäftsmodelle (Business Model Canvas, St. Galler Business Model Navigator)
- Die Bedeutung der Führungskraft im digitalen Wandel
- Anwendung der Modelle in einer Fallstudie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die nachhaltige Wirkung der digitalen Transformation auf Wirtschaft und Gesellschaft. Sie hebt die Notwendigkeit hervor, digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln oder bestehende zu erweitern, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Arbeit fokussiert auf die Herausforderungen der Geschäftsmodellinnovation und die zentrale Rolle der Führungskraft bei deren Umsetzung. Das Ziel ist die Vorstellung und den Vergleich geeigneter Geschäftsmodelle, angewendet in einer Fallstudie.
2. Grundlagen: Dieses Kapitel legt die Grundlagen für das Verständnis der Arbeit, indem es die Begriffe Digitalisierung, digitale Transformation, Geschäftsmodell und Innovation erläutert. Es differenziert zwischen Digitalisierung als technologischer Prozess und digitaler Transformation als umfassender gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Wandel. Die verschiedenen Definitionen des Begriffs „Geschäftsmodell“ werden diskutiert, und der Zusammenhang zwischen diesen Begriffen wird hergestellt, um ein gemeinsames Verständnis für die folgenden Kapitel zu schaffen.
3. Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen: Dieses Kapitel präsentiert und vergleicht verschiedene Modelle zur Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen, insbesondere den Business Model Canvas und den St. Galler Business Model Navigator. Es analysiert die Stärken und Schwächen der jeweiligen Modelle und zeigt auf, wie sie zur Gestaltung und Innovation von Geschäftsmodellen beitragen können. Der Fokus liegt auf der Anwendung dieser Methoden zur erfolgreichen Geschäftsmodellinnovation.
4. Die Rolle der Führungskraft in der Digitalen Transformation: Dieses Kapitel befasst sich mit der entscheidenden Rolle der Führungskraft bei der digitalen Transformation und der Geschäftsmodellinnovation. Es analysiert die Herausforderungen und Aufgaben von Führungskräften in diesem Kontext und beleuchtet, wie sie digitale Geschäftsmodelle etablieren und kontinuierlich weiterentwickeln können, während sie gleichzeitig Mitarbeiter und sich selbst unter veränderten Rahmenbedingungen führen müssen. Der Beitrag der Führungskraft zum Erfolg der GMI steht im Zentrum.
Schlüsselwörter
Digitale Transformation, Geschäftsmodellinnovation (GMI), Geschäftsmodell (GM), Business Model Canvas (BMC), St. Galler Business Model Navigator (BMN), digitale Führung, Innovation, Wettbewerbsfähigkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Geschäftsmodellinnovation in der Digitalen Transformation"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über das Thema Geschäftsmodellinnovation in der digitalen Transformation. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse und dem Vergleich verschiedener Geschäftsmodelle, insbesondere des Business Model Canvas und des St. Galler Business Model Navigators, sowie auf der Rolle der Führungskraft im digitalen Wandel.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Grundlagen (Digitalisierung, digitale Transformation, Geschäftsmodell, Innovation), Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen (Business Model Canvas, St. Galler Business Model Navigator, Modellanalyse), Die Rolle der Führungskraft in der Digitalen Transformation, Fallstudie und Fazit.
Welche Geschäftsmodelle werden behandelt?
Das Dokument behandelt insbesondere den Business Model Canvas (BMC) und den St. Galler Business Model Navigator (BMN). Es vergleicht diese Modelle hinsichtlich ihrer Stärken und Schwächen und zeigt deren Anwendung zur Gestaltung und Innovation von Geschäftsmodellen.
Welche Rolle spielt die Führungskraft?
Die Rolle der Führungskraft in der digitalen Transformation und der Geschäftsmodellinnovation wird als entscheidend betrachtet. Das Dokument analysiert die Herausforderungen und Aufgaben von Führungskräften in diesem Kontext und beleuchtet, wie sie digitale Geschäftsmodelle etablieren und weiterentwickeln können, während sie Mitarbeiter und sich selbst unter veränderten Rahmenbedingungen führen.
Gibt es eine Fallstudie?
Ja, das Dokument enthält eine Fallstudie, die die Anwendung der vorgestellten Geschäftsmodelle in der Praxis veranschaulicht.
Was sind die Schlüsselwörter des Dokuments?
Die Schlüsselwörter des Dokuments sind: Digitale Transformation, Geschäftsmodellinnovation (GMI), Geschäftsmodell (GM), Business Model Canvas (BMC), St. Galler Business Model Navigator (BMN), digitale Führung, Innovation, Wettbewerbsfähigkeit.
Was ist die Zielsetzung des Dokuments?
Die Zielsetzung des Dokuments ist die Untersuchung geeigneter Geschäftsmodelle, die eine erfolgreiche Geschäftsmodellinnovation ermöglichen. Es erklärt und vergleicht verschiedene Modelle und wendet diese anhand einer fiktiven Fallstudie an. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Rolle der Führungskraft in der digitalen Transformation.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Im Detail werden folgende Themen behandelt: Digitalisierung und digitale Transformation, Geschäftsmodellinnovation, Analyse verschiedener Geschäftsmodelle (Business Model Canvas, St. Galler Business Model Navigator), die Bedeutung der Führungskraft im digitalen Wandel und die Anwendung der Modelle in einer Fallstudie.
- Quote paper
- Denitsa Trifonova (Author), 2021, Die Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen unter dem Einfluss der digitalen Transformation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/999586