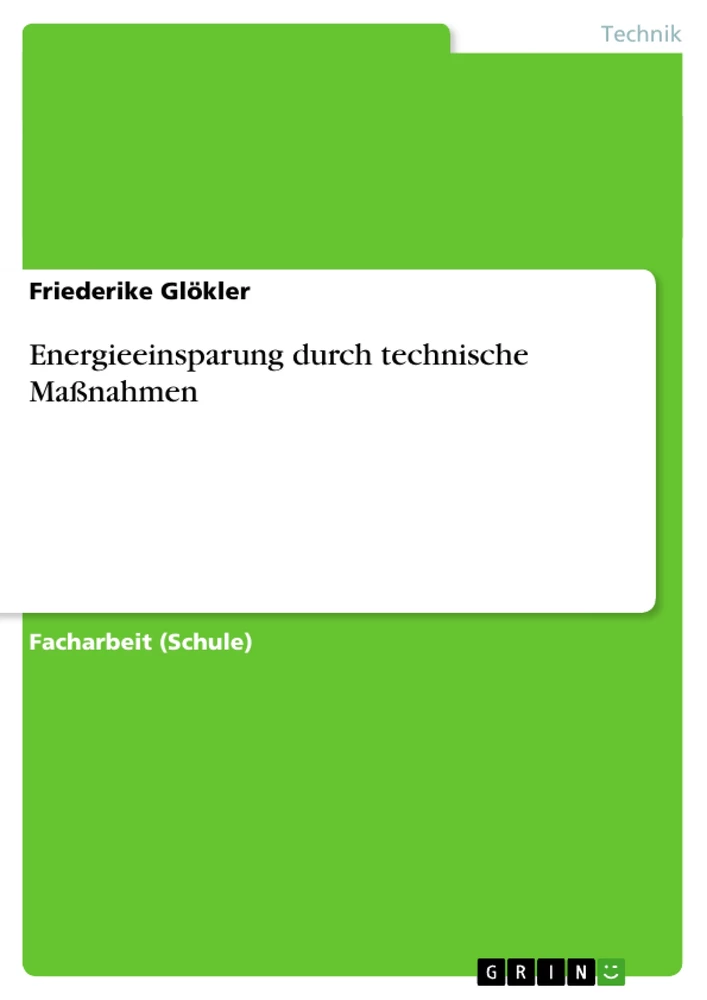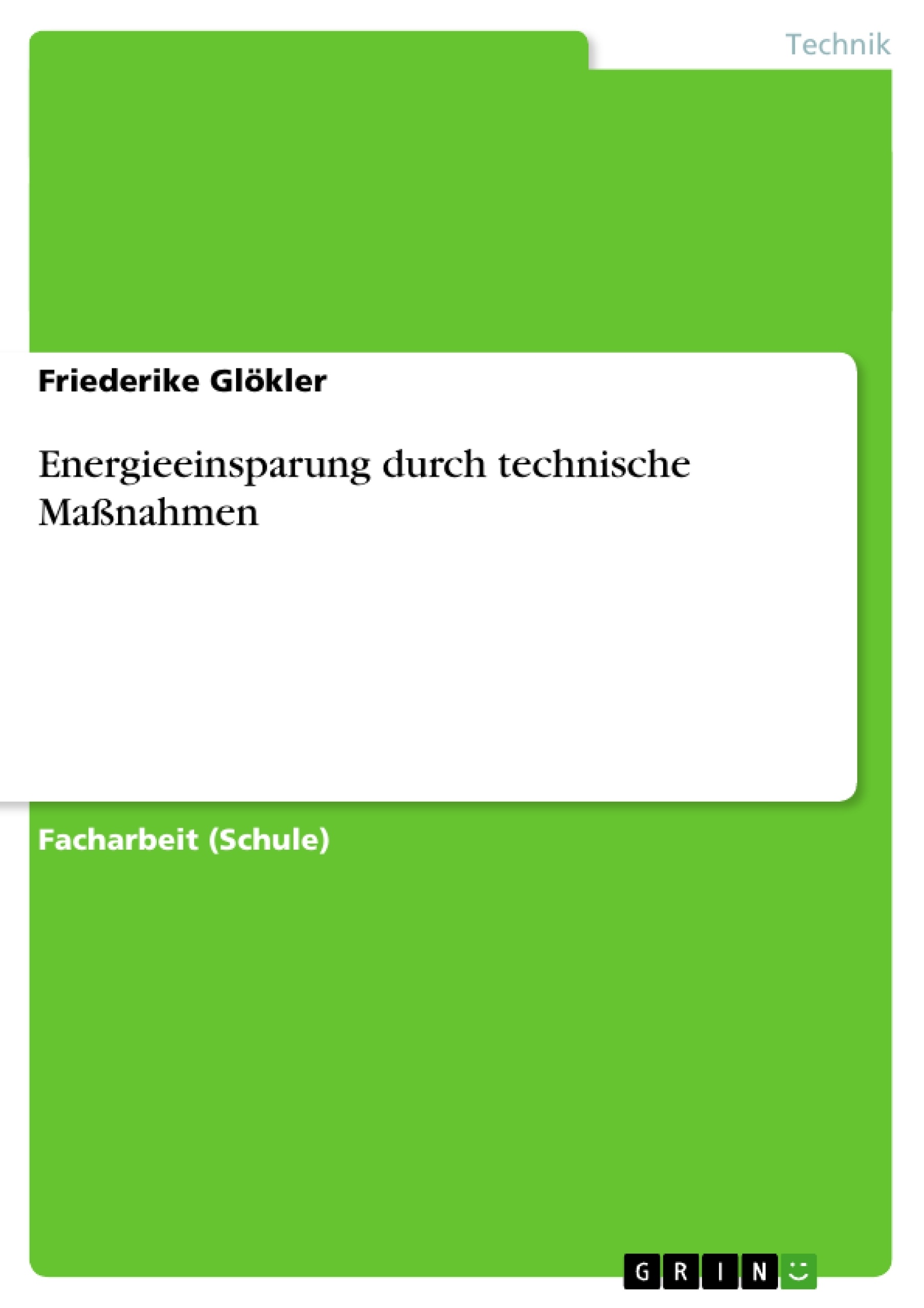Inhalt:
1. Energie
2. Ziel des Wärmeschutzes
3. Dämmen nach Vorschrift (Deutschland)
3.1 k- Wert
4. Wärmedämmung
4.1 Ein Beispiel für Hausdämmungen
4.2 Wärmeverbrauch im Vergleich
5. Sofortmaßnahmen zur Einsparung von Wärmeenergie
1. Energie
Energie ist die in einem physikalischen System gespeicherte Fähigkeit, Arbeit zu verrichten, beispielsweise einen Motor anzutreiben oder Moleküle in Schwingung zu versetzen (= Wärme erzeugen). Energie kann nicht erzeugt oder vernichtet werden, die verschiedenen Energieformen können nur ineinander umgewandelt werden.
In einem Wärmekraftwerk wird etwa die chemische Energie der Kohle bei der Verbrennung in Wärmeenergie, diese in der Dampfturbine in mechanische Energie und diese im Generator in elektrische Energie umgewandelt.
2. Ziel des Wärmeschutzes
Ziel des Wärmeschutzes ist die Verringerung von Wärmeverlusten und damit Einsparungen von Energie. Das ist möglich durch die Verwendung gut wärmedämmender Baustoffe und Fenster oder durch Anbringung einer Wärmedämmung. Dies ist gleichzeitig ein Beitrag zum Umweltschutz; da der Energieverbrauch gesenkt wird. Wärmeschutz darf nicht isoliert betrachtet werden. Jede Maßnahme zum Schutz von Bauteilen vor Feuchtigkeit dient gleichzeitig dem Wärmeschutz, bestimmte Wärmeschutzmaßnahmen können zugleich dem Schallschutz dienen.
Der Wärmehaushalt des Menschen, der Bedarf an frischer Luft (= Sauerstoffreiche Luft) und andere Einflüsse haben Bedeutung für das Wohlbefinden. Das bedeutet, das bei allem Bestreben, möglichst dichte und dämmende raumumschließende Bauteile zu schaffen, dennoch ein Luftaustausch zwischen Raumluft und Außenluft stattfinden muss. Mit dieser Lüftung werden dann zwangsläufig Wärmeverluste auftreten.
3. Dämmen nach Vorschrift (Deutschland)
Wie gut ein neues Haus gedämmt sein muss, bestimmt in Deutschland die Wärmeschutzverordnung. Seit 1. Januar 1995 gelten neue, verschärfte Anforderungen, wodurch der Heizenergieverbrauch bei Neubauten gegenüber den alten werten aus 1982 um 30% gesenkt werden soll.
Neu ist auch das Berechnungsverfahren. Für jedes Haus wird nach einer vorgegebenen Formel ein sogenannter maximaler Jahresheizwärmwebedarf ermittelt, der von der Außenfläche aus Fenstern, Außenwänden, Dachflächen und Kellerdecken und dem damit umschlossenen Gebäudevolumen abhängt. Für freistehende Einfamilienhäuser liegt er bei etwa 85 bis 90 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Der tatsächliche Heizwärmebedarf darf diese ,,Energiekennzahl" nicht Übersteigen. Das muss vor Baubeginn in einer aufwendigen Modellrechnung nachgewiesen werden. Berücksichtigt werden dabei einerseits die Wärmeverluste durch die Bauteile und durch die Lüftung und anderseits die Wärmegewinne durch die Sonnen-einstrahlung, die BewohnerInnen und ihre Geräte. Der Vorteil der neuen Energiekennzahl ist, dass damit das Ziel, möglichst wenig Energie für den Betrieb des Gebäudes zu verbrauchen, auf verschiedene Weise erreicht werden kann. Es können beispielsweise die Wärmedämmung verstärkt, die Sonneneinstrahlung besser genutzt oder die Lüftungsverluste Verkleinert werden.
Die von einem Experten ermittelte Energiezahl und alle wichtigen Werte aus der Berechnung müssen Außerdem in einem sogenannten ,,Wärmebedarfsausweis" festgeha lten werden. Dieser Energiepaß dient dem Hausbau als Nachweis gegenüber der Behörde, daß die Wärmeschutzverordnung eingehalten wird, und für die Inanspruchnahme erhöhter Fördermittel bei Energiesparender Bauweise. HauskauferInnen und MieterInnen Können verlangen, dass ihnen der Eigentümer den Energiepaß vorlegt, und werden so über die zu erwartenden Energiekosten informiert. Das beschriebene sogenannte ,,allgemein Nachweisverfahren" kann für Ein- und Zweifamilienhäuser mit maximalvollgeschossen durch ein ,,Vereinfachtes Nachweisverfahren" ersetzt werden. Dabei ist nur die Einhaltung bestimmter k-Werte nachzuweisen. K-Werte legen die maximal zulässigen Wärmeverluste durch bestimmte Bauteile fest.
3.1 k- Wert
Wenn es draußen kälter ist als im Haus, dann fließt Wärme durch alle Umfassungsflächen des Hauses ab. Mit dem k- Wert beschreibt man diesen Wärmestrom. Baustoffe bremsen diese Wärmeabwandlung unterschiedlich gut. Je kleiner der k- Wert z.B. einer Wand ist, desto weniger Energie läßt sie nach außen verschwinden. Je dicker das Material ist, desto weniger Wärme kann abwandern, desto kleiner ist der k- Wert. Der k- Wert eines Fensters setzt sich aus den k- Werten des Rahmens und der Scheibe zusammen. Besonders niedrig ist der k- Wert bei Wärmeschutzfenstern. Die hohe Dämmwirkung kommt durch eine dünne, aufgedampfte Edelmetallschicht (z.B. Silber) zustande. Die Metallschicht reflektiert die Wärmestrahlung in den Raum.
K= 0,7W/(m2 K) bedeutet: durch 1m2 dieses Bauteils verschwinden bei einem Temperaturunterschied von 1K in jeder Sekunde 0,7J.
Wenn draußen eine Temperatur von 0°C herrscht, dann ist der Temperaturunterschied von innen und außen 20K. Wenn das Haus eine gesamte Außenfläche von 300m2 hat, dann heizt es die Umgebung mit einer Leistung von 20K 300m2 0,7W/(m2 K)= 4200W.
4. Wärmedämmung
Der zentrale Faktor im Energiekonzept ist der Wärmeschutz des Gebäudes. Je geringer die Verluste durch Wände, Decken, Fenster und Türen, um so weniger Heizenergie wird gebraucht. Gleichzeitig schafft Dämmen warme Wände und damit Behaglichkeit und ein gutes Raumklima.
Man muß wissen, daß Heizenergie im Haus vor allem verloren geht durch:
- Lufterneuerung durch Türen und Fenster,
- Wärmeleitung und Abstrahlung durch die Fenster und infolge der
- Wärmeleitung durch die Mauern zur kalten Außenseite.
Um die Wärme im Haus zu halten und Energie zu sparen, müssen diese Energielecks ,,verstopft" werden, denn es muß immer nur die Energiemenge nachgeheizt werden, die nach außen verloren geht!
4.1 Ein Beispiel für Hausdämmungen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Fähigkeit, gegen Wärmedurchgang zu isolieren - sowohl Hitze als auch Kälte abzuhalten
-, ist eine wichtige Eigenschaft der Baustoffe.
Grundsätzlich gilt:
- Leichte Stoffe mit vielen Hohlräumen (Lufteinschlüsse) besitzen eine gute Wärmeisolation.
- Dichte Materialien leiten im allgemeinen Wärme gut weiter und sind daher schlechte Isolationsmaterialien.
- Eine Schicht aus 16mm dickem Hartschaum isoliert z.B. ebensogut wie eine 1m dicke Mauer aus Naturstein!
- Materialien mit einer geringen Dichte leiten die Wärme schlechter als Materialien mit einer hohen Dichte.
Fenster und Außent üren lassen die meiste Energie entweichen: Glas ist besonders wärmedurchlässig, und Ritzen sowie Fugen sind weitere Verlustquellen. Zugluft im Zimmer und beschlagene Scheiben sind ein Alarmsignal.
Mögliche Gegenmaßnahmen sind:
Abdichten von Tür- und Fens terrahmen kann bis zu fünf Prozent Heizenergieeinsparung bringen.
Wichtig: Doppelglasfenster kann bis zu 15 Prozent der Heizenergie einsparen. Rolläden und Fensterläden verringern nachts die Wärmeverluste.
Außendämmung/ Innendämmung
Die Gebäudehülle sorgt nach den Fenstern für die größten Wärmeverlusten. Eigentlich ist die Außendämmung effektiver, da sie der Fassade Witterungsschutz bietet und es im Haus zu keiner Feuchtigkeitsbildung kommen kann. Die meisten Häuser sind aber trotzdem innen gedämmt, da dies billiger und einfacher ist. Außerdem können die Räume auch einzeln gedämmt werden.
Zum Dämmen kann man unter anderem folgende Materialien verwenden:
- Styropor
- Polystyrol
- Steinwolle, Glasfaser und Zelluloseflocken
- Hanffasermatten
- Korkschrot
Dach dämmen
Die Dämmung der oberen Geschoßdecke oder des Daches verringert die Wärmeverluste enorm. Bleibt der Dachraum unbeheizt, genügt es, den Dachboden zu dämmen durch Auslegen von Dämmfilz, Platten oder Schüttmaterial. Soll der Dachboden bewohnt werden, muß das Dach gedämmt werden.
Keller dämmen
Die Kellerdämmung kann von unten an der Kellerdecke angebracht werden. Die Wände und der Boden von beheizten Kellerräumen sollten mit einer Innendämmung versehen werden.
4.2 Wärmeverbrauch im Vergleich
Die folgenden 4 Beispiele zeigen die Größenordnung der Abhängigkeit von der Hausform. Die Beispiele wurden entnommen dem ,,Energiesparbuch für das Eigenheim" vom Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau.
Die Kosten für Heizöl wurden mit 0,75DM/l eingesetzt.
1. Reihenhaus mit 100m2 Wohnfläche. Brennstoffkosten jährlich etwa 2050DM (20,50DM/m2 Wohnfläche).
Das beiderseits eingebaute Reihenhaus ist wegen seiner geringen Außenfläche im Verhältnis zur Wohnfläche besonders sparsam im Brennstoffvergleich, Bei diesem Haus tragen größtenteils Fenster, Dach und Außenfläche zum Wärmeverlust bei.
2. Doppelhaushälfte mit 100m2 Wohnfläche. Brennstoffkosten jährlich etwa 2620DM (26,20DM/m2 Wohnfläche).
Bei diesem Haus kommt gegenüber dem Reihenhaus zusätzlich eine freistehende Giebelwand als große Außenfläche hinzu, die den Wärmeverlust erhöht.
3. Freistehendes Einfamilienhaus mit 125m2 Wohnfläche. Brennstoffkosten jährlich etwa 3940DM (31,50DM/m2 Wohnfläche).
Ein Einfamilienhaus dieser Art verursacht die größten Außenflächen höhere Wärmeverluste.
4. Gartenhofhaus mit 125m2 Wohnfläche. Brennstoffkosten jährlich etwa 4460DM (35,70DM/m2 Wohnfläche).
Die Ebenerdige Bauweise des Gartenhofhauses mit der großen Gebäudeumhüllenden Fläche erfordert hohe Heizkosten. Das Verhältnis von Außenfläche des Hauses zu Wohnfläche ist besonders ungünstig. Die Dachfläche und die meist großen Fensterflächen sind die schwachen Stellen des Wärmeschutzes dieser Bauform.
5. Sofortmaßnahmen zur Einsparung von Wärmeenergie
Neben der Wärmeenergie von Bauteilen beeinflussen vor allem die Nutzungsgewohnheiten die Höhe des Energieverbrauchs. Eine Reihe von Verhaltensregeln kann den Energieverbrauch sofort und deutlich senken:
- Aus medizinischer Sicht ist eine Raumlufttemperatur von 18 bis 20° C am günstigsten.
Überhitzte Räume führen zu trockenen Schleimhäuten, zu unnötiger Staubaufwirbelung, und sie müssen häufiger gelüftet werden. Schon die Absenkung der Raumtemperatur um 1 Grad führt zu einer Energieeinsparung von etwa 6%.
- Thermostatventile verhindern ein Überheizen von Räumen, moderne Regelgeräte ermöglichen eine Absenkung der Temperatur bei Nacht oder bei längerer Abwesenheit.
- Das Schließen von Roll- und Klappläden kann den Energieverlust im Fensterbereich deutlich senken. Dichte, flauschige Vorhänge bilden mit Fensterbrett und Laibung ein Wärmedämmendes Luftpolster.
- Vorhänge dürfen Heizkörper nicht bedecken, da sonst ein Teil der Wärme entweicht und ungenutzt verlorengeht. Heizkörper sollten auch nicht mit Möbel zugestellt werden, damit kein Wärmestau entsteht.
- Richtiges Lüften sorgt für gesunde Frischluft und spart Energie. Da Luft leicht ist, speichert
sie nur wenig Wärme, die meiste Wärme steckt in Umschließungsflächen und Einrichtungsgegenständen. Ein schneller Luftaustausch wird durch eine Stoßlüftung gewährleistet.
- Gluckernde Geräusche im geöffneten Heizkörper deuten auf Luft im Heizungssystem hin. Die Wärmeübertragung kann dadurch stark beeinträchtigt werden. Der Entlüfterschlüssel kann hier sehr schnell Abhilfe schaffen.
- Die Heizwassertemperatur sollte immer gerade so niedrig gehalten werden, dass die transportierte Wärme für die Beheizung ausreicht. Denn je niedriger die Wassertemperatur im Rohrsystem, desto geringer sind auch die Wärmeverluste.
- Der Wasserdruck des Heizwasserkreislaufs muss von Zeit zu Zeit kontoliert werden. Zu niedriger Wasserdruck behindert die Wärmeabgabe und steigert die Energieverluste. Der Brennraum muss regelmäßig entrußt werden, da Ablagerungen die Abgasverluste erhöhen.
- Moderne Heizkessel erreichen Wirkungsgrade von über 90%. Neben Maßnahmen zur Wärmedämmung sollte man auch den Austausch des alten Heizkessels gegen eine Energiesparende Heizungsanlage bedenken.
Quellen Nachweiß
Kursbuch Lebensqualität
Die Umwelt schonen, Geld sparen und angenehm Leben Entscheidungshilfen für den Alltag
Von Kurt Langbein, Manfred Mühlberger und Christian Skalnik Verlag: Kiepenheuer und Witsch
Dämmungen und Isolierungen
Moderniesieren, Renovieren, Sanieren Compact Modernisierungs- Ratgeber Ein Praktischer Leitfaden
Von Max Direktor
Niedrig Energie Häuser
Innovative Bauweisen und neue Standards
Von Othmar Humm
Verlag: Öko Buch in Staufen bei Freiburg
Umwelt: Technik 9
Ein Arbeits- und Informationsbuch
Von Werner Bleher, Klaus Helling, Gerhard Hessel, Alfred Köger, Walter Kosack, Rainer Schönherr
Ernst Klett Verlag
Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig
Umwelt: Physik 9
Baden - Württemberg
Von Johann Leupold, Eckhard Müller, Uwe Pietrzyk, Erwin Spehr Ernst Klett Verlag
Stuttgart, Düsseldorf, Berlin, Leipzig
Praktische Bauphysik
Eine Einführung mit Berechnungsbeispielen
Von Gottfried Lohmeyer
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Wärmeschutzes?
Das Ziel des Wärmeschutzes ist die Verringerung von Wärmeverlusten und damit Einsparungen von Energie durch die Verwendung gut wärmedämmender Baustoffe und Fenster oder durch Anbringung einer Wärmedämmung. Dies trägt auch zum Umweltschutz bei.
Wie wird in Deutschland die Dämmung geregelt?
Die Wärmeschutzverordnung in Deutschland bestimmt, wie gut ein neues Haus gedämmt sein muss. Seit dem 1. Januar 1995 gelten verschärfte Anforderungen, die den Heizenergieverbrauch bei Neubauten senken sollen. Es wird ein maximaler Jahresheizwärmebedarf ermittelt, und der tatsächliche Bedarf darf diesen Wert nicht überschreiten.
Was ist der k-Wert?
Der k-Wert beschreibt den Wärmestrom durch die Umfassungsflächen eines Hauses. Je kleiner der k-Wert, desto weniger Energie geht nach außen verloren. Er wird in W/(m2 K) angegeben.
Welche Faktoren beeinflussen den Energieverlust im Haus?
Heizenergie geht im Haus hauptsächlich durch Lufterneuerung, Wärmeleitung und Abstrahlung durch Fenster sowie durch Wärmeleitung durch Mauern verloren.
Welche Sofortmaßnahmen kann man zur Einsparung von Wärmeenergie ergreifen?
Sofortmaßnahmen sind unter anderem: Raumlufttemperatur auf 18-20°C halten, Thermostatventile nutzen, Rollläden und Vorhänge schließen, Heizkörper nicht verdecken, richtig lüften (Stoßlüftung), Heizung entlüften, Heizwassertemperatur niedrig halten und den Heizkessel regelmäßig warten.
Welche Materialien eignen sich zur Wärmedämmung?
Zur Dämmung können unter anderem Styropor, Polystyrol, Steinwolle, Glasfaser, Zelluloseflocken, Hanffasermatten und Korkschrot verwendet werden.
Welche Arten von Hausdämmung gibt es?
Es gibt Außendämmung, Innendämmung, Dachdämmung und Kellerdämmung. Die Außendämmung ist effektiver, da sie die Fassade schützt, während die Innendämmung oft einfacher und billiger ist.
Was ist die Bedeutung des Energieausweises?
Der Energieausweis dient dem Hausbau als Nachweis gegenüber der Behörde, dass die Wärmeschutzverordnung eingehalten wird, und für die Inanspruchnahme erhöhter Fördermittel. HauskäuferInnen und MieterInnen können so über die zu erwartenden Energiekosten informiert werden.
Welche Hausformen sind energieeffizienter?
Reihenhäuser sind aufgrund ihrer geringen Außenfläche im Verhältnis zur Wohnfläche besonders sparsam im Brennstoffverbrauch. Freistehende Einfamilienhäuser und Gartenhofhäuser haben tendenziell höhere Wärmeverluste.
- Quote paper
- Friederike Glökler (Author), 2001, Energieeinsparung durch technische Maßnahmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99968