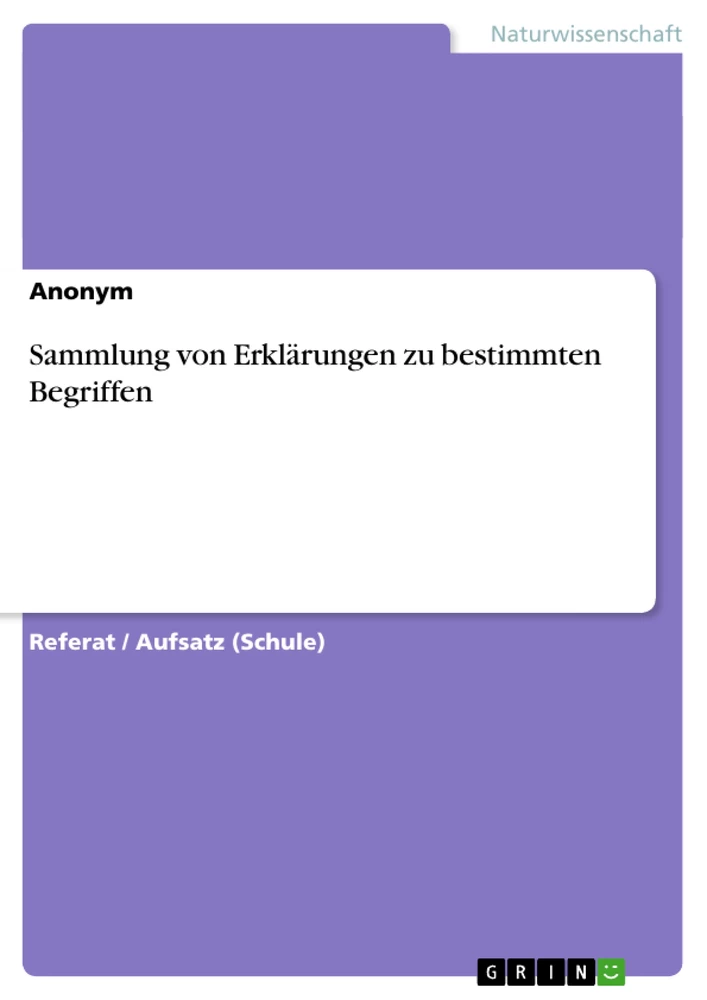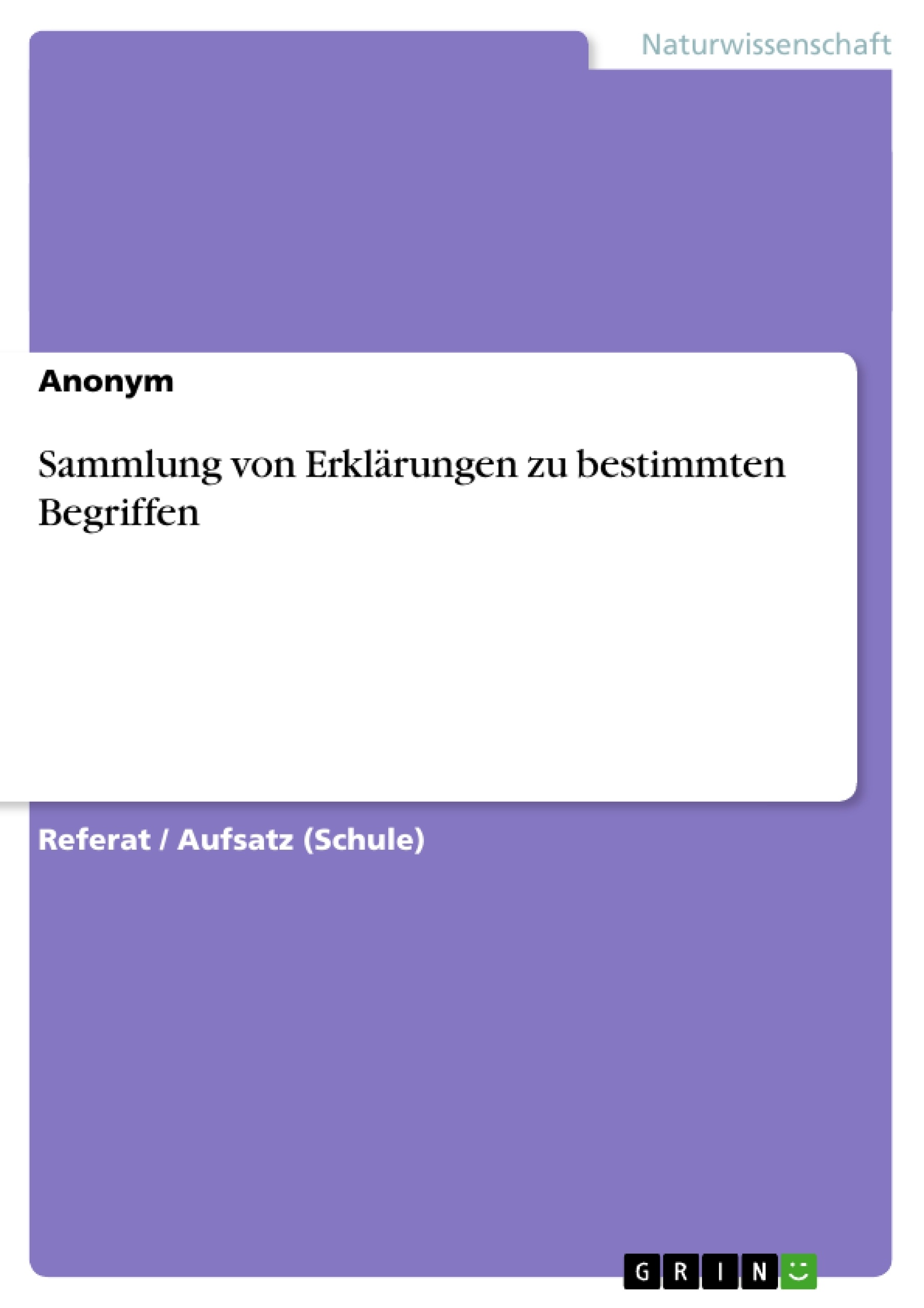Inhalt:
1. Boden
2. Licht
3. Temperatur
4. Vergleich von Mischwald und Fichtenforst
5. Wasser
1. Boden
Bodenreaktion: der chemische Zustand des Bodens im Hinblick auf das Überwiegen von Säuren oder Basen. Die Bodenreaktion kann sauer, neutral oder basisch (alkalisch) sein.
Festgestellt wird sie in einfacher Weise mittels Salzsäureprobe auf Vorhandensein von Kalk oder durch feinere Messungen mit dazu besonders konstruierten Apparaten. Die jeweils vorliegende Bodenreaktion wird ausgedrückt in pH-Werten.
Boden: die durch physikalische und chemische Verwitterungsvorgänge, biogene Umsetzung (Bildung von Humus) und vielfältige Verlagerungsprozesse an der Erdoberfläche entstehende Lockererde über dem Gestein.
Der Boden ist Lebensraum der Bodenorganismen, Wurzelort der Pflanzen und hat Bedeutung für die Reinigung und den Mineralstoffanreicherung des Niederschlagswassers beim Absickern zum Grundwasser.
Entstehung des Bodens:
Bodenchemie:
Die chemischen Reaktionen der im Boden enthaltenen Stoffe sind zum Teil sehr komplex und noch nicht vollständig erforscht. Im Allgemeinen bestehen Böden hauptsächlich aus Silicaten, deren Komplexität vom einfachen Siliciumoxid Quarz bis zu den hochkomplexen wasserhaltigen Schichtsilicaten der Tonminerale reichen. Zu den für die Pflanzenernährung wichtigsten Elementen gehören Phosphor, Schwefel, Stickstoff, Calcium, Eisen und Magnesium. Pflanzen brauchen zum Gedeihen jedoch auch Spuren u. a. der Elemente Bor, Kupfer, Mangan und Zink.
Pflanzen entnehmen die Nährstoffe den so genannten Bodenkolloiden. Diese Kolloide haben sich als Produkt der physikalischen und chemischen Verwitterung gebildet. Bodenkolloide bestehen aus Hydroxiden oder wasserhaltigen Eisen-, Aluminium- und Siliciumverbindungen und kristallinen Neubildungen, beispielsweise Kaolinit und Montmorillonit. Kolloide besitzen physikalische Eigenschaften, die sich stark auf die landwirtschaftliche Nutzbarkeit der Böden auswirken. Böden in Gebieten mit geringem Niederschlag und verhältnismäßig wenig Grundwasser sind auch nur einer mäßigen Auswaschung unterworfen und enthalten daher eine große Menge ihrer ursprünglichen Bestandteile, beispielsweise Calcium, Kalium und Natrium. Kolloide dieser Art dehnen sich, wenn sie feucht werden, stark aus und neigen dazu, in Wasser zu dispergieren (sich fein zu verteilen). Nach einer Befeuchtung trocknen sie bis zu einer gallertartigen Konsistenz und können bei weiterer Austrocknung Massen bilden, die völlig undurchlässig gegenüber Wasser sind.
Wo das Gelände von Wäldern bedeckt ist, werden die anorganischen und organischen Kolloide nach Regengüssen oder Überschwemmungen mit dem Grundwasser durch den Boden nach unten verlagert. Sie bilden im unteren Teil des Bodens eine konzentrierte Schicht und festigen die anderen Bodenteilchen zu einer dichten, festen Kruste. Eine wichtige Eigenschaft von kolloidalen Bodenpartikeln ist ihre Fähigkeit, sich an einer chemischen Reaktion zu beteiligen, die man als Basenaustausch bezeichnet. Bei dieser Reaktion verändert sich eine Verbindung, indem einer ihrer Bestandteile durch ein anderes chemisches Element substituiert (ausgetauscht) wird. Dadurch können vorher in der kolloidalen Verbindung gebundene Elemente freigesetzt werden und stehen in der Bodenlösung als pflanzliche Nährstoffe zur Verfügung. Düngt man Böden mit Kalium, ist sofort ein Teil des Kaliums als Bestandteil der Bodenlösung verfügbar, während der Rest an einem Basenaustausch teilnimmt und eingeschlossen in den Bodenkolloiden im Boden gespeichert wird.
Eines der einfachsten und landwirtschaftlich wichtigsten Beispiele des Basenaustausches ist die Reaktion, die abläuft, wenn Kalkstein (CaCO3) zur Neutralisierung des Säuregehalts eingesetzt wird. Die Bodenacidität, die als Konzentration der Wasserstoffionen definiert werden kann, wirkt sich auf die Gesundheit der meisten Pflanzen aus. Hülsenfrüchte z. B. können auf saurem Boden nicht gedeihen.
Zeigerarten: Pflanzen die zum gedeien ganz bestimmte Bodenverhältnisse benötigen und deshalb diese Bodenverhältnisse durch ihr Vorkommen anzeigen. Aus ihrem gehäuften Auftreten innerhalb eines Verbreitungsgebietes kann man auf gewisse Bodeneigenschaften schließen.
Indikatoren
Beispiele:
Kalkanzeiger (Anzeiger für gut durchlüfteten, durchlässige Kalkböden, wärmeliebend
- Rundblättriges Hasenohr
- Traubenhyazynthe
- Küchenschelle
- Leberblümchen
- Stengellose Eberwurz-Silberdistel
Saüreanzeiger (Anzeiger für Kalkmangel, Säure wird ertragen
- Kleiner Sauerampfer
- Hasen Klee
- Heidekraut
- Heidelbeere
- Besenginster
- Drahtschmiele
- Pillensegge
- Adlerfarn
- Waldreitgras
- Schmalblättrige Hainsimse
Indikatoren
Beispiele
Staunässe (Anzeiger für lang andauernde Staunässe und mangelnde Bodendurchlüftung)
- Ackerminze
Anzeiger für Krumenfeuchtigkeit, für frucht-bare, selbst im Sommer ausreichend feucht bleibende Böden, wärmeliebend
- Kleiner Wegerich
- Dreiteiliger Zweizahn
Stickstoffanzeiger (Anzeiger für Stickstoff-reiche, humushaltige Böden)
- Voge lmiere
- Hirtentäschel
- Brennnessel
- Weiße Taubnessel
- Bärenklau
Stickstoffmangelanzeiger
- Preiselbeere
- Arnika
- Zittergras
Lichtanzeigerpflanzen
- Klette
- Hundsrose
- Wacholder
Trockenheitsanzeiger
- Zypressenwolfsmilch
- Wundklee
- Kleiner Wiesenknopf
Feuchtigkeitsanzeiger
- Sumpfdotterblume
- Sumpffehrenpreis
- Wasserminze
Salzpflanzen
- Queller
- Strandaster
- Strandnelke
- Strandflieder
2. Licht
Licht: Im physikalischen Sinn eine Form der elektromagnetischen Strahlung. Licht besteht aus extrem schnellen Schwingungen eines elektromagnetischen Feldes in einem bestimmten Frequenzbereich. Bei sichtbarem Licht entstehen verschiedene Farben durch verschiedene Frequenzen. Sie reichen von etwa 4 × 1014 Schwingungen pro Sekunde für rotes Licht bis ungefähr 7,5 × 1014 Schwingungen pro Sekunde für blaues Licht. Die Wellenlängen für das sichtbare Spektrum reichen von ungefähr 40 millionstel Zentimeter (Violett) bis zu 75 millionstel Zentimeter (Rot). Höhere Frequenzen, denen kürzere Wellenlä ngen entsprechen, umfassen die ultraviolette Strahlung, und noch höhere Frequenzen findet man bei der Röntgenstrahlung. Niedrigere Frequenzen (also größere Wellenlängen) werden als infrarote Strahlung bezeichnet. Noch kleinere Frequenzen sind charakteristisch für Radiowellen. Im allgemeinen Sinn versteht man unter Licht die Form von Strahlung, die man mit dem bloßen Auge wahrnehmen kann - also sichtbares Licht.
Beleuchtungsstärke:
-wird in Lux gemessen und ist ein Maß für die an einem Ort
herrschenden Helligkeit bzw. die dort einfallende Lichtmenge -von der zur Erdegelangenden Sonnenstrahlung gehen jedoch durchschnittlich bereits 53% in den höheren Luftschichten verloren
-von den verbleibenden 47% erreichen die Hälfte die Erdoberfläche direkt, die andere Hälfte wird in der Luft und den Wolken zerstreut
-die Lichtmenge hängt von der geographischen Breite, Höhe über Meeresspiegel der Geländegestalt und der Bewölkungshäufigkeit ab
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Einfluss der Beleuchtungsstärke auf das Pflanzenwachstum an Land:
- für Wachstum unbedingt erforderlich
- erst Licht ermöglicht die Umwandlung energiearmer Stoffe wie CO2 und H2O in energiereiche Produkte wie z.B. Kohlehydrate (durch Photosynthese)
- Licht als Informationsträger (sinnvolle Orientierung im Lebensraum)
- Einfluss des Lichtes hängt von der Stärke und spektral. Zusammensetzung sowie Einwirkungsdauer/Einwirkungsrichtung ab
1. Sonnenpflanzen (100& Lichtgenuss, volles Tageslicht) nur an unbeschatteten Standorten (z.B. Wüste oder Steppe)
2.Halbschattengewächse --> Arten die volles Licht aber auch Beschattung vertragen Wachstum nur wenn minimaler Lichtgenuss nicht unterschritten wird z.B.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3.Schattenpflanzen --> Lichtgenuss stets unter 100% --> Krautschicht Pflanzen
Lichtgenuss
Buschwindröschen
40-20%
Ruprechtkraut 74-45%
Hasenlattich 10-3%
- minimale Beleuchtungsstärke für Pflanzen sonniger Standorte 800-2000 lx --> Schattenpflanzen weniger als 250 lx
- vollentwickeltes Mooswachstum nur 40 lx nötig, zw. 35-10 lx Grünalgenwachstum
- am Boden Abfall der Lichtmenge bis auf 30-50% bis zu 4% Existenzgrenze bei 1%
- ab 0,3% extreme Schattenpflanzen (Farne, Begonien usw.)
Einfluss der Beleuchtungsstärke auf das Pflanzenwachstum im Wasser:
- durch Reflexion an der Wasseroberfläche geht ein Teil verloren, bei einem hohem Sonnenstand 6-10% bei weniger mehr
- mit zunehmender Tiefe nimmt die Lichtmenge exponentiell ab
- Lichtabsorption abhängig von Färbung, Trübung, der darin enthaltenen Schmutz u. Schwebeteilchen und den reflektierenden Eigenschaften von Untergrund und Pflanzenbewuchs
- trübes Fließge wässer kann in 50 cm Tiefe eine Lichtintensität von 7% aufweisen, was einem Fichtenwald entspricht
- in großen Tiefen nur kurzwellige Lichtanteile, langwelliges Licht wird schon oben absorbiert
Formel zur Berechnung des Lichtgenusses:
Beleuchtungsstärke am Wuchsort
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3. Temperatur
Temperatur, eine Eigenschaft, mit der sich der thermische Zustand eines Systems bzw.
Körpers beschreiben lässt. Der physikalischen Definition zufolge ist die Temperatur eine Zustandsgröße, die Systeme oder Körper im so genannten thermodynamischen Gleichgewicht charakterisiert. Der physikalische Begriff Temperatur entstand, als man Wärmeunterschiede von Körpern messen wollte. Man erkannte, dass ein Körper (solange er nicht schmilzt oder siedet) heißer wird, wenn man ihm Wärme zuführt. Haben zwei Körper unterschiedliche Temperaturen und befinden sie sich in engem Kontakt miteinander, so fließt Wärme vom heißeren zum kühleren Körper, bis beide dieselbe Temperatur haben. In diesem Fall ist ein thermisches Gleichgewicht erreicht. Der Begriff Temperatur muss deutlich von dem Begriff Wärme unterschieden werden. Die Temperatur ist eine Eigenschaft des betreffenden Körpers, und in einem Gleichgewichtssystem nimmt sie überall denselben Wert an. In der Physik bezeichnet man die Temperatur deshalb auch als intensive Größe. Dagegen ist Wärme eine Energiemenge, die sich in den Körpern befindet oder aufgrund einer Temperaturdifferenz zwischen ihnen fließt.
Vermutlich wird die Bodentemperatur am Morgen unter der Temperatur in höheren Höhen liegen. Am Abend wird das ganze anders herum sein, d.h. die Bodentemperatur wird über der Temperatur in höheren Höhen liegen.
4. Vergleich von Mischwald und Fichtenforst
Ein Fichtenforst ist ein von Menschenhand geschaffenes Ökosystem, welches, wie der Name schon sagt, aus dem Reinbestand von gleichaltrigen Fichten besteht. Diesem Wald fehlt der typische Schichtenaufbau (Moos-, Kraut-, Strauch- und Baumschicht), denn aufgrund der immergrünen Fichte, welche so gut wie kein Licht durchlässt, wird kaum eine Krautschicht und eine Strauchschicht ausgebildet bzw. sie fehlen vollkommen (siehe Abbildung rechts). Die schwer zersetzbare Streu der Fichtennadeln lässt zudem die Böden versauern. Aufgrund der Schaffung des Menschen stammen die Samen alle aus einer Zucht, es fehlt somit die genetische Vielfalt und es finden keine Neuerungen im Genpool statt. Daraus ergibt sich wiederum die Tatsache, das der Fichtenwald anfälliger ist gegenüber biotischen Faktoren wie zum Beispiel Schädlingsbefall oder abiotischen Faktoren wie zum Beispiel langen Kälte- oder Dürreperioden, weil alle Bäume gleicher Art sind und somit alle den gleichen Toleranzbereich besitzen. Aber auch die fehlende Vielfalt der Pflanzen- und Tierwelt in dem Ökosys tem verstärkt die Anfälligkeit gegenüber von Schädlingen, denn denen fehlt die Konkurrenz. Der Einsatz von Pestiziden zeigt nur für kurze Zeit die erwünschte Wirkung - langfristig werden dadurch Umwelt und Organismen mit Schadstoffen belastet. Da Fichten mit ihren flachen Wurzeln nicht so tief in den Boden eindringen, sind sie in besonderem Maße anfällig für Windwurf und Schneebruch. Dies bietet der Vermehrung von Schädlingen wie dem Borkenkäfer ideale Bedingungen. Wirtschaftlich gesehen ist der Fichtenforst schwieriger zu Nutzen, denn aufgrund des gleichen Alters der Bäume werden sie alle auf einmal gefällt und es liegt der Boden frei, dieser freie Boden ist nun durch Erosion gefährdet.
5. Wasser
Bedeutung:
Wasser ist der Hauptbestandteil der lebenden Materie. 50 bis 90 Prozent der Masse lebender Organismen bestehen aus Wasser. Protoplasma, die Grundsubstanz lebender Zellen, enthält u.a. Fette, Kohlenhydrate, Proteine, Salze und andere Substanzen. Wasser fungiert dabei als eine Art Bindeglied. Es transportiert diese Substanzen, geht mit ihnen Verbindungen ein und sorgt für ihren chemischen Abbau. Das Blut von Tieren und der Saft in Pflanzen, die u. a. für den Transport der Nahrung und die Entsorgung der Abbauprodukte lebenswichtig sind, enthalten reichlich Wasser. Auch im Stoffwechselgeschehen, besonders beim Abbau von Proteinen und Kohlenhydraten, spielt Wasser eine Schlüsselrolle. Dieser Prozess, den man Hydrolyse nennt, läuft ständig in lebenden Zellen ab.
Aufbau:
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptthemen, die in diesem Dokument behandelt werden?
Dieses Dokument behandelt hauptsächlich die ökologischen Faktoren Boden, Licht, Temperatur und Wasser sowie einen Vergleich zwischen Mischwald und Fichtenforst.
Was wird im Abschnitt über den Boden behandelt?
Der Abschnitt über den Boden behandelt Themen wie Bodenreaktion (Säuregehalt/Basizität), Bodenentstehung, Bodenchemie, Bodenkolloide, Basenaustausch und Zeigerarten (Indikatorpflanzen) für verschiedene Bodeneigenschaften wie Kalkgehalt, Säuregehalt, Staunässe, Stickstoffgehalt, Lichtverhältnisse, Trockenheit und Feuchtigkeit.
Welche Aspekte des Lichts werden im Dokument diskutiert?
Im Abschnitt über Licht werden die physikalische Definition von Licht, Beleuchtungsstärke (gemessen in Lux), der Einfluss der Beleuchtungsstärke auf das Pflanzenwachstum an Land (Sonnenpflanzen, Halbschattengewächse, Schattenpflanzen) und im Wasser (Reflexion, Absorption) sowie die Berechnung des Lichtgenusses behandelt.
Was beinhaltet der Abschnitt über die Temperatur?
Der Abschnitt über die Temperatur gibt eine physikalische Definition von Temperatur und erwähnt kurz die Unterschiede in der Bodentemperatur im Vergleich zur Temperatur in höheren Lagen im Tagesverlauf.
Was ist der Inhalt des Vergleichs von Mischwald und Fichtenforst?
Der Vergleich von Mischwald und Fichtenforst konzentriert sich auf die Unterschiede in Bezug auf Schichtenaufbau, genetische Vielfalt, Anfälligkeit für Schädlinge und abiotische Faktoren, die Auswirkungen auf den Boden (Versauerung), die Stabilität gegenüber Windwurf und Schneebruch sowie die wirtschaftliche Nutzung.
Welche Rolle spielt Wasser laut dem Dokument?
Das Dokument beschreibt Wasser als Hauptbestandteil lebender Materie, als Transportmittel und Lösungsmittel für Stoffe in Organismen sowie seine Bedeutung für Stoffwechselprozesse wie die Hydrolyse. Außerdem wird der Aufbau von Wasser (H2O) und einige physikalische Eigenschaften genannt.
Was sind Beispiele für Kalkanzeigerpflanzen?
Beispiele für Kalkanzeigerpflanzen sind Rundblättriges Hasenohr, Traubenhyazynthe, Küchenschelle, Leberblümchen und Stengellose Eberwurz-Silberdistel.
Was sind Beispiele für Säureanzeigerpflanzen?
Beispiele für Säureanzeigerpflanzen sind Kleiner Sauerampfer, Hasen Klee, Heidekraut, Heidelbeere, Besenginster, Drahtschmiele, Pillensegge, Adlerfarn, Waldreitgras und Schmalblättrige Hainsimse.
Wie wird die Beleuchtungsstärke gemessen?
Die Beleuchtungsstärke wird in Lux (lx) gemessen.
Was ist der Unterschied zwischen Sonnenpflanzen und Schattenpflanzen in Bezug auf den Lichtgenuss?
Sonnenpflanzen benötigen volles Tageslicht (100% Lichtgenuss) und wachsen nur an unbeschatteten Standorten, während Schattenpflanzen Lichtgenuss stets unter 100% haben und in beschatteten Bereichen wachsen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2000, Sammlung von Erklärungen zu bestimmten Begriffen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99970