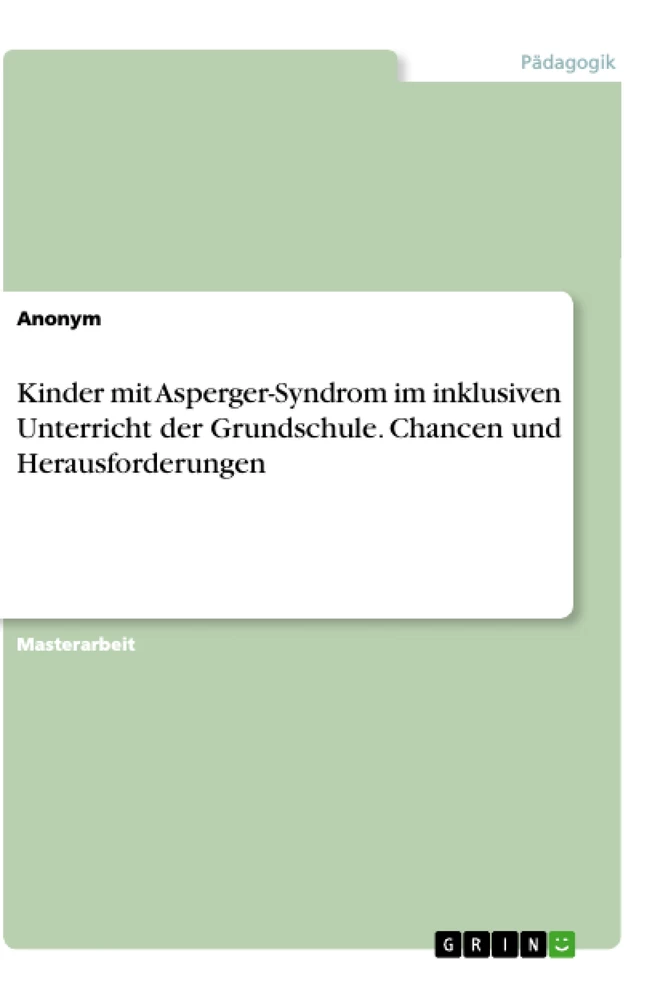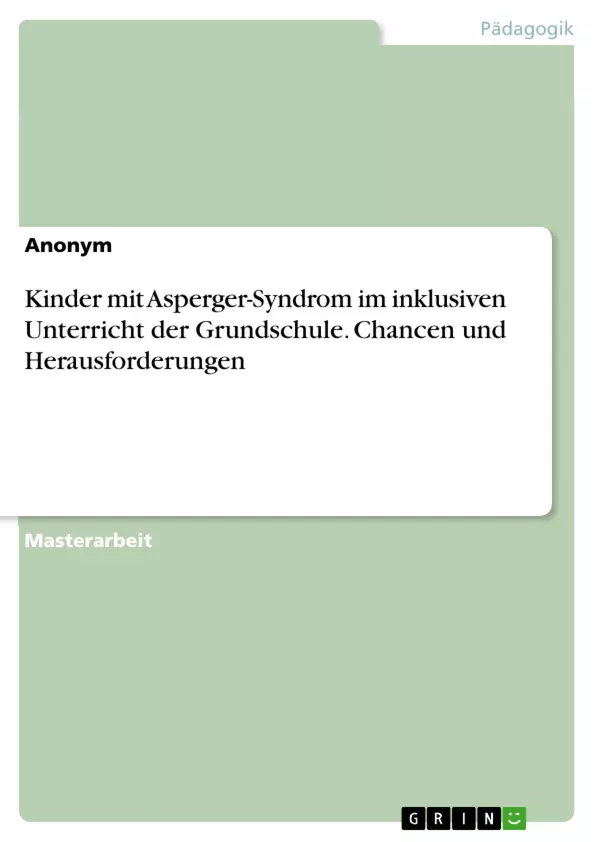Diese Arbeit widmet sich vorrangig der Frage, wie Rahmenbedingungen und Förderangebote in einer inklusiven Grundschule zu gestalten sind, damit Kinder mit Asperger-Syndrom davon profitieren können. Hierfür ist es wichtig zu wissen, wie sich Autismus auf das Lernen, das soziale Verständnis und die Selbstständigkeit auswirkt. Auf der Grundlage einer Auseinandersetzung mit einschlägiger Literatur soll daher Einblick in die Komplexität des Phänomens gegeben und Voraussetzungen aufgezeigt werden, die für die Teilhabe des Einzelnen am Lernprozess unverzichtbar sind.
Um den Inklusionsgedanken für eine lern- und entwicklungsförderliche Bildungsarbeit mit Asperger-AutistInnen nutzen zu können, soll zu Beginn der Frage nachgegangen werden, welche generellen gesellschaftlichen und bildungspolitischen Orientierungen damit einhergehen. Hierzu sind die Grundsätze der UN-Behindertenrechtskonvention und relevante Konzepte in den Blick zu nehmen, die Aufschluss über einen angemessenen Umgang mit Verschiedenheit geben. Davon ausgehend können Überlegungen dazu angestellt werden, wie inklusive Schulkontexte ausgestaltet werden müssen, damit alle Kinder und Jugendliche die Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Inklusion
- 2.1 Die Integrationsbewegung - ein historischer Rückblick
- 2.2 Verschiedenheit und Gleichberechtigung in der Pädagogik der Vielfalt
- 2.3 Entwicklung inklusiver Prozesse im internationalen Kontext
- 2.4 Irritationen um das Verständnis von Inklusion
- 2.5 inklusive Schulentwicklung unter Berücksichtigung der Situation in Deutschland
- 3. Autismus und das Asperger-Syndrom
- 3.1 Zuordnung des Asperger-Syndroms in der ICD-10
- 3.2 Historischer Abriss
- 3.3 Medizinische Klassifikation von Autismus
- 3.3.1 Erscheinungsformen nach der ICD-10
- 3.3.2 Autismus-Spektrum-Störungen der DSM-5
- 3.4 Prävalenz
- 3.5 Kritische Betrachtung einer Kategorisierung anhand bestehender Klassifikationssysteme
- 4. inklusive Beschulung von Kindern mit Asperger-Syndrom
- 4.1 Besonderheiten von SchülerInnen mit Asperger-Syndrom
- 4.1.1 Soziales und emotionales Verhalten
- 4.1.2 Sprachliche Ausdrucksweisen und Kommunikation
- 4.1.3 Wahrnehmung
- 4.1.4 Lernverhalten und Denkweisen
- 4.1.5 Motorik
- 4.1.6 Routinen und Interessen
- 4.1.7 Autistische Verhaltensweisen unter dem Aspekt der sozialen Umwelt
- 4.2 Chancen einer frühen Förderung in der inklusiven Grundschule
- 4.2.1 Teilhabe entwickeln durch eine inklusive Pädagogik
- 4.2.2 Die Rolle und Haltung der Lehrkraft
- 4.2.3 Die Relevanz stabiler Peer-Beziehungen
- 4.1 Besonderheiten von SchülerInnen mit Asperger-Syndrom
- 5. Erfolgreiche Gestaltung der inklusiven Schule
- 5.1 Schulorganisatorische Rahmenbedingungen
- 5.2 Kontextbedingungen aus der Perspektive TEACCH
- 5.2.1 Strukturierung
- 5.2.2 Visualisierung
- 5.2.3 Routinen
- 5.2.4 TEACCH als Best-Practice-Konzept?
- 5.3 Ermöglichung von Teilhabe im Unterricht
- 5.3.1 Förderung sozialer Kompetenzen
- 5.3.2 Bildungsräume der Anerkennung schaffen
- 5.4 Erweiterte Unterstützungsplanung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Chancen und Herausforderungen der inklusiven Beschulung von Kindern mit Asperger-Syndrom in der Grundschule. Ziel ist es, Lehrerinnen und Lehrern einen Überblick über die Eigenschaften von Kindern mit Asperger-Syndrom zu geben und Anregungen für den Umgang mit deren Entwicklungsbesonderheiten zu liefern. Die Arbeit soll dazu beitragen, die Herausforderungen als Chance zu verstehen und den Unterricht durch gezielte Fördermaßnahmen für alle SchülerInnen zu optimieren.
- Inklusion im Kontext der Pädagogik der Vielfalt
- Das Asperger-Syndrom: Definition, Erscheinungsformen und Prävalenz
- Besonderheiten von Kindern mit Asperger-Syndrom im schulischen Kontext
- Chancen und Herausforderungen der inklusiven Beschulung
- Gestaltung einer erfolgreichen inklusiven Schule für Kinder mit Asperger-Syndrom
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Ausgangssituation der Autorin, die im Rahmen ihres Studiums und Praktikums mit der Frage nach dem Umgang mit Heterogenität im Unterricht konfrontiert wurde. Der Fokus liegt auf Kindern mit Asperger-Syndrom, da diese Gruppe oft unzureichend berücksichtigt wird. Die Arbeit zielt darauf ab, Lehrkräften einen Überblick über die Besonderheiten von Kindern mit Asperger-Syndrom zu bieten und Handlungsempfehlungen für eine inklusive Beschulung zu geben. Die Autorin betont die Intention, Herausforderungen als Chancen zu verstehen und den Unterricht für alle SchülerInnen zu optimieren.
2. Inklusion: Dieses Kapitel bietet einen historischen Rückblick auf die Integrationsbewegung und beleuchtet das Verständnis von Verschiedenheit und Gleichberechtigung in der Pädagogik der Vielfalt. Es untersucht die Entwicklung inklusiver Prozesse im internationalen Kontext, thematisiert Irritationen beim Verständnis von Inklusion und analysiert die inklusive Schulentwicklung in Deutschland. Der Abschnitt zeichnet ein umfassendes Bild der Herausforderungen und des derzeitigen Standes der Inklusion im deutschen Bildungssystem.
3. Autismus und das Asperger-Syndrom: Dieses Kapitel ordnet das Asperger-Syndrom in der ICD-10 ein und gibt einen historischen Abriss seiner Erforschung. Es beschreibt die medizinische Klassifikation von Autismus gemäß ICD-10 und DSM-5, beleuchtet die Prävalenz und diskutiert kritisch die Kategorisierung anhand bestehender Klassifikationssysteme. Es bietet somit ein fundiertes Verständnis des Asperger-Syndroms im Kontext anderer autistischer Störungen.
4. inklusive Beschulung von Kindern mit Asperger-Syndrom: Dieser Abschnitt beschreibt detailliert die Besonderheiten von SchülerInnen mit Asperger-Syndrom in Bezug auf soziales und emotionales Verhalten, sprachliche Ausdrucksweisen, Wahrnehmung, Lernverhalten, Motorik, Routinen und Interessen, sowie deren autistische Verhaltensweisen im sozialen Kontext. Weiterhin werden die Chancen einer frühen Förderung in der inklusiven Grundschule, die Rolle der Lehrkraft und die Bedeutung stabiler Peer-Beziehungen behandelt. Das Kapitel betont die Notwendigkeit individueller Förderung und die Bedeutung des sozialen Umfelds.
5. Erfolgreiche Gestaltung der inklusiven Schule: Dieses Kapitel beleuchtet schulorganisatorische Rahmenbedingungen und Kontextbedingungen aus der Perspektive des TEACCH-Ansatzes. Es beschreibt die Bedeutung von Strukturierung, Visualisierung und Routinen im Unterricht und diskutiert das TEACCH-Konzept als Best-Practice-Beispiel. Darüber hinaus werden Möglichkeiten der Teilhabe im Unterricht, die Förderung sozialer Kompetenzen und die Schaffung von Bildungsräumen der Anerkennung betrachtet. Schließlich wird die erweiterte Unterstützungsplanung als wichtiges Instrument für inklusive Beschulung vorgestellt.
Schlüsselwörter
Inklusion, Asperger-Syndrom, Autismus, inklusive Pädagogik, Grundschule, Förderung, Herausforderungen, Chancen, TEACCH, soziale Kompetenz, Schulentwicklung, Heterogenität, Lehrerrolle, Peer-Beziehungen.
Häufig gestellte Fragen zu: Inklusive Beschulung von Kindern mit Asperger-Syndrom
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über die inklusive Beschulung von Kindern mit Asperger-Syndrom. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf den Chancen und Herausforderungen der inklusiven Beschulung in der Grundschule und bietet Anregungen für Lehrkräfte.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Kernbereiche: Inklusion im Kontext der Pädagogik der Vielfalt, das Asperger-Syndrom (Definition, Erscheinungsformen, Prävalenz), die Besonderheiten von Kindern mit Asperger-Syndrom im schulischen Kontext, die Chancen und Herausforderungen der inklusiven Beschulung und die Gestaltung einer erfolgreichen inklusiven Schule für Kinder mit Asperger-Syndrom. Es werden historische Aspekte der Integrationsbewegung, medizinische Klassifikationen (ICD-10 und DSM-5) sowie der TEACCH-Ansatz eingehend betrachtet.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument ist in fünf Kapitel gegliedert: 1. Einleitung; 2. Inklusion (mit Unterkapiteln zur Integrationsbewegung, Pädagogik der Vielfalt, internationaler Kontext und Inklusion in Deutschland); 3. Autismus und das Asperger-Syndrom (einschließlich medizinischer Klassifizierung und Prävalenz); 4. inklusive Beschulung von Kindern mit Asperger-Syndrom (mit Fokus auf die Besonderheiten dieser Kinder und Chancen der frühen Förderung); 5. Erfolgreiche Gestaltung der inklusiven Schule (mit Betrachtung schulorganisatorischer Rahmenbedingungen, des TEACCH-Ansatzes und der erweiterten Unterstützungsplanung).
Welche Besonderheiten von Kindern mit Asperger-Syndrom werden beschrieben?
Das Dokument beschreibt detailliert die Besonderheiten von Kindern mit Asperger-Syndrom in Bezug auf soziales und emotionales Verhalten, sprachliche Ausdrucksweisen und Kommunikation, Wahrnehmung, Lernverhalten und Denkweisen, Motorik, Routinen und Interessen sowie deren autistische Verhaltensweisen im sozialen Kontext.
Was ist der TEACCH-Ansatz und welche Rolle spielt er?
Der TEACCH-Ansatz wird als Best-Practice-Beispiel für die inklusive Beschulung von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen vorgestellt. Das Dokument beleuchtet die Bedeutung von Strukturierung, Visualisierung und Routinen im Unterricht im Rahmen dieses Ansatzes.
Welche Rolle spielt die Lehrkraft in der inklusiven Beschulung?
Die Rolle der Lehrkraft wird als zentral für eine erfolgreiche inklusive Beschulung hervorgehoben. Das Dokument betont die Notwendigkeit individueller Förderung und die Bedeutung der Haltung der Lehrkraft gegenüber Kindern mit Asperger-Syndrom sowie die Relevanz stabiler Peer-Beziehungen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren das Dokument?
Schlüsselwörter sind: Inklusion, Asperger-Syndrom, Autismus, inklusive Pädagogik, Grundschule, Förderung, Herausforderungen, Chancen, TEACCH, soziale Kompetenz, Schulentwicklung, Heterogenität, Lehrerrolle, Peer-Beziehungen.
Für wen ist dieses Dokument gedacht?
Dieses Dokument richtet sich primär an Lehrerinnen und Lehrer, die einen Überblick über die inklusive Beschulung von Kindern mit Asperger-Syndrom erhalten und Anregungen für den Umgang mit deren Entwicklungsbesonderheiten suchen.
Was ist das Ziel des Dokuments?
Das Ziel des Dokuments ist es, Lehrerinnen und Lehrern einen Überblick über die Eigenschaften von Kindern mit Asperger-Syndrom zu geben und Anregungen für den Umgang mit deren Entwicklungsbesonderheiten zu liefern. Es soll dazu beitragen, die Herausforderungen als Chance zu verstehen und den Unterricht durch gezielte Fördermaßnahmen für alle SchülerInnen zu optimieren.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Kinder mit Asperger-Syndrom im inklusiven Unterricht der Grundschule. Chancen und Herausforderungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/999732