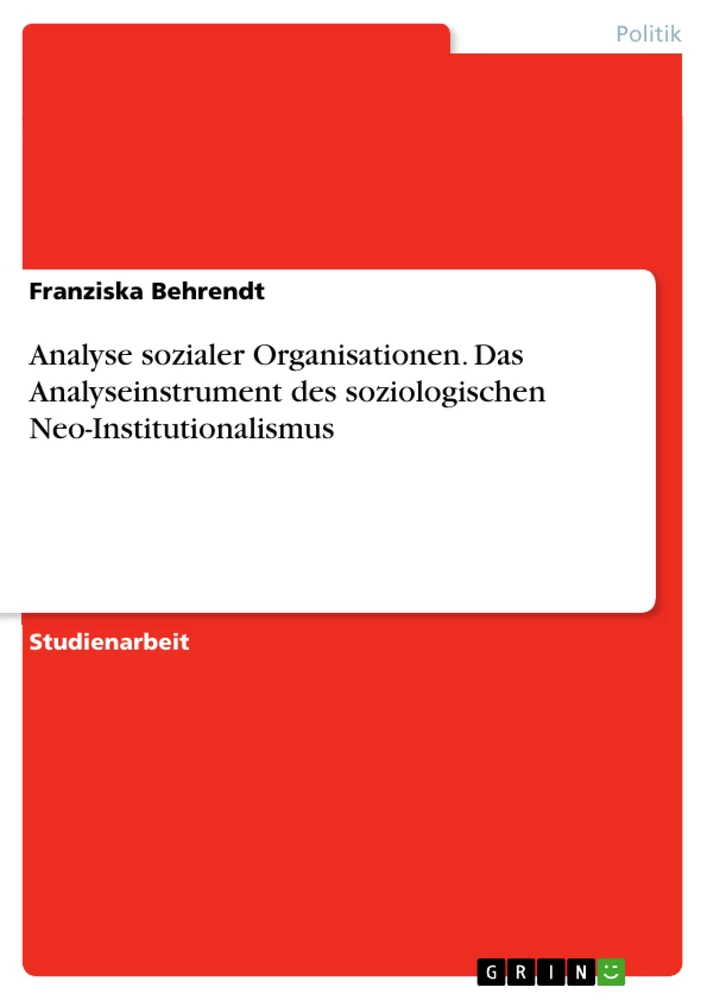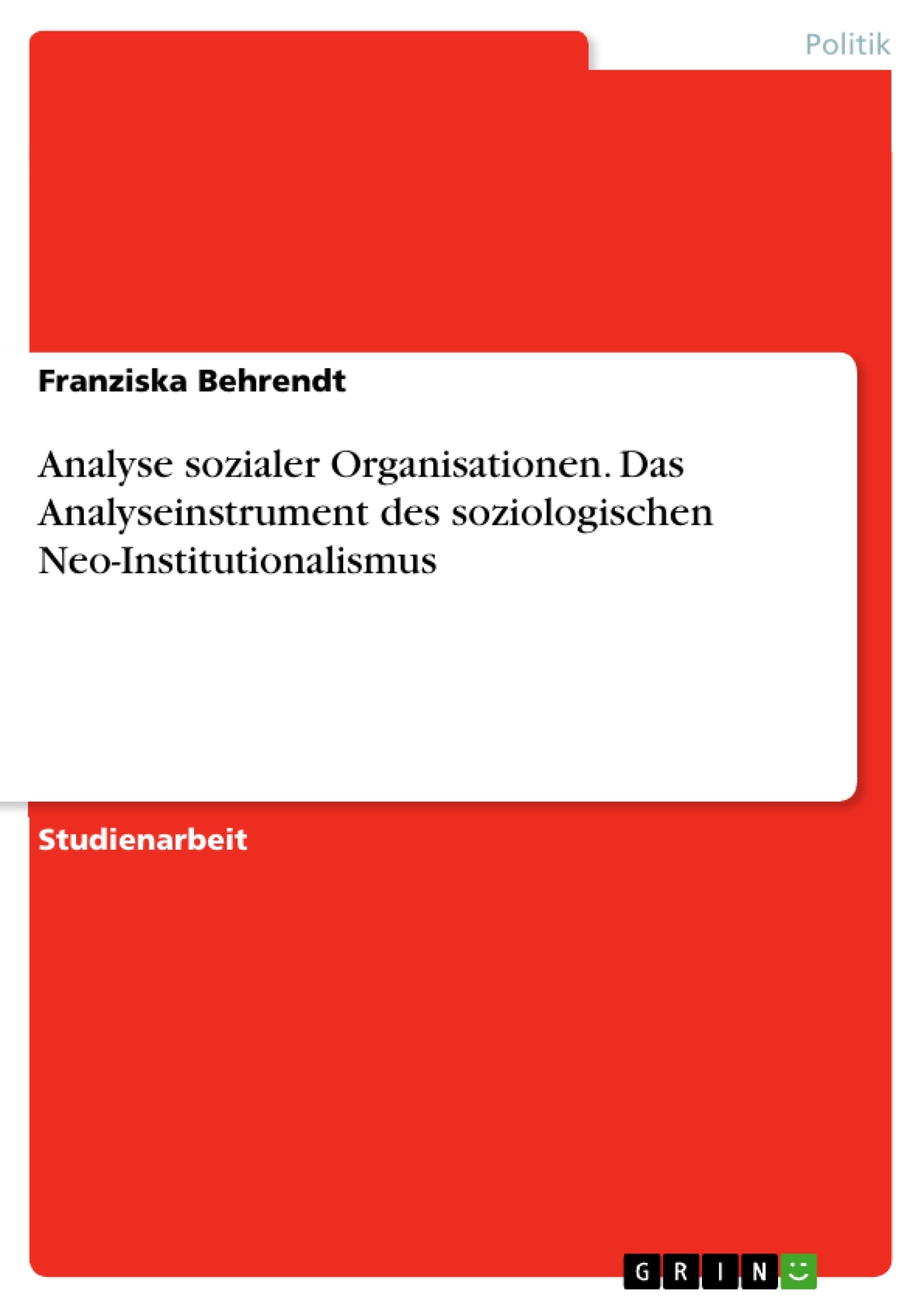In der Arbeit soll untersucht werden, welche Möglichkeiten und Begrenzungen durch den soziologischen Neo-Institutionalismus im Hinblick auf die Untersuchung sozialer Organisationen eröffnet werden können. Organisationstheorien haben den Anspruch, die Existenz sowie Funktionsweisen und enthaltenen Strukturen von Organisationen zu erklären, zu untersuchen und analysierbar zu machen. Während in den 1950er und 1960er-Jahren vor allem marktorientierte Organisationstheorien vorherrschten, entwickelte sich in den 1970er Jahren eine andere Erklärungsperspektive. Diese eignet sich besonders gut für soziale Organisationen, die vor allem Ziele auf (zwischen-)menschlichen Ebenen verfolgen und weniger ökonomischen und effizienzorientierten Zielen folgen. Institutionalistische Ansätze beziehen sich dabei auf kognitive, kulturelle und normative Faktoren, welche die Entstehung und Entwicklung von Organisationen nachhaltig beeinflussen. Untersuchungsgegenstand dieser Ansätze sind Institutionen (die ganz allgemein als (un-)bewusste Handlungsmuster oder Regelsysteme verstanden werden können).
Grundlage dieser Ausarbeitung soll dabei der soziologische NI sein. In diesem Ansatz werden Organisationen als Teil einer organisationalen Umwelt verstanden, welche als soziale Systeme innerhalb einer durch Regeln, Normen und Anforderungen gestalteten Umwelt immer wieder Veränderungs- und Anpassungsleistungen vornehmen müssen und vorrangig durch Institutionen gestaltet werden. Ziel der Arbeit ist die Erarbeitung der theoretischen Grundlagen des NI. Daneben gilt es herauszustellen, welchen Einflüssen Organisationen Sozialer Arbeit unterliegen und welchen Einfluss eine zunehmende Effizienzorientierung zur Professionalisierung Sozialer Arbeit haben kann. Um dies umzusetzen, werden zunächst die verschiedenen Grundströmungen und theoretischen Ansätze des soziologischen NI dargestellt sowie auf grundlegende Begrifflichkeiten eben dieser eingegangen. Es werden immer wieder Bezüge zu der Profession Sozialer Arbeit hergestellt und am Ende der Ausarbeitung steht eine fundierte Diskussion zu der genannten Thematik. Abschließend soll die eingangs gestellte Fragestellung beantwortet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fragestellung
- Der Soziologische Neo-Institutionalysmus als theoretischer Bezugsrahmen
- Die Makroinstitutionalistische Perspektive
- Der Institutionenbegriff
- Organisationen
- Legitimationsprozesse- und Strategien
- Lose Koppelung
- Isomorphismus
- Isomorphismus durch Zwang (coercive Isomorphism)
- Isomorphismus durch Mimetische Prozesse (mimetic isomorphism)
- Isomorphie durch normativen Druck
- Profession als institutioneller Bezugsrahmen
- Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem soziologischen Neo-Institutionalismus und dessen Möglichkeiten und Grenzen für die Analyse Sozialer Organisationen. Der Fokus liegt darauf, die Entstehung und Entwicklung von Organisationen im Kontext von Regeln, Normen und Anforderungen zu verstehen. Die Arbeit untersucht die theoretischen Grundlagen des Neo-Institutionalismus und beleuchtet, welchen Einflüssen Organisationen Sozialer Arbeit unterliegen und wie sich zunehmende Effizienzorientierung auf die Professionalisierung Sozialer Arbeit auswirkt.
- Theoretische Grundlagen des Soziologischen Neo-Institutionalismus
- Einfluss von Institutionen auf Organisationen Sozialer Arbeit
- Professionalisierung Sozialer Arbeit im Kontext von Effizienzorientierung
- Analyse formaler und non-formaler Strukturen in Organisationen Sozialer Arbeit
- Der Einfluss der Profession Sozialer Arbeit auf Organisationsstrukturen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und erläutert den theoretischen Rahmen des Soziologischen Neo-Institutionalismus. Sie definiert den Untersuchungsgegenstand und skizziert die Ziele der Arbeit.
- Der Soziologische Neo-Institutionalysmus als theoretischer Bezugsrahmen: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Darstellung des Soziologischen Neo-Institutionalismus und seiner wichtigsten Strömungen. Es werden grundlegende Begrifflichkeiten, wie der Institutionenbegriff, Organisationen und Legitimationsprozesse erläutert.
- Die Makroinstitutionalistische Perspektive: Dieses Kapitel fokussiert auf die Betrachtung der Organisationsumwelt und ihren Einfluss auf Organisationen. Es werden verschiedene Ansätze und ihre jeweiligen Schwerpunkte vorgestellt, insbesondere die Bedeutung von Normen, Gesetzen und gesellschaftlichen Haltungen.
Schlüsselwörter
Der Soziologische Neo-Institutionalismus, Organisationstheorie, Soziale Organisationen, Institutionen, Organisationsumwelt, Legitimationsprozesse, Isomorphismus, Professionalisierung, Effizienzorientierung, Soziale Arbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der soziologische Neo-Institutionalismus (NI)?
Ein theoretischer Ansatz, der erklärt, dass Organisationen nicht nur nach Effizienz streben, sondern sich an kulturelle Erwartungen, Normen und Regeln ihrer Umwelt anpassen, um Legitimität zu erlangen.
Warum ist der NI für soziale Organisationen relevant?
Soziale Organisationen verfolgen oft schwer messbare zwischenmenschliche Ziele. Der NI hilft zu verstehen, wie sie sich in einem Umfeld aus rechtlichen und gesellschaftlichen Anforderungen behaupten.
Was bedeutet "Isomorphismus" in Organisationen?
Isomorphismus beschreibt den Prozess, durch den Organisationen einer Branche sich immer ähnlicher werden, sei es durch Zwang, Nachahmung oder professionelle Normen.
Was versteht man unter "loser Koppelung"?
Organisationen trennen oft ihre formale Struktur (die nach außen Legitimität sichert) von der tatsächlichen Arbeitspraxis, um flexibel auf widersprüchliche Anforderungen reagieren zu können.
Welchen Einfluss hat die Professionalisierung auf die Soziale Arbeit?
Eine zunehmende Effizienzorientierung zwingt soziale Organisationen dazu, Managementpraktiken zu übernehmen, was zu Spannungen mit professionellen ethischen Standards führen kann.
Was ist die makroinstitutionalistische Perspektive?
Sie betrachtet die gesamte Organisationsumwelt (Staat, Gesellschaft, Professionen) als Quelle von Regeln, die die Struktur einzelner Organisationen prägen.
- Quote paper
- Franziska Behrendt (Author), 2020, Analyse sozialer Organisationen. Das Analyseinstrument des soziologischen Neo-Institutionalismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/999774