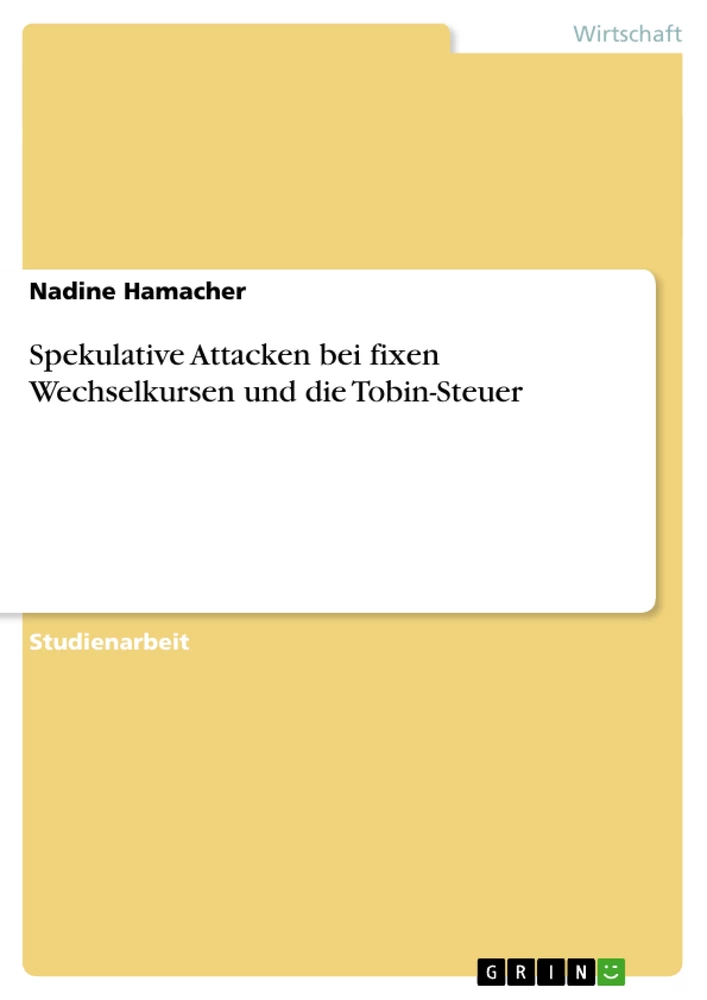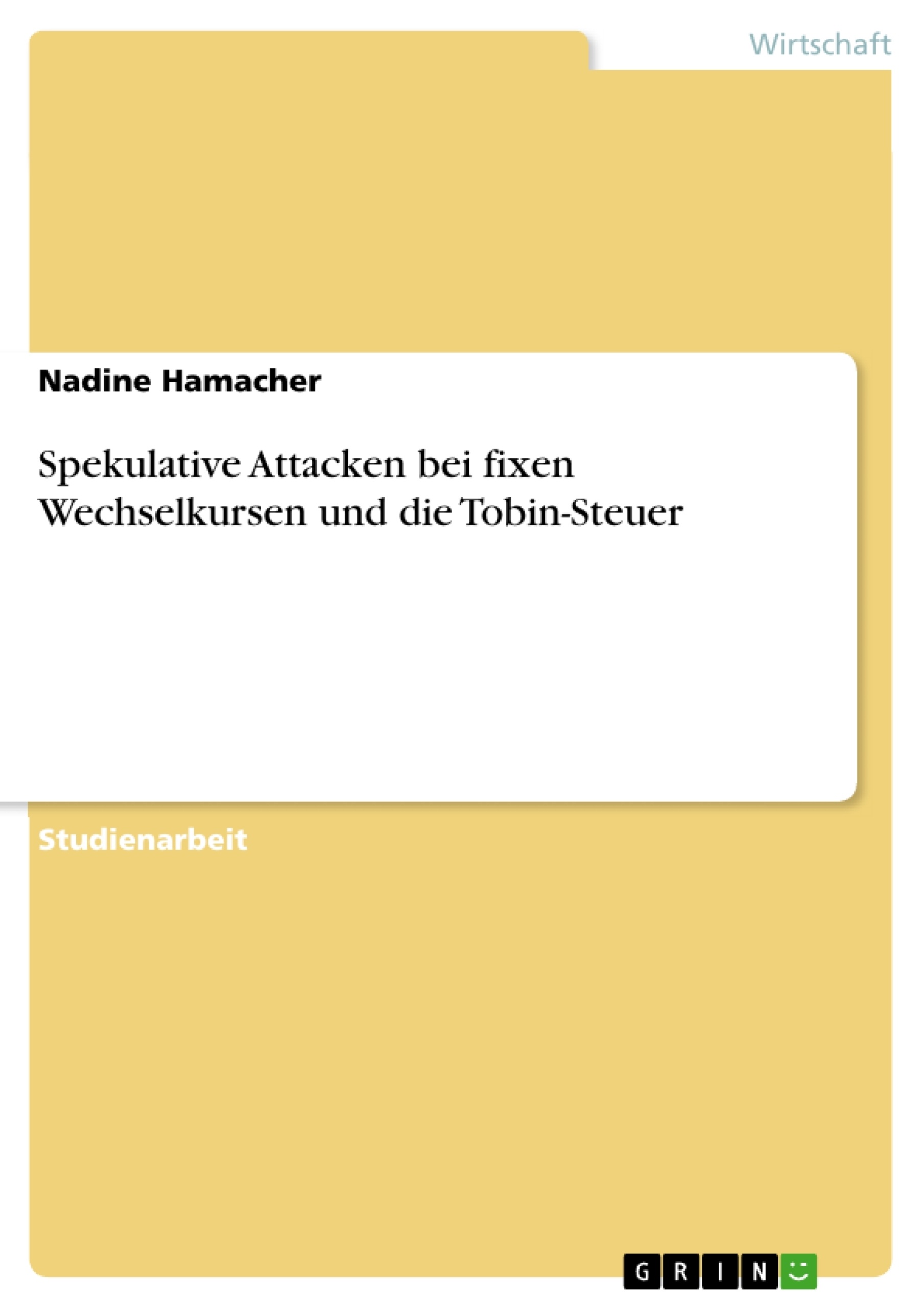Die Ursache spekulativer Attacken ist ein in der jüngeren ökonomischen Literatur umfangreich diskutiertes Phänomen. Im Laufe der Zeit wurden unterschiedliche Modellansätze zur Erklärung spekulativer Attacken verfolgt und verschiedene Möglichkeiten zu deren Vermeidung präsentiert. Einen wichtigen Vorstoß stellt in diesem Zusammenhang die Tobin-Steuer dar, bei der Finanztransaktionen mit dem Ausland mit einer geringen Steuer belegt werden. Indem im Rahmen dieser Arbeit traditionelle Modellansätze hinsichtlich der Tobin-Steuer modifiziert und analysiert werden, wird gezeigt, dass die Tobin-Steuer zwar ein geeignetes Instrument darstellt, Einnahmen zu erwirtschaften, die zum Beispiel zur Entwicklungshilfe verwendet werden können, jedoch zur Vermeidung spekulativer Attacken nur sehr bedingt geeignet ist.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Stabilisierende und destabilisierende Spekulation
- Spekulation bei flexiblen Wechselkursen
- Spekulation bei fixen Wechselkursen
- Spekulation in einem einfachen spieltheoretischen Modell
- Ökonomisches Modell einer spekulativen Attacke
- Aufbau und Analyse des Grundmodells
- Grundzüge der Tobin-Steuer
- Analyse des Grundmodells unter Berücksichtigung der Tobin-Steuer
- Kritische Beurteilung der Tobin-Steuer
- Trennung von destabilisierenden und stabilisierenden Transaktionen
- Optimale Höhe und Geltungsbereich der Tobin-Steuer
- Verwaltung und Verwendung der Einnahmen der Tobin-Steuer
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Tobin-Steuer als Instrument zur Vermeidung spekulativer Attacken gegen ein Festkurssystem. Dabei werden traditionelle Modellansätze hinsichtlich der Tobin-Steuer modifiziert und analysiert. Die Arbeit zeigt, dass die Tobin-Steuer zwar zur Erwirtschaftung von Einnahmen geeignet ist, jedoch ihre Effektivität bei der Vermeidung von spekulativen Attacken begrenzt ist.
- Spekulative Attacken bei fixen Wechselkursen
- Die Tobin-Steuer als Instrument zur Vermeidung von spekulativen Attacken
- Analyse des Einflusses der Tobin-Steuer auf die Stabilität eines Festkurssystems
- Kritische Beurteilung der Durchführbarkeit und Effizienz der Tobin-Steuer
- Beurteilung der Rolle der Tobin-Steuer in der aktuellen Wirtschaftspolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt die Problemstellung der Arbeit dar und erläutert den Hintergrund des wachsenden Interesses an der Tobin-Steuer in den letzten Jahren. Es wird auf die Zunahme von spekulativen Transaktionen und deren potenzielle destabilisierende Wirkung auf Währungssysteme hingewiesen.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den grundlegenden Konzepten der Währungsspekulation. Es werden die Unterschiede zwischen stabilisierender und destabilisierender Spekulation aufgezeigt und die Rolle der Zentralbank bei der Fixierung von Wechselkursen erklärt.
Das dritte Kapitel analysiert ein ökonomisches Modell einer spekulativen Attacke. Es werden die Auswirkungen der Tobin-Steuer auf die Stabilität des Festkurssystems untersucht und die Grenzen ihrer Effektivität im Kampf gegen spekulative Attacken herausgestellt.
Das vierte Kapitel befasst sich kritisch mit der Durchführbarkeit der Tobin-Steuer. Es werden die Probleme bei der Trennung von destabilisierenden und stabilisierenden Transaktionen, die optimale Höhe und der Geltungsbereich der Steuer sowie die Verwaltung und Verwendung der Einnahmen diskutiert.
Schlüsselwörter
Spekulative Attacken, Tobin-Steuer, Festkurssystem, Währungsspekulation, Devisenmarkt, Stabilität, Finanzmärkte, Wirtschaftspolitik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Tobin-Steuer?
Die Tobin-Steuer ist eine geringe Steuer auf Devisentransaktionen, die ursprünglich vorgeschlagen wurde, um kurzfristige Währungsspekulationen einzudämmen.
Kann die Tobin-Steuer spekulative Attacken verhindern?
Die Arbeit zeigt, dass die Steuer zwar Einnahmen generiert, zur Vermeidung massiver spekulativer Attacken bei fixen Wechselkursen jedoch nur sehr bedingt geeignet ist.
Was unterscheidet stabilisierende von destabilisierender Spekulation?
Stabilisierende Spekulation gleicht Marktschwankungen aus, während destabilisierende Spekulation Währungskrisen verschärfen kann, indem sie auf den Fall eines Festkurssystems setzt.
Welche Probleme gibt es bei der Umsetzung der Tobin-Steuer?
Schwierigkeiten liegen in der Trennung nützlicher von schädlichen Transaktionen, der Festlegung der optimalen Steuerhöhe und der Notwendigkeit eines weltweiten Geltungsbereichs.
Wofür könnten die Einnahmen der Tobin-Steuer verwendet werden?
Oft wird vorgeschlagen, die Einnahmen für internationale Entwicklungshilfe oder globale öffentliche Aufgaben einzusetzen.
- Quote paper
- Nadine Hamacher (Author), 2002, Spekulative Attacken bei fixen Wechselkursen und die Tobin-Steuer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9999