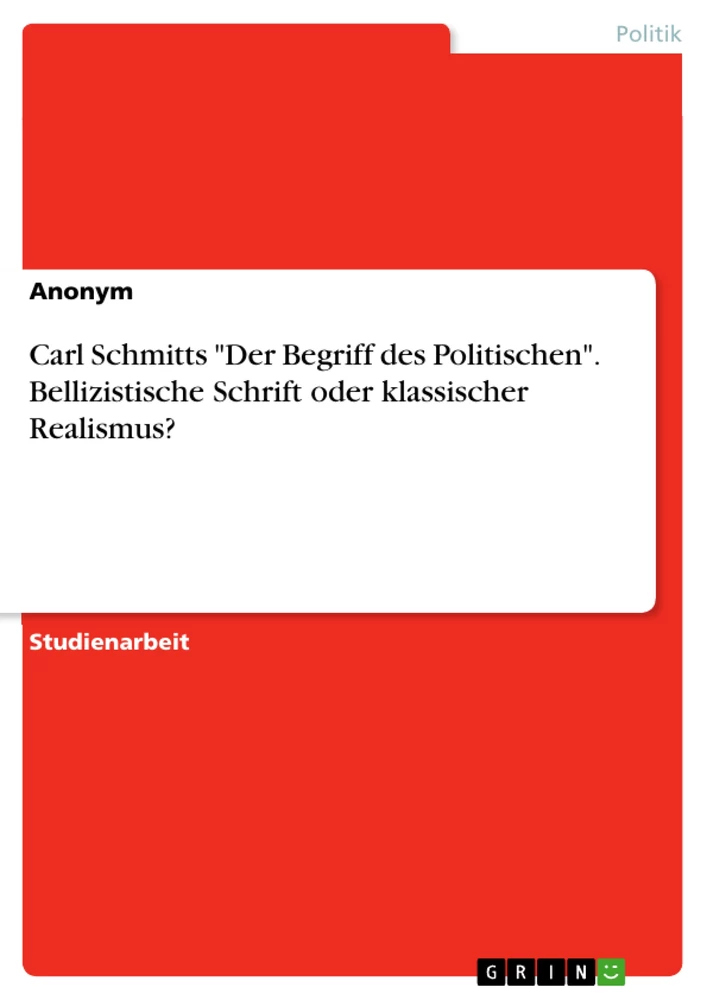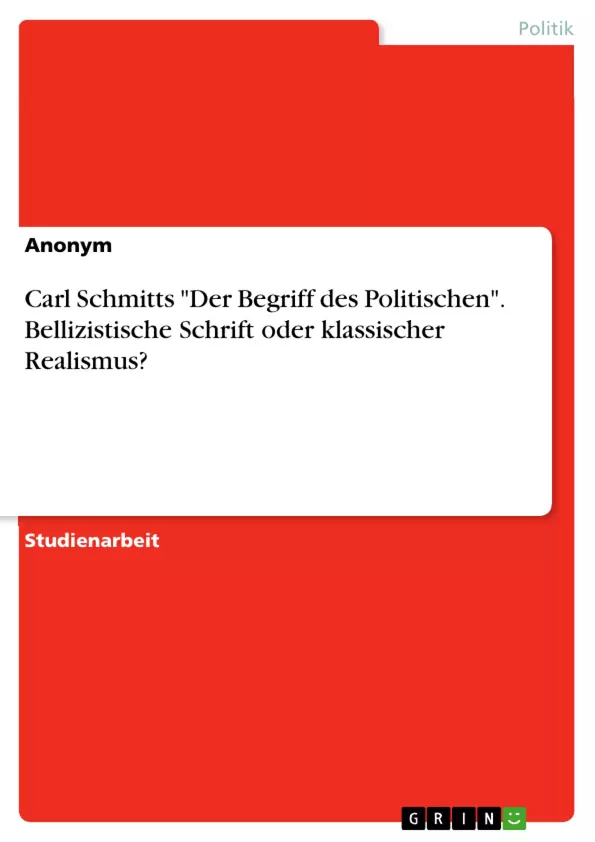Diese Arbeit soll der Frage nachgehen, ob das Werk "Der Begriff des Politischen" (1932), als ein realistischer oder ein bellizistischer Text angesehen werden kann. Um dieser Frage nachzugehen, werden zunächst die beiden Begriffe Realismus und Bellizismus genauer definiert, beziehungsweise werden die wichtigsten Merkmale der Konzepte ausgemacht, was die Voraussetzung ist, um das Werk einordnen zu können. Als nächster Schritt soll der Inhalt des Werkes beschrieben werden, um die zentralen Punkte hervorzuheben. Dies ist notwendig, um anschließend die verschiedenen Grundannahmen, welche Schmitt in seinem Werk trifft, in bellizistische, beziehungsweise realistische zuzuteilen, um daraufhin ein Fazit zu ziehen, in welche der beiden Richtungen Carl Schmitts Werk einzuordnen ist.
Der Realismus zählt neben dem Idealismus/Liberalismus und Sozialkonstruktivismus zu den drei Metatheorien der internationalen Beziehungen. Ein markantes Merkmal des Realismus ist es, dass er den Frieden nur als einen vorübergehenden, zerbrechlichen Zustand im internationalen System bezeichnet. So stehen die Sicherheit und das Streben nach Macht im Vordergrund, was einen permanenten Frieden zwischen den einzelnen Staaten verhindert. Es ist außerdem erkennbar, dass in realistischen Werken, wie zum Beispiel in Machiavellis "Der Fürst" oder in "The tragedy of great power politics" von John Mearsheimer, das Militär eine zentrale Rolle einnimmt. Diese Überschneidung zwischen Realismus und Bellizismus ist besonders beim politischen Philosophen Carl Schmitt ein Streitpunkt in der politischen Wissenschaft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen
- Realismus
- Bellizismus
- Carl Schmitts „der Begriff des Politischen“
- Zusammenfassung des Inhaltes
- Bellizistische Elemente
- Realistische Elemente
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Carl Schmitts Werk „der Begriff des Politischen“ (1932) hinsichtlich seiner Positionierung innerhalb der Theorie der internationalen Beziehungen. Ziel ist es, zu ergründen, ob das Werk als realistischer oder bellizistischer Text einzuordnen ist.
- Definition der Begriffe Realismus und Bellizismus
- Analyse des Inhalts von Schmitts Werk
- Identifizierung und Zuordnung von bellizistischen und realistischen Elementen in Schmitts Argumentation
- Bewertung der Positionierung des Werkes innerhalb der internationalen Beziehungen
- Beurteilung der Relevanz von Schmitts Werk für die aktuelle Debatte über die Rolle von Krieg und Gewalt in der Politik
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und erläutert die Relevanz der Fragestellung, ob Schmitts Werk als realistischer oder bellizistischer Text einzuordnen ist.
- Definitionen: Dieses Kapitel definiert die beiden zentralen Begriffe Realismus und Bellizismus, um einen klaren Rahmen für die Analyse von Schmitts Werk zu schaffen.
- Carl Schmitts „der Begriff des Politischen“: Dieses Kapitel behandelt den Inhalt von Schmitts Werk und stellt die wichtigsten Argumente und Grundannahmen des Autors dar.
Schlüsselwörter
Die Analyse von Carl Schmitts „der Begriff des Politischen“ erfordert die Auseinandersetzung mit den zentralen Begriffen des Realismus, Bellizismus und der Politischen Theorie. Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen wie der Rolle von Krieg und Gewalt in der Politik, der Definition des Politischen sowie der Analyse von Macht und Interessen im internationalen System.
Häufig gestellte Fragen
Ist Carl Schmitts Werk "Der Begriff des Politischen" bellizistisch?
Die Arbeit untersucht, ob der Text den Krieg verherrlicht (Bellizismus) oder ihn lediglich als unvermeidbare Realität der Politik beschreibt (Realismus).
Wie definiert Carl Schmitt das "Politische"?
Schmitt definiert das Politische durch die Unterscheidung von Freund und Feind sowie die potenzielle Möglichkeit des Kampfes.
Was sind die Merkmale des politischen Realismus bei Schmitt?
Dazu gehören die Annahme eines permanenten Machtstrebens, die zentrale Rolle des Militärs und die Sichtweise des Friedens als zerbrechlicher Zustand.
Warum ist Karl Popper ein wichtiger Kritiker?
Popper sieht in Schmitts Denken eine Gefahr für die offene Gesellschaft und ordnet solche Theorien als Wegbereiter totalitärer Strömungen ein.
Welche Rolle spielt die Sicherheit im internationalen System laut Schmitt?
Sicherheit und Selbsterhaltung des Staates stehen im Vordergrund, was einen dauerhaften Weltfrieden in seinem Modell nahezu unmöglich macht.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2019, Carl Schmitts "Der Begriff des Politischen". Bellizistische Schrift oder klassischer Realismus?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1000222