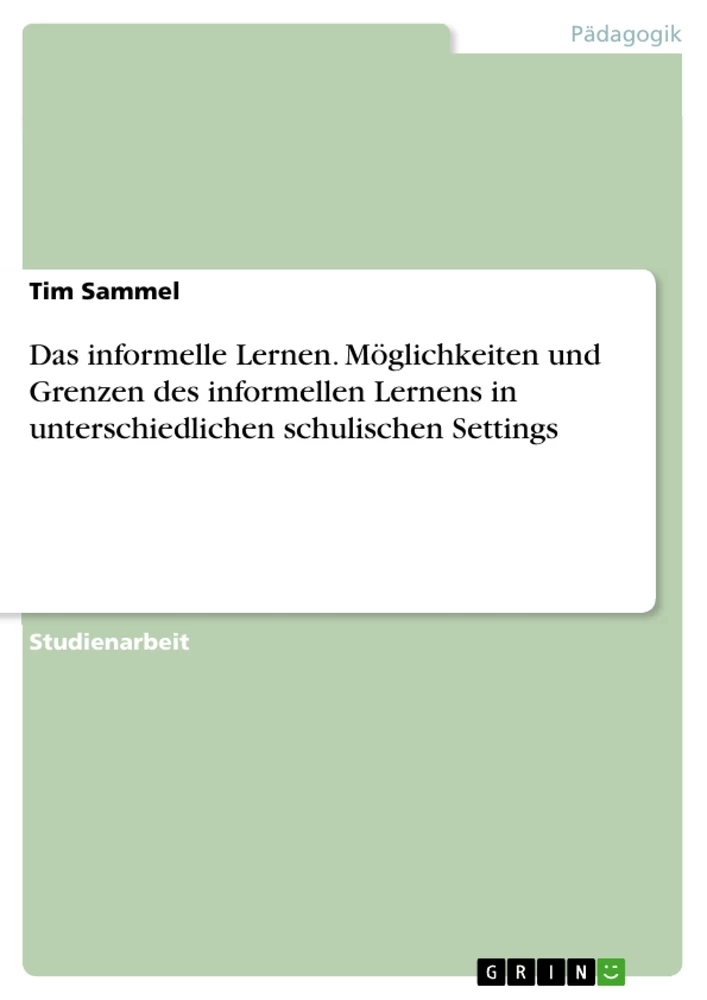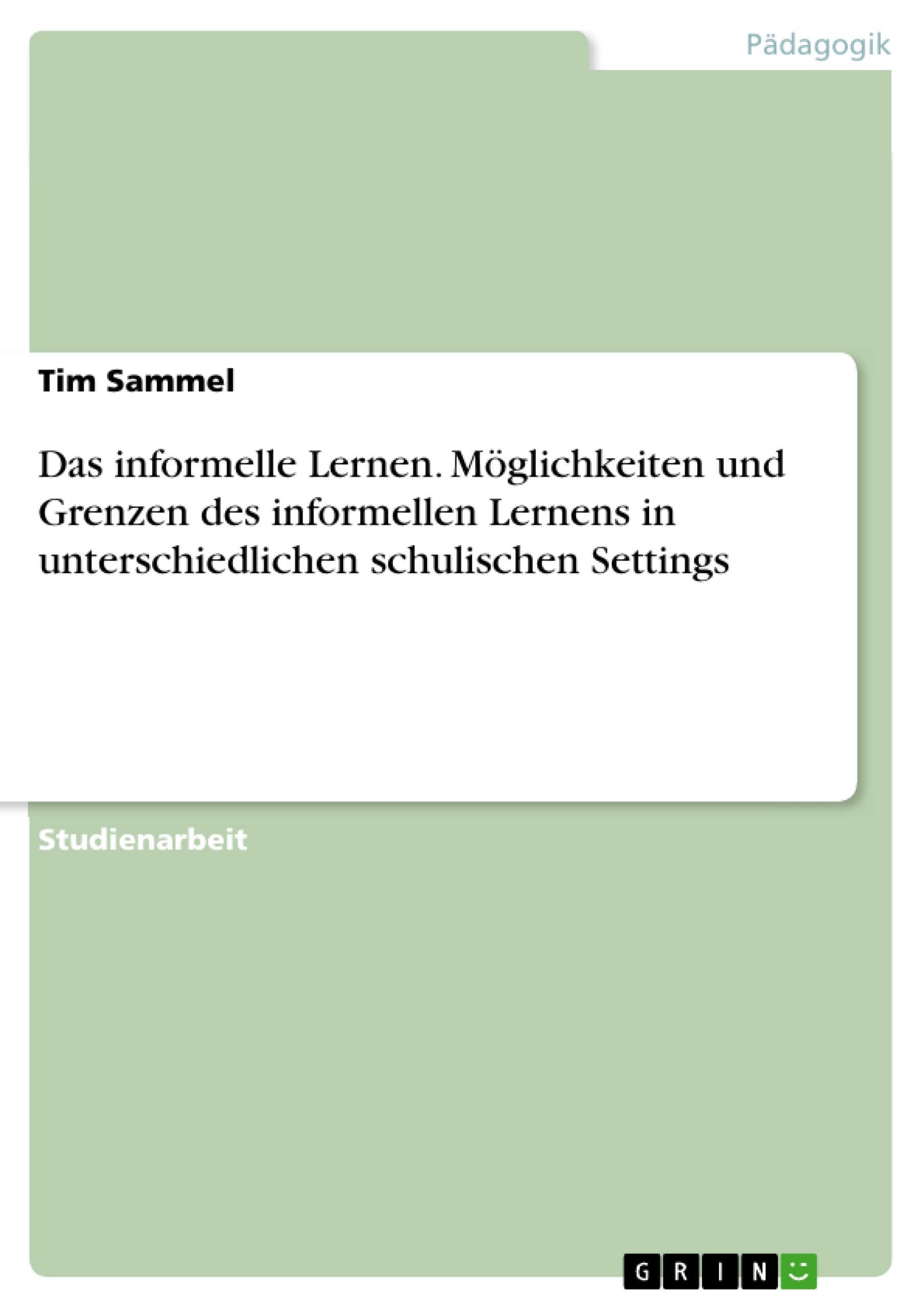In dieser Arbeit wird es um das informelle Lernen im schulischen Setting gehen. Es sollen vor allem die Möglichkeiten und Grenzen sowie gerade bei den Peer-Beziehungen auch auf Gefahren des informellen Lernens in verschiedenen schulischen Settings anhand aktueller Literatur und Untersuchungen gegeneinander abgewogen werden.
Im Seminarkontext spielt gerade das informelle Lernen eine recht zentrale Rolle. Im Seminar ging es um Lern- und Bildungsprozesse im Jugendalter. Gerade durch das informelle Lernen werden soziale Kompetenzen ausgebildet. Auch diese wurden im Seminar vertieft behandelt.
Wenn man die Literatur zum Thema informelles lernen betrachtet, fällt schnell auf, dass das Leben und Lernen der Kinder und Jugendlichen im meist außerschulischen Alltag, oft auch in der Familie, am Arbeitsplatz, also auch außerschulisch stattfindet. Außerdem steht die Beschäftigung mit neuen Medien oder Technologien außerhalb der Schule im Vordergrund. Dies erscheint auf den ersten Blick auch nicht weiter verwunderlich, da der Begriff des informellen Lernens gerade in Abgrenzung zu institutionalisierten Lern- und Bildungsprozessen entstand. Ältere Debatten und Standpunkte der Forschung plädierten dafür, das informelle Lernen strikt von den formalen Institutionen zu trennen, da es gerade durch das Nichtvorhandensein dieser organisatorischen Strukturen gekennzeichnet sei. Jüngere Debattenbeiträge hingegen, gehen davon aus, dass informelles Lernen auch in formalen Umgebungen stattfinden kann und auch stattfindet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Theorie des informellen Lernens in der Schule
- Möglichkeiten und Grenzen informellen Lernens in unterschiedlichen schulischen Settings
- Projektarbeit und Epochenunterricht
- Ganztagsangebote
- Unterrichtspausen und Peergroups
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit informellen Lernprozessen im schulischen Kontext. Ziel ist es, die Möglichkeiten und Grenzen informellen Lernens in verschiedenen Settings zu analysieren und die Bedeutung des informellen Lernens für die Schülerentwicklung zu beleuchten.
- Definition und Bedeutung des informellen Lernens in der Schule
- Der heimliche Lehrplan und seine Rolle im informellen Lernen
- Möglichkeiten und Grenzen des informellen Lernens in verschiedenen Settings (Projektarbeit, Epochenunterricht, Ganztagsangebote, Peergruppen)
- Risiken und Chancen des informellen Lernens
- Bedeutung des informellen Lernens für die Entwicklung sozialer Kompetenzen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema des informellen Lernens in der Schule. Dabei wird der Begriff des informellen Lernens definiert und in den schulischen Kontext eingeordnet. Der Fokus liegt hierbei auf dem heimlichen Lehrplan nach Zinnecker, der als Rahmen für informelles Lernen in der Schule gesehen werden kann.
Im Anschluss werden verschiedene schulische Settings hinsichtlich ihrer Möglichkeiten und Grenzen für informelles Lernen analysiert. Dazu gehören Projektarbeit und Epochenunterricht, Ganztagsangebote sowie die Rolle von Peergroups.
Die Kapitel beleuchten die Vorteile und Herausforderungen des informellen Lernens in diesen Settings. Sie analysieren die Bedeutung des informellen Lernens für die Entwicklung von Selbstständigkeit, Teamfähigkeit und sozialer Verantwortung.
Schlüsselwörter
Informelles Lernen, Schule, heimlicher Lehrplan, Projektarbeit, Epochenunterricht, Ganztagsangebote, Peergruppen, soziale Kompetenzen, Schülerentwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter informellem Lernen im schulischen Kontext?
Informelles Lernen bezeichnet Lernprozesse, die außerhalb des geplanten Unterrichts, aber innerhalb der Schule stattfinden, wie in Pausen oder durch soziale Interaktionen.
Was ist der „heimliche Lehrplan“ (hidden curriculum)?
Es handelt sich um nicht explizit genannte Lerninhalte und soziale Normen, die Schüler durch die Strukturen und das Zusammenleben in der Schule verinnerlichen.
Welche Chancen bieten Ganztagsangebote für informelles Lernen?
Ganztagsschulen bieten mehr Raum für freie Aktivitäten und Peer-Beziehungen, wodurch soziale Kompetenzen und Selbstständigkeit gefördert werden können.
Können Peergroups auch Gefahren für das Lernen bergen?
Ja, informelles Lernen in Peergroups kann auch negative Gruppendynamiken oder den Erwerb problematischer Verhaltensweisen fördern, was eine Grenze dieses Lernmodells darstellt.
Wie unterscheidet sich informelles Lernen von institutionalisiertem Lernen?
Während institutionalisiertes Lernen organisiert und zielgerichtet ist, geschieht informelles Lernen oft beiläufig, ungeplant und ohne formale Leistungsbewertung.
Welche Rolle spielen Projektarbeit und Epochenunterricht?
Diese Settings bieten Übergangsformen, in denen formales Lernen durch informelle Prozesse wie Teamarbeit und eigenverantwortliche Problemlösung bereichert wird.
- Citation du texte
- Tim Sammel (Auteur), 2014, Das informelle Lernen. Möglichkeiten und Grenzen des informellen Lernens in unterschiedlichen schulischen Settings, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1000758