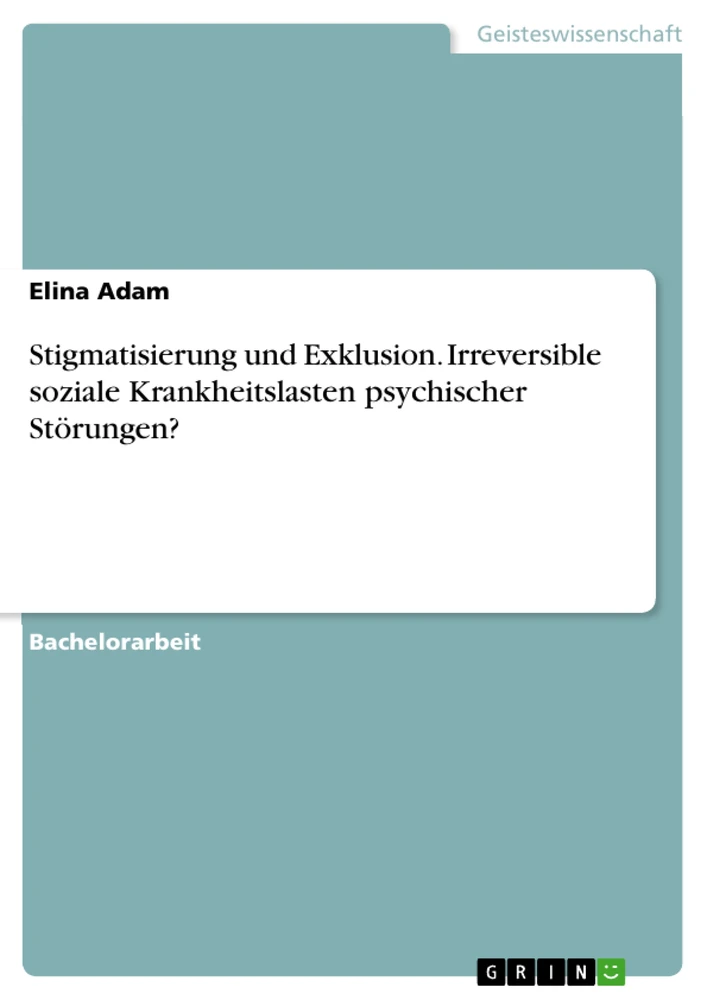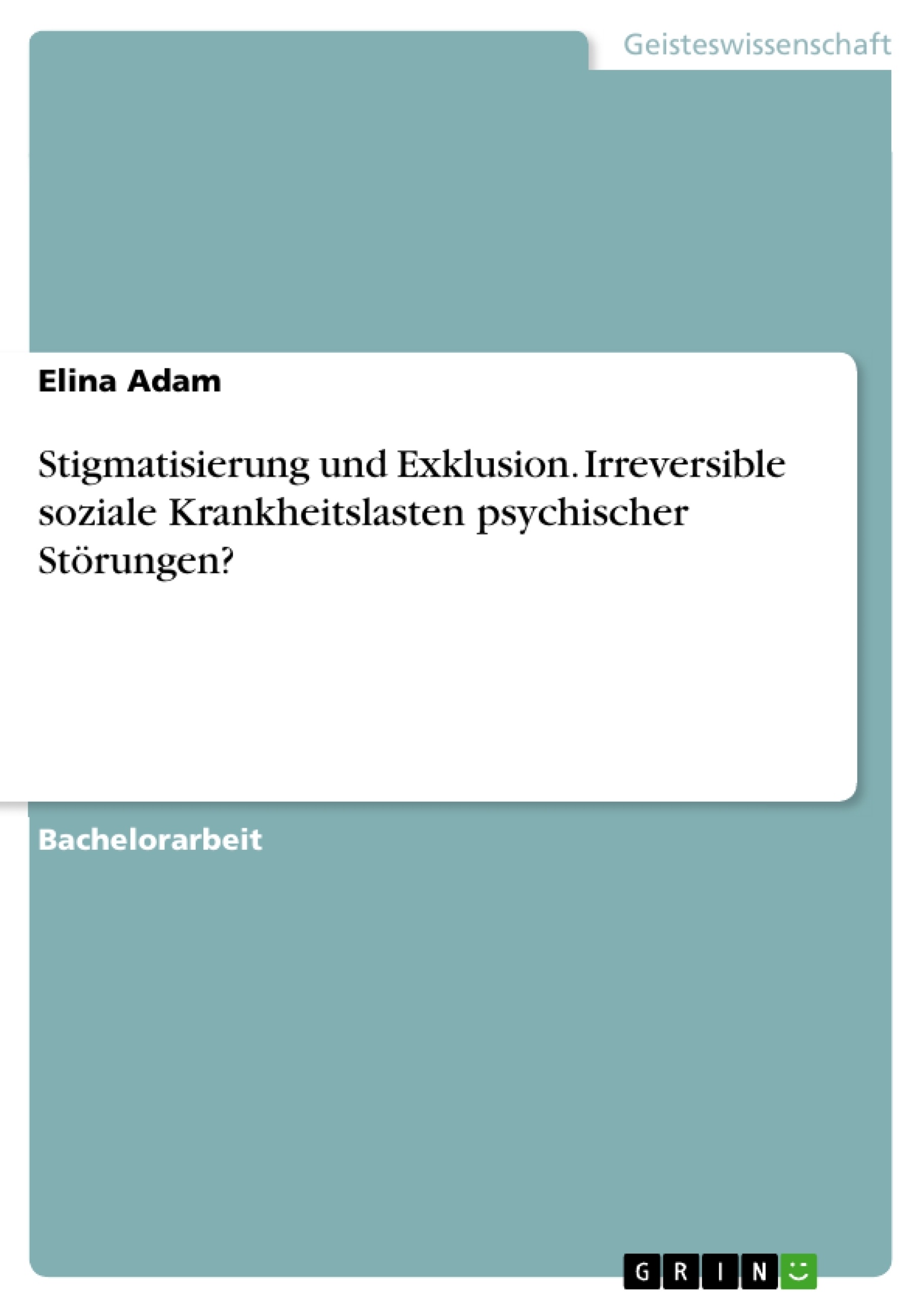Die Frage, nach der öffentlichen Wahrnehmung und Wertung von psychischen Erkrankung ist, wie am Gesundheitsreport der DAK zu sehen ist, nicht nur eine demoskopische Plänkelei, sondern ein handfestes gesellschaftliches Problem mit hoher Relevanz. Menschen, die mit psychischen Leiden jeglicher Art zu tun haben, haben ein ebenso großes Interesse an deren Linderung, wie physisch Erkrankte. Aus diesem Grund sind nicht nur etwaige dem Gesundheitssystem inhärente Probleme zu hinterfragen, wie beispielsweise die Diagnostik von psychischen Erkrankungen, sondern auch soziale Faktoren, wie die Stigmatisierung und Exklusion von psychisch Erkrankten. Um dieser Frage nachzugehen gliedert sich die vorliegende Arbeit in die folgenden Teile:
Im weiteren Verlauf der Arbeit wird zuerst eine thematische Hinführung angestrebt, bei der der Gegenstand der psychischen Erkrankungen für den weiteren Verlauf näher eingegrenzt und seine Bedeutsamkeit dargestellt wird. Weiterhin soll die Methodik beschrieben werden, die bei der Erstellung dieser Bachelorarbeit angewendet worden ist. Im theoretischen Teil dieser Bachelorarbeit werden die genutzten Begriffe erklärt und eingegrenzt und es wird ein definitorischer Rahmen gesetzt. Mithilfe dieses Rahmens ist es möglich, die Leitfrage zu bearbeiten und die Ergebnisse anschließend vorzustellen.
- Quote paper
- Elina Adam (Author), 2020, Stigmatisierung und Exklusion. Irreversible soziale Krankheitslasten psychischer Störungen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1001267