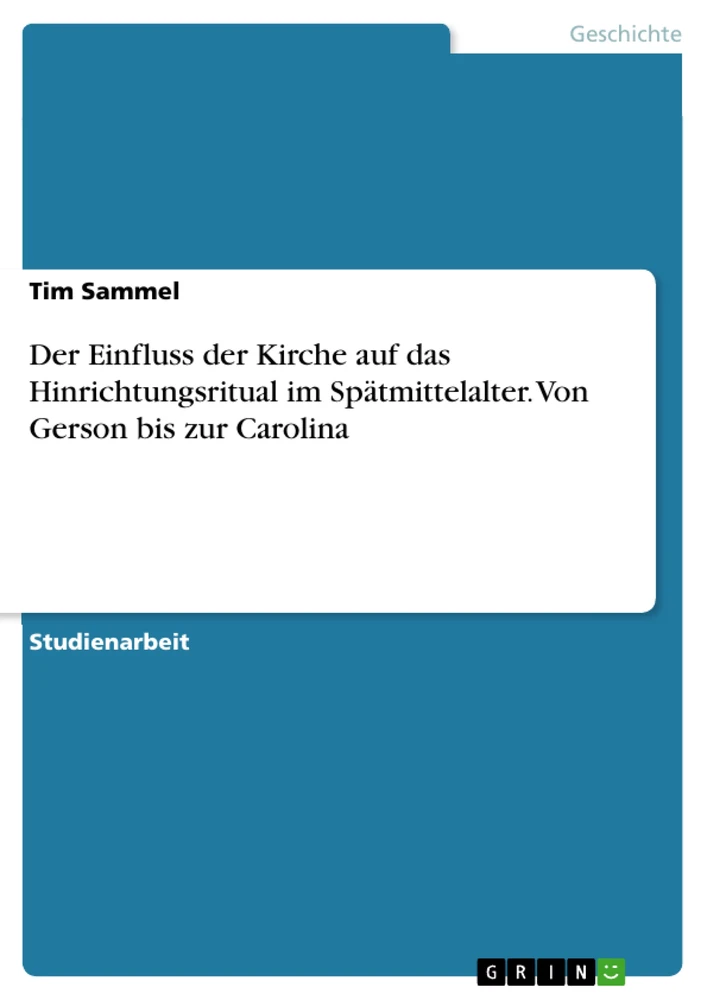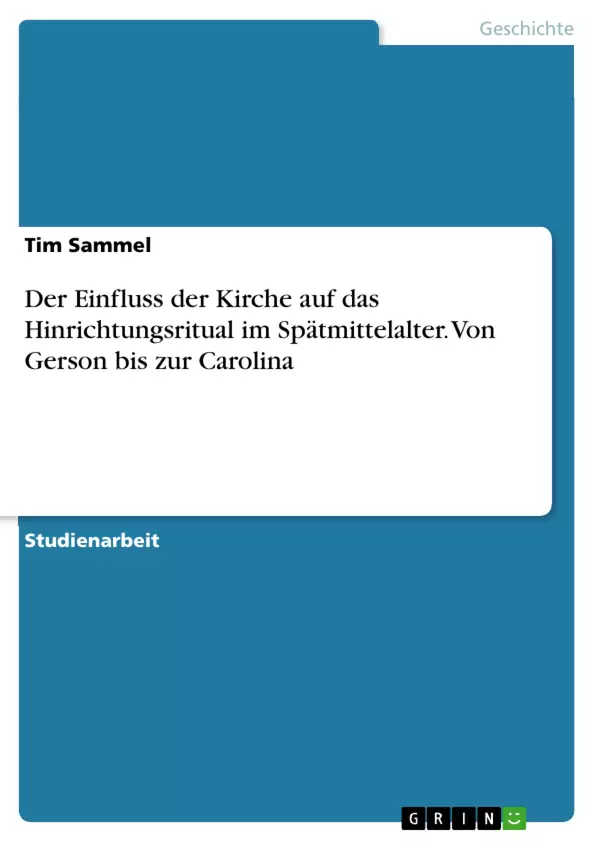In dieser Arbeit werden die Ereignisse vom ausgehenden 14. Jahrhundert bis ins mittlere 16. Jahrhundert betrachtet. Das erste zu untersuchende Ereignis ist das Gesuch des Geistlichen Gerson an den französischen König Karl V. von 1397, fortgefahren wird mit der Verbrennung Jeanne d’Arcs im Jahre 1431 sowie dem ersten Gesetzestext, der Bambergischen Halsgerichtsordnung von 1507, kurz Bambergensis. Nachfolgend wird eine sehr detaillierte Quelle untersucht. Dabei handelt es sich um die Verbrennung von Adolph Clarenbach und Peter Fliesteden aus dem Jahre 1531. Abschließend wird die Peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V., kurz Carolina, von 1532 auf ihren Einfluss der Kirche auf das Hinrichtungsritual hin untersucht. Im Fazit werden die Ergebnisse schließlich zusammengefasst und reflektiert.
Das Engagement der Kirche, sowie der starke Drang der Verurteilten vor ihrem Tode Frieden mit Gott zu schließen, führten dazu, dass im Spätmittelalter immer mehr religiöse Rituale in das organisierte Ritual der Hinrichtung Einzug fanden. Ob man diese These so wirklich vertreten kann, soll in dieser Arbeit an mehreren Stationen überprüft und nachvollzogen werden.
Dabei werden vom ausgehenden 14. Jahrhundert bis ins mittlere 16. Jahrhundert sechs Quellen betrachtet, an denen nachvollzogen wird, wie sich der Wandel und die Einflussnahme der Kirche auf das Hinrichtungsritual genau vollzogen haben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Kirche durchdringt das Hinrichtungsritual
- Beginn der Einflussnahme – Das Gesuch des Geistlichen Jean Gerson 1397 an den französischen König
- Die Verbrennung Jeanne d'Arcs 1431
- Johannes Geiler von Kaysersberg 1485
- Bambergische Halsgerichtsordnung von 1507
- Adolph Clarenbachs Verbrennung 1529
- Peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V. von 1532
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Einfluss der Kirche auf das Hinrichtungsritual im Spätmittelalter. Ziel ist es, die Entwicklung des Rituals anhand von ausgewählten Quellen vom 14. bis zum 16. Jahrhundert nachzuvollziehen und die zunehmende Bedeutung religiöser Elemente aufzuzeigen.
- Wandel des Hinrichtungsrituals vom 14. bis zum 16. Jahrhundert
- Einfluss der Kirche auf die Todesstrafe
- Religiöse Rituale im Kontext der Hinrichtung
- Spannungsverhältnis zwischen weltlicher und göttlicher Gerechtigkeit
- Bedeutung der Beichte und des Seelenheils im Hinrichtungsritual
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage sowie die Methode der Arbeit dar. Die darauffolgenden Kapitel beleuchten anhand von historischen Ereignissen und Dokumenten, wie die Kirche zunehmend in das Hinrichtungsritual integriert wurde. Im Fokus stehen dabei die Forderungen nach Beichterecht für Verurteilte, die Bedeutung der Beichte und des Seelenheils sowie die Entwicklung von religiösen Ritualen innerhalb des Hinrichtungsprozesses.
Schlüsselwörter
Hinrichtungsritual, Kirche, Spätmittelalter, Beichte, Seelenheil, Todesstrafe, weltliche Gerechtigkeit, göttliche Gerechtigkeit, Bambergische Halsgerichtsordnung, Peinliche Gerichtsordnung, Carolina, Jeanne d'Arc, Adolph Clarenbach
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hatte die Kirche auf Hinrichtungen im Spätmittelalter?
Die Kirche integrierte zunehmend religiöse Rituale wie die Beichte und das Abendmahl in den Ablauf der Hinrichtung, um das Seelenheil der Verurteilten zu sichern.
Wer war Jean Gerson und was forderte er?
Jean Gerson war ein Geistlicher, der 1397 den französischen König bat, Verurteilten das Recht auf die Beichte vor der Hinrichtung zu gewähren.
Was ist die "Carolina" (Peinliche Gerichtsordnung)?
Die 1532 von Kaiser Karl V. erlassene Carolina war das erste reichsweite Strafgesetzbuch, das auch kirchliche Einflüsse auf das Verfahren und die Vollstreckung festschrieb.
Warum war die Beichte für Verurteilte so wichtig?
Im spätmittelalterlichen Weltbild war der Frieden mit Gott vor dem Tod essenziell, um die ewige Verdammnis zu verhindern und das Seelenheil zu garantieren.
Was geschah bei der Verbrennung von Adolph Clarenbach?
Die Verbrennung von 1529 dient als detaillierte Quelle dafür, wie religiöse Überzeugungen und das öffentliche Hinrichtungsritual in der Reformationszeit aufeinanderprallten.
Wie veränderte sich das Ritual zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert?
Es wandelte sich von einem rein weltlichen Akt der Vergeltung zu einem tief religiös durchdrungenen Zeremoniell, das göttliche und weltliche Gerechtigkeit verband.
- Quote paper
- Tim Sammel (Author), 2018, Der Einfluss der Kirche auf das Hinrichtungsritual im Spätmittelalter. Von Gerson bis zur Carolina, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1001365