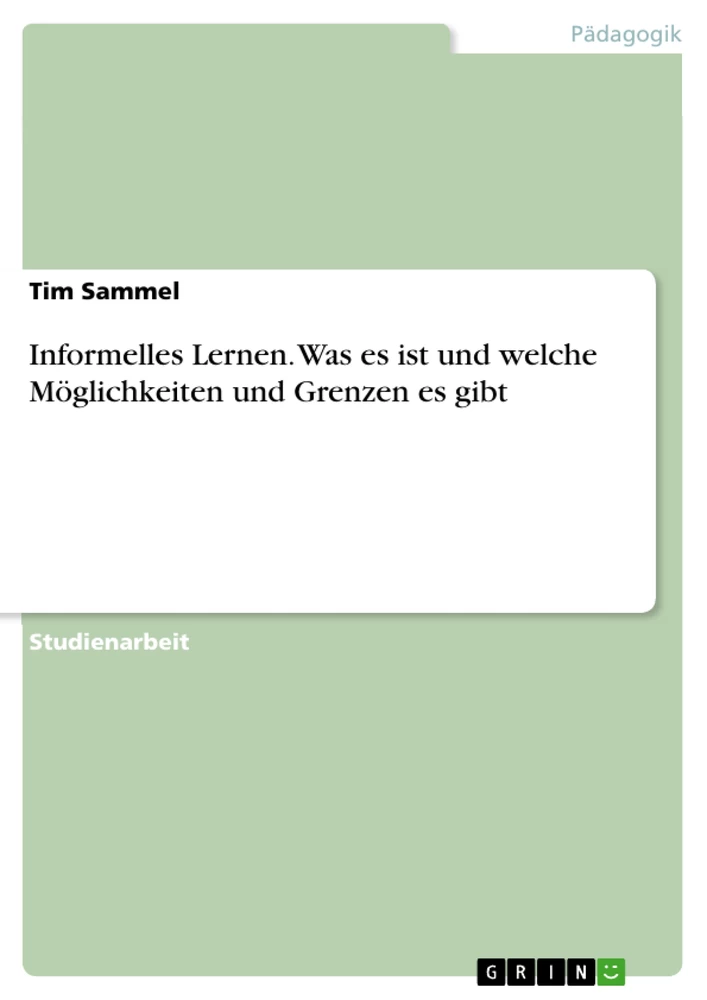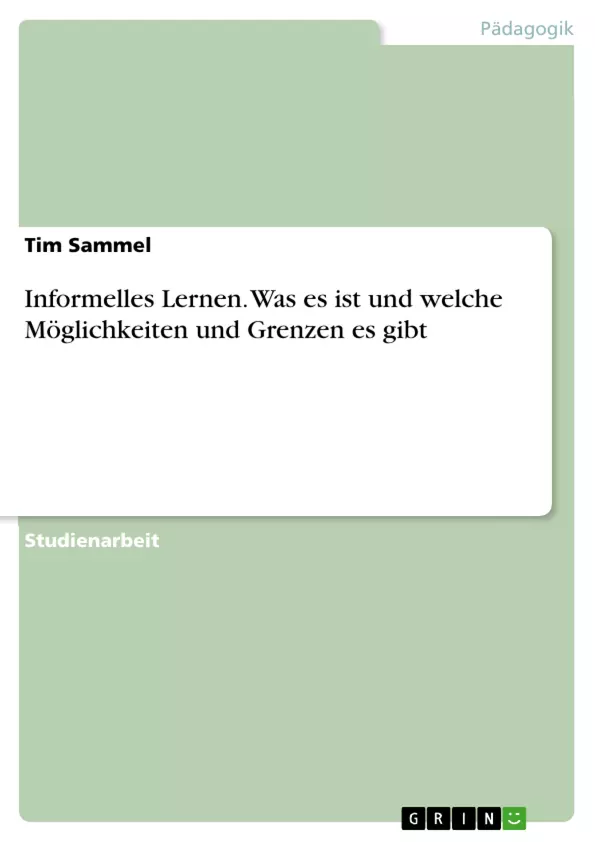In dieser Arbeit soll erläutert werden, welche Möglichkeiten das informelle Lernen mit sich bringt und wo es an seine Grenzen stößt. Diese Frage lässt sich mit Hilfe der Literatur klären. Da es bisher nur wenige Arbeiten gibt, die diese Fragestellung dann auch nur am Rande bearbeiten, werden auch eigene Überlegungen angestellt.
Die Literatur lässt sich, gerade im Hinblick auf die Bedeutsamkeit des Themas und hier insbesondere für den Bereich des informellen Lernens mittels und mit Musik, als dürftig bezeichnen. Der Begriff und die Begriffsentwicklung des informellen Lernens hingegen sind etwas besser erforscht und diskutiert. Hier besonders hervorzuheben ist die Arbeit von Natalia Ardila-Mantilla die eine sehr ausführliche Darstellung der verschiedenen historischen Begriffsdefinitionen im Verlauf vornimmt, dann aber auch ihre eigene Sichtweise erläutert und eine ausführliche Definition liefert.
Ältere Debatten und Standpunkte der Forschung plädierten dafür, das informelle Lernen strikt von den formalen Institutionen zu trennen, da es gerade durch das Nichtvorhandensein dieser organisatorischen Strukturen gekennzeichnet sei. Jüngere Debattenbeiträge hingegen, gehen davon aus, dass informelles Lernen auch in formalen Umgebungen stattfinden kann und auch stattfindet. Deshalb sollen in dieser Arbeit nicht nur außerinstitutionelle Settings betrachtet werden, sondern auch die Möglichkeiten innerhalb dieser Einrichtungen.
Einen stärkeren direkten musikpraktischen Bezug weist die Arbeiten von Dagmar Hoffmann auf. Sie geht weniger auf die Begrifflichkeit ein, sondern erläutert verstärkt die Zusammenhänge der Musik und des informellen Lernens und geht vertieft auf Ebenen einer Auseinandersetzung mit Musik ein.
Inhaltsverzeichnis
- Der (un)klare Begriff des informellen Lernens
- Einleitung
- Möglichkeiten und Grenzen des informellen, musikalischen Lernens
- Peergroups
- Die Ganztagsangebote als informeller, schulischer Lernort
- Die Familie als musikalischer Sozialisations- und informeller Lernort
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Begriff des informellen Lernens, seine Möglichkeiten und Grenzen, insbesondere im musikalischen Kontext. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Begriffsdefinitionen und analysiert verschiedene Lernsettings.
- Definition und Begriffsentwicklung des informellen Lernens
- Unterschiede zwischen formalem und informellem Lernen
- Möglichkeiten des informellen Lernens in verschiedenen Kontexten (Peergroups, Schule, Familie)
- Grenzen des informellen Lernens
- Der Einfluss von Musik auf informelles Lernen
Zusammenfassung der Kapitel
Der (un)klare Begriff des informellen Lernens: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von „Lernen“ und „informell“. Es zeigt die Schwierigkeiten auf, eine eindeutige Definition für informelles Lernen zu finden, da die Literatur in diesem Punkt uneinheitlich ist. Verschiedene Begriffsdefinitionen werden vorgestellt und verglichen, wobei die Komplexität des Themas und die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtungsweise hervorgehoben werden. Die Arbeit von Natalia Ardila-Mantilla, die eine umfassende Darstellung historischer Begriffsdefinitionen liefert, wird als besonders relevant genannt. Das Kapitel legt die Grundlage für die weitere Auseinandersetzung mit dem Thema durch die Klärung der zentralen Begriffe.
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Möglichkeiten und Grenzen des informellen Lernens. Sie betont die Bedeutung des informellen Lernens als einen Großteil des gesamten Lernprozesses und verweist auf die bisherige Forschungslücke zu diesem Thema. Die Einleitung verdeutlicht den Mangel an Literatur, speziell im Bereich des informellen musikalischen Lernens, und kündigt die eigene Auseinandersetzung mit der Problematik an. Es wird die Notwendigkeit einer Definition der Kernbegriffe sowie die Berücksichtigung unterschiedlicher Lernsettings angekündigt.
Möglichkeiten und Grenzen des informellen, musikalischen Lernens: Dieses Kapitel analysiert Möglichkeiten und Grenzen informellen Lernens in verschiedenen Settings. Es werden Peergroups, Ganztagsangebote in der Schule und die Familie als relevante Lernorte betrachtet. Die Arbeit bezieht sich auf vorhandene Literatur und integriert eigene Überlegungen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Untersuchung von informellen Lernprozessen im Kontext des musikalischen Lernens. Es wird auf die Arbeit von Dagmar Hoffmann verwiesen, die den musikpraktischen Bezug des informellen Lernens hervorhebt. Die Zusammenfassung der Unterkapitel wird die spezifischen Aspekte jedes Settings im Hinblick auf die Möglichkeiten und Beschränkungen informellen Lernens erörtern.
Schlüsselwörter
Informelles Lernen, formelles Lernen, musikalisches Lernen, Peergroups, Familie, Schule, Ganztagsangebote, Begriffsdefinition, Lernsettings, Möglichkeiten, Grenzen.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Möglichkeiten und Grenzen informellen musikalischen Lernens
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Begriff des informellen Lernens, seine Möglichkeiten und Grenzen, insbesondere im musikalischen Kontext. Sie beleuchtet unterschiedliche Begriffsdefinitionen und analysiert verschiedene Lernsettings wie Peergroups, Ganztagsangebote in der Schule und die Familie.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit umfasst die Definition und Begriffsentwicklung von informellem Lernen, den Vergleich mit formalem Lernen, die Analyse informeller Lernprozesse in verschiedenen Kontexten (Peergroups, Schule, Familie), die Grenzen des informellen Lernens und den Einfluss von Musik auf informelles Lernen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu dem (un)klaren Begriff des informellen Lernens, einer Einleitung, den Möglichkeiten und Grenzen des informellen musikalischen Lernens (mit Unterkapiteln zu Peergroups, Ganztagsangeboten und der Familie als Lernort), einem Schluss und einem Literaturverzeichnis. Sie beinhaltet außerdem eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten und eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel.
Welche Schwierigkeiten werden im Bezug auf den Begriff des informellen Lernens angesprochen?
Die Arbeit hebt die Uneinheitlichkeit der Literatur bezüglich der Definition von „informellen Lernen“ hervor. Es werden verschiedene Begriffsdefinitionen vorgestellt und verglichen, um die Komplexität des Themas und die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtungsweise zu verdeutlichen. Die Arbeit von Natalia Ardila-Mantilla wird als besonders relevant für die historische Begriffsbildung genannt.
Welche Lernorte werden im Detail betrachtet?
Die Arbeit analysiert Peergroups, Ganztagsangebote an Schulen und die Familie als relevante Lernorte für informelles musikalisches Lernen. Es wird auf die Arbeit von Dagmar Hoffmann verwiesen, die den musikpraktischen Bezug des informellen Lernens hervorhebt.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage der Arbeit lautet: Welche Möglichkeiten und Grenzen bestehen beim informellen Lernen, insbesondere im musikalischen Kontext?
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Informelles Lernen, formelles Lernen, musikalisches Lernen, Peergroups, Familie, Schule, Ganztagsangebote, Begriffsdefinition, Lernsettings, Möglichkeiten, Grenzen.
Welche Forschungslücke wird adressiert?
Die Einleitung betont den Mangel an Literatur, speziell im Bereich des informellen musikalischen Lernens, und adressiert diese Forschungslücke mit der vorliegenden Arbeit.
- Arbeit zitieren
- Tim Sammel (Autor:in), 2020, Informelles Lernen. Was es ist und welche Möglichkeiten und Grenzen es gibt, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1001370