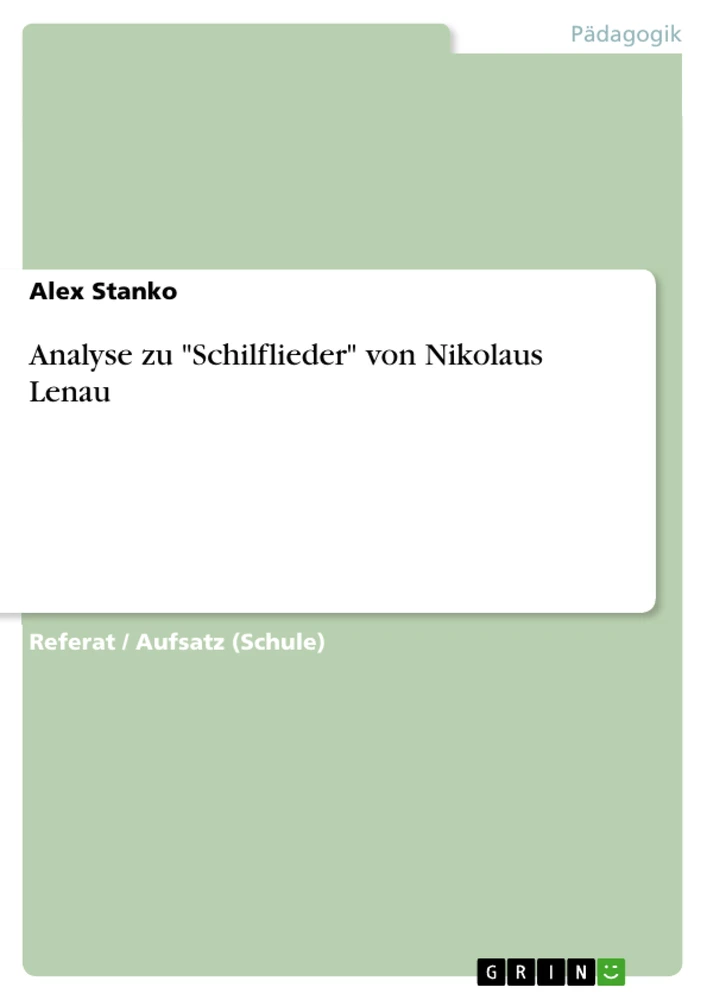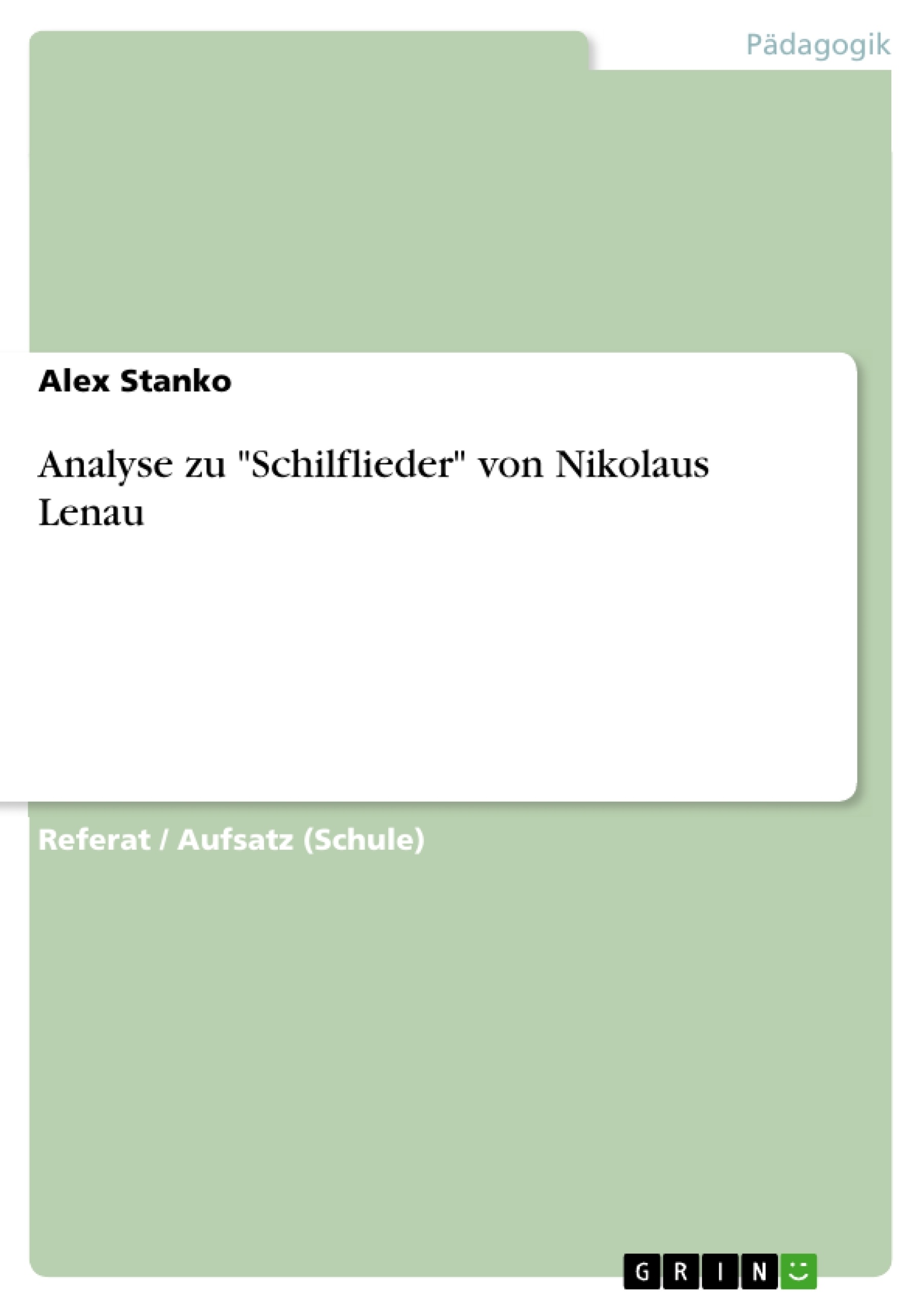Die Schilflieder setzen mit einer Pastorale der Melancholie an: niederhängende Weiden, die ,,traurig säuseln", doch ,,bebt das Rohr". Gewiss ist es nicht unzulässig, an dieser Stelle von der Natur als Spiegel der Befindlichkeit des ,,lyrischen Ichs" zu sprechen1, doch birgt der Widerspiegelungsbegriff natürlich Gefahren, besonders wenn von Gleichnissen und Symbolen die Rede ist.2 Zumindestens muss der Ausgangspunkt soweit ,,abgeschwächt" werden, als die Natur in den hier gelesenen Gedichten das Bild des inneren Zustandes des Betrachters, des sprechenden Ichs, gestaltet.
Wie schon in Himmelstrauer wird das Menschenleben zum Gleichnis der Natur, d.h. um das Naturphänomen zu beschreiben, werden Metaphern aus dem Bereich des Menschenlebens benutzt, die in die Natur ,,hineingedichtet" wurden. Die Natur ist weniger Metapher für Trauer oder Melancholie, als diese in die dargestellte Natur ,,hineingeschrieben" sind. Die Natur wird so ,,subjektiviert", durch aus dem Bereich des Menschenlebens entnommene Metaphern vermenschlicht.
Diese beiden Thesen bergen bereits einen Widerspruch in sich, der vielleicht nicht einmal auflösbar oder nach Kriterien der Richtigkeit oder Plausibilität entscheidbar ist, denn es lassen sich für beide Seiten genügend hinreichende Argumente finden. Wir sehen uns sogleich mitgerissen im Taumel der Unentscheidbarkeit, ,,im Strom" ( und im ,,Strom des Lesens"). Der Strom spielt, wie wir noch sehen werden, als Inbegriff des Lebens eine gewichtige Rolle in Lenaus Lyrik.
Doch zurück zu den Schilfliedern. Im ersten Gedicht alterniert der Blick: von der Natur (Sonne und Tag, also Licht, jedoch als Mangel von Licht oder als Verlust, und Teich) wechselt er zum Menschenleben (Träne, Sehnsucht, Trauer), in der zweiten Strophe noch zurück zur Natur (Weiden, Schilfrohr), in der dritten wieder zum Menschenleben (Leiden) und zur Natur (Binsen und Weiden). Der Wechsel des Blickes geht mit einer doppelten Parallelität einher. Das ,,Drüben" und ,,Hier" innerhalb der Natur sowie das Natur und Menschenleben verbindende ,,Und" kennzeichnen diese. Ich folge diesem Weg und durch
Weiden und Binsen starrt mich die Frage an: Wo steht das Ich? Wo meidet es seine Liebste?
Wo strahlt die Ferne in sein Leiden? Wo, wenn hier die Weiden säuseln? Drüben?
Jedoch kann das Lesen an dieser Stelle, und nicht nur hier, schnell entgleiten. Es sei Vorsicht geboten, um nicht blindlings in den Strudel des Verlesens mitgerissen zu werden (obgleich kluge Literaturprofessoren erklären, Lesen sei stets und nie etwas anderes als ein Verlesen und Verkennen3, muss ich mich aber ernsthaft fragen: Angenommen, die Welt sei nicht erkennbar denn nur verkennbar; woher wissen sie das?). Nicht vergessen sollten wir hier, dass wir es mit einer vergleichenden Beziehung zu tun haben: ,, wie durch Binsen hier und Weiden..."
Das Strahlen (der Ferne) in das ,,stille, tiefe Leiden" des Ichs (und man beachte die Symmetrie und den Rückverweis auf Zeile 4, in der der Teich mit still und tief bezeichnet wurde!), das Strahlen der Ferne wird mit dem Strahlen des Abendsternes verglichen: ,,Du, ferne(s) X, strahlst in mein Leiden wie der Abendstern auf das Wasser des Teiches durch das Schilfrohr hindurchstrahlt."
Doch heißt es hier ,,des Abendsternes Bild". Ein Bild meint eine Reflexion von etwas auf einer spiegelnden Oberfläche. Das bedeutet eine Veränderung der Blickrichtung, d.h. das Ich sieht nicht direkt zum Stern, sondern empfängt sein Licht vom Wasser des Teiches reflektiert: ,,So wie des Abendsternes Bild im Teich durch das Schilf hindurchstrahlt, mich anstrahlt, strahlst Du, Ferne (ferne(s) X.?), in mein Leiden." Das unterstützt den Vergleich (symbolhaften Vergleich!) von Leiden und Teich:
,,Niederhangen hier die Weiden / In den Teich, so still, so tief." [...]
,, In mein stilles, tiefes Leiden / Strahlst du, Ferne! hell und mild," ,,Wie durch Binsen hier und Weiden / Strahlt des Abendsternes Bild [im Teich]"
[Hervorhebung von mir, A.K.]
Betrachten wir das aufgebaute Bild des auf das Wasser des Teiches strahlenden Lichtes genauer, bemerken wir sofort, dass das Leiden in der dritten Strophe die Funktion des Teiches aus der ersten Strophe übernimmt. Das Leiden reflektiert das Strahlen.
Die Sonne ging scheiden, Dämmerung ist eingetreten. Im Teich spiegelt sich weder die Sonne noch irgendein Stern, denn es ist wiederum noch nicht Nacht. Es ist genau die Zeit dazwischen, trübe Dämmerung, in der verstreutes Licht sich mit der Dunkelheit mischt. Wieder hat uns die Unentscheidbarkeit eingeholt.
Folge ich diesem Gedankengang weiter, stellt sich konsequent die Schlussfolgerung ein, dass die strahlende Ferne die Rolle der nächtlichen Sterne, des Sternes, übernimmt. In der ,,vollkommenen" Dunkelheit, welche die Dämmerung ist, da weder Sonne noch ein Stern strahlen, strahlt sie, die Ferne, die ferne X., in das Leiden. Die Ferne ist das ,,ewige" Strahlen. Ein unaufhörliches Strahlen, solange Leben ist. Doch kein Strahlen ohne Leiden. Um Licht zu sein, bedarf es das Leiden...
Zurück zur dritten Strophe. Beim wiederholten Lesen kann sich die besprochene Passage als noch komplizierter herausstellen. Vielleicht ist es nämlich nicht so sehr das Licht, jenes Strahlen (des Sternes), denn die Ferne selbst, die hier mit des Sternes Bild verglichen wird: ,,Du, Ferne, strahlst in mein Leiden wie des Abendsternes Bild durch Binsen und Weiden." Wer oder was ist die Ferne?
Es hieße, die Lesarten zu prüfen, Möglichkeiten zu finden...
Wer spricht?
Diese Frage kommt nicht von ungefähr. Denn woher nehmen wir die Gewissheit, dass im Text ein Ich die Sprache nach seinem Dünken benutzt, um mit ihr und durch sie etwas Ursprünglicheres, von Rationalität und Grammatik mitsamt ihrer Logik Unbeflecktes, entweder das, was gemeinhin als Gedanke oder das, was als Gefühl bezeichnet wird, auszudrücken? Das Ich, mehr noch der Autor als Schöpfer, als homogenes, ganzheitliches Etwas, das die Sprache meistert, ist vielleicht selbst nur Produkt und darüber hinaus Simulation einer innersprachlichen Bewegung und die Subjektivität ist lediglich ein Effekt dieser Bewegung: ,,Die Sprache verspricht..."
Nur in und durch die Sprache konstituiert sich das Subjekt, das, wie es der Name bereits suggeriert, der Sprache unterworfen ist. Alles ist in und durch Sprache.,,Es gibt nichts außerhalb des Textes."
Auf gleiche Weise wie Subjektivität und Innerlichkeit wäre die Repräsentation (jegliche Abbild- und Widerspiegelungstheorien) nichts weiter als ein Effekt der sprachlichen Bewegung. Es gilt also nun der sprachlichen Bewegung zu folgen.
Ein Text, unabhängig von der Intention des Schöpfers, redet immerfort über sich selbst. Stets zwei Worte in einem fällt die Rede unentwegt auf sich selbst zurück, ist immerfort auf sich selbst zurückgefaltet. Es ist vielleicht nicht so sehr die Modernität eines Textes, die diese Lesart fordert, sondern der Umgang mit Texten selbst, der nach festgelegten Regeln und auf der Basis eines bestimmten Wissens abläuft, welchem wir nicht entrinnen können. Selbst die Nischen und Regelverstöße sind Effekte des Systems.
Gleichermaßen steht es mit dem Zuweisen von Sinn. Ein Zeichen, und als Zeichen fungieren Worte, Gesten, historische Gegebenheiten oder Ereignisse, fordert immerfort eine Sinnzuweisung. Immerfort schließt zudem ein, dass eine einmalige Sinnzuweisung ungenügend ist, vielmehr wird sie ständig aufs neue generiert. Selbst der Entzug und das Ausbleiben von Sinn bedeuten eine Zuweisung von Sinn, eben des Nicht-Sinns. Selbst das Nichts ist nicht nichts, es muß unentwegt generiert werden; es ist auf eigene Weise aktiv: ,, Das Nichts selbst nichtet."4
Ähnlich steht es mit dem Vergessen. Sogar das Vergessen ist nicht nichts; es ist immer noch ein Bewahren, es zehrt vom Werk, vom Geschaffenen, vom Dagewesenen und bewahrt es zumindest als Geheimnis.5
Zwei Worte, eng aneinander gepresst, wie zwei lebendige Körper, aber mit fließenden Grenzen...
Was ist die Ferne?
Die Offensichtlichkeit des ersten Lesens, nicht ohne ein Gran Naivität, schreibt der Ferne die Referenz der Geliebten, aus der zweiten Strophe ,,Und ich muss mein Liebstes meiden!", zu. Die abwesende Geliebte strahlt hell und mild in das stille, tiefe Leiden. Sie ist folglich wieder (oder bleibt) anwesend, als strahlendes Licht. Angesprochen in der dritten Strophe aber ist die Ferne.
Und wenn ich sage, ich liebe Dich, zu wem, dann, spreche ich? Sage ich, Du, ich liebe Dich, und nur Dich, oder spreche ich zu Dir, meine Liebe, und meine ich - Dich?
Spreche ich vielleicht nur zu Dir, meine Liebe, immer wenn ich sage, ich liebe Dich, liebe ich dann Dich, meine Liebe? Und was, nur, was liebe ich?
Ich habe Dir soviel zu sagen...
Wer spricht hier zu wem? Wer ist angesprochen?
In Lenaus Schilfliedern wie in diesem Gedicht eines zeitgenössischen, aber jungen, zeitlosen ,,Künstlers" stehen transzendente Referenz und Selbstreferenz ineinander verschränkt. Die Metaphorik der Sprache macht es unmöglich eine eindeutige Entscheidung zugunsten einer Lesart zu fällen, ohne eine gleichwertige Hälfte zu verdunkeln oder gar zu vernachlässigen. Letztlich wird deutlich, dass die Lesart gänzlich auf den vorgelagerten Regeln beruhen, die das Wissen determinieren, das ich an einen Text herantrage. Es geht hier folglich um eine Art ,,Tiefenwissen", das das erlernte Wissen, mit dessen Hilfe ich einem Text einen bestimmten Sinn zuweise, erst konstituiert und formt.
Bereits in dieser ,,methodischen Vorüberlegung" - und es sei noch dahingestellt, ob es sich hier um eine Überlegung im bewussten und vom Subjekt gesteuerten Sinne handelt - wird darüber entschieden, ob einem Wort eine transzendente Referenz (transzendent im Sinne von ,,über die Grenze des Textes hinausgehend"; die Geliebte namens X., eine bestimmte Person außerhalb des Textes, usw.) oder eine im Text enthaltene oder aufgebaute Referenz (,,mein Liebstes"; doch wer oder was ist ,,mein Liebstes"!? - vielleicht ,,du, Ferne"?) oder eine Selbstreferenz (der Text redet über nichts weiter als sich selbst) zugewiesen wird.
Wer oder was also ist angesprochen mit ,,du, Ferne!"? Bringt uns der Verweis ,,mein Liebstes" auf eine Spur, die nicht durch den Text hindurch auf etwas vages Externes zielt? Wenn es sich hierbei um die (abwesende) Geliebte handeln sollte, ist sie doch als leuchtende Ferne, die in das stille, tiefe Leiden strahlt, anwesend, sogar nah (im Leiden des Ichs!) und nicht länger fern.
Es könnte aber genauso gut sein, dass die Ferne nicht auf eine bestimmte Person verweist, dass dieser Ort vielmehr unterschiedliche Personen oder Dinge beherbergen kann, und dass von der Ferne als Ferne die Rede ist. So etwas wie - und ich setze diese Begriffe bewusst in Anführungszeichen - ,,das ewig Ferne" oder ,,die Ferne an sich", wenn es denn so etwas geben sollte. Bei aller Brüchigkeit hilft mir diese Denkkrücke ein wenig, da sie eine Spur eröffnet, die mich zum Begehren führt und zugleich in Richtung der Bewegung der Sprache (oder der Bewegung des Textes) weist.
Die Ferne als Ferne zu lesen, heißt nicht notwendig, die Geliebte als Möglichkeit der Referenz auszuschließen. Vielmehr heißt es, dass die Ferne der Geliebten vorangeht und zwar in der Weise, dass die Ferne erst den Ort bzw. die Existenz der Geliebten ermöglicht. Die Ferne, die Abwesenheit der Geliebten ist das, was das Geliebt-Sein gewährt, unabhängig von der Person. Die Geliebte wird geliebt, weil sie unerreichbar in der Ferne nur das Objekt der Sehnsucht und des Begehrens sein kann. Es ist unmöglich, sich des geliebten Objektes zu bemächtigen. Die Ferne bewahrt das Objekt des Begehrens und der Sehnsucht vor jeglichen Zugriff. Dieser Mangel des Zugriffs, das Unvermögen des Habhaft-Werdens eröffnet einen Ort, der der ständige Anziehungspunkt und das Ziel von Hoffnungen und Sehnsüchten sein kann. Sein kann, weil zugleich die Abwesenheit ein Vergessen und eine Gleichgültigkeit nach sich ziehen kann.
Der Konzentrationspunkt, den ich nun herausgestellt habe, liegt in der Ferne und wird durch die Ferne, das Fern-Sein, die ,,Abwesenheit" begründet. Aufgrund der ,,Abwesenheit" strahlt die Geliebte in das Leiden des Ichs (zurück?). Das Leiden wiederum ist ebenso wie die Geliebte ein Produkt der Ferne. Und die Ferne ist nichts anderes als die ,,ursprüngliche" Öffnung, aus der die Geliebte und das Leiden des ,,Ichs" ,,herausspringen". An dieser Stelle kann die berechtigte Frage eingeworfen werden, ob es nicht vielleicht die Liebe des Ichs ist, die Libido, wenn es denn so etwas gibt, die entweder zurückgeworfen wird - wobei noch zu klären wäre, was genau der Reflektor ist (das Leiden?, denn ohne Leiden kein strahlendes Licht der Ferne!) - oder die in der Ferne von der Ferne absorbiert wird, und ob das sprechende Ich nichts weiter ist, als ein Selbstbeobachter, ein Voyeur seiner eigenen Gedanken und Gefühle.
An die zweite Variante schließt sich im gewissen Sinne der Vergleich mit dem Stern an, dessen Licht ins All hinausstrahlt, ohne ein bestimmtes Ziel zu haben und dessen Licht in diesem Teich oder jenem Glas Wasser aufgefangen werden könnte. Aufgefangen, doch ohne gefangen zu sein und in Besitz genommen zu werden. Im Strahlen-Sein hieße dann auch im Strome-Sein.
Ebenso könnte ich weiter fragen, was es mit dem Strahlen auf sich hat. Ist es ein physikalischer Lichteffekt (Und warum klingt die transzendente Referenz auf ein physikalisches Phänomen an dieser Stelle absurd? - Weil wir es mit Literatur zu tun haben. - Aber was ist Literatur?), oder ein Glanz, ein Schein (im metaphorischen Sinn), der gerade durch die Ferne, die genau betrachtet, weder Anwesenheit noch Abwesenheit ist! - die Ferne entzieht sich der Dialektik von An- und Abwesenheit! (in der Ferne ist das Objekt anwesend und doch abwesend, weit entfernt) -, durch das Vorhandensein doch Unerreichbarkeit etwas Größeres, Höheres symbolisiert?
Das lässt mich einen anderen Umweg nehmen. Das Strahlen ist gewöhnlich eine Metapher der Sonne. Und die Sonne? ,,Jedes Mal, wenn die Sonne erscheint, hat die Metapher begonnen."6 Sie hat bereits begonnen; sie ist schon da. Die Sonne ist niemals direkt als Sonne zugänglich, sondern nur als Metapher. (Wie steht es mit der Liebe oder Liebsten, dem Stern?) Und da alles Sprachliche, selbst die Philosophie, mit und von Metaphern durchwirkt ist (und auch nur durch diese Metaphern sprechen kann), wird die Sonne, jene Voraussetzung jeglichen Lichts und jeglicher Erhellung, die Metapher der Metapher. Dies gerade weil die Metapher in ihrer eigenen Wirkung und Funktion (d.i. die Struktur des Austausches) die (Idee der) Distanz wiederholt, welche wiederum der Ästhetik vorangeht, also diese begründet. (In Kants Kritik der Urteilskraft werden Distanz und Geschmack als die Fundamente der Ästhetik herausgestellt. Ein ,,interesseloses Wohlgefallen" ist nur möglich, wenn es überhaupt möglich ist, wenn Distanz vorhanden ist!)
Distanz, mit anderen Worten: die Ferne, ist die Metapher der Ästhetik, des ästhetischen Diskurses. Die Ferne strahlt hier, also nicht die Sonne, als die Ferne, die Distanz selbst. Und die Distanz ist nichts anderes als die bewusst erzeugte Ferne.
Ich möchte mir jetzt die Zeit nehmen und eine Passage aus der Fröhlichen Wissenschaft zitieren. Die Frau und ihre Wirkung in der Ferne:
,,Da, plötzlich, wie aus dem Nichts geboren, erscheint vor dem Tore dieses höllischen Labyrinthes, nur wenige Klafter weit entfernt, - ein großes Segelschiff, schweigsam wie ein Gespenst dahingleitend. O diese gespenstische Schönheit! Mit welchem Zauber fasst sie mich an! Wie? Hat alle Ruhe und Schweigsamkeit der Welt sich hier eingeschifft? Sitzt mein Glück selber an diesem stillen Platze, mein glücklicheres Ich, mein zweites verewigtes Selbst? Noch nicht tot, und doch auch nicht mehr lebend? Als ein geisterhaftes, stilles, schauendes, gleitendes, schwebendes Mittelwesen? Dem Schiffe gleichend, welches mit seinen weißen Segeln wie ein ungeheurer Schmetterling über das dunkle Meer einläuft! Ja! Über das Dasein hinlaufen! Das ist es! Das wäre es! - - Es scheint, der Lärm hier hat mich zum Phantasten gemacht? Aller große Lärm macht, dass wir das Glück in der Stille und Ferne setzen. Wenn ein Mann inmitten seines Lärms steht, inmitten seiner Brandung von Würfen und Entwürfen: da sieht er auch wohl stille zauberhafte Wesen an sich vorübergleiten, nach deren Glück und Zurückgezogenheit er sich sehnt, - es sind die Frauen. Fast meint er, dort bei den Frauen wohne sein besseres Selbst: an diesen stillen Plätzen werde auch die lauteste Brandung zur Totenstille, und das Leben selber zum Traume über das Leben. Jedoch! Jedoch! Mein edler Schwärmer, es gibt auch auf dem schönsten Segelschiffe so viel Geräusch und Lärm! Der Zauber und die mächtige Wirkung der Frauen ist, um die Sprache der Philosophen zu reden, eine Wirkung in die Ferne, eine actio in distans: dazu gehört aber, zuerst und vor allem - Distanz !"7
Distanz, Ferne, wirkt in zweifacher Weise, als pharmakon 8, als Gift oder Reiz, gleichermaßen aber als Heilmittel. In und durch die Ferne wird das Objekt der Sehnsucht und des Begehrens aufgerichtet und geformt, zur gleichen Zeit bildet die Ferne die Möglichkeit, sich von der Besitznahme durch dieses Objekt zu entziehen, denn die Gefahr ist offensichtlich.
Der Text Lenaus spricht also nicht nur über die Struktur des Begehrens, er reißt auch seine eigene Textualität auf und bringt sein Gemacht-Sein zum Vorschein. Er spricht in einer Sprache, die auf sich selbst zurückgebogen ist, in der Form und Inhalt, das wie es sagt, was es sagt, zusammengeworfen sind. Ein Reden, das gestattet, kontinuierlich über sich selbst zu sprechen und doch über etwas anderes, indem es das Entfernte zu seinem Gegenstand macht und doch über nichts spricht als sich selbst - immer zwei Worte in einem. Das Sprechen, das diese Ambivalenz erlaubt und unaufhörlich generiert, nenne ich ein allegorisches Sprechen. Eine Allegorie ist eine Figur der Sprache unter anderen, die deren wesentlichen Möglichkeiten repräsentiert, ,,und zwar die, welche es ihr erlaubt, das andere zu sagen und von sich selbst zu sprechen, während sie von etwas anderem spricht; immer etwas anderes zu sagen als das, was es zu lesen gibt, die Szene der Lektüre selbst mit einbegriffen."9 Eine Figur, ,,die etwas anderes sagt als das, was sie sagt, und den anderen (allos) im offenen, aber nächtlichen Raum der Agora, da, wo kein Licht mehr ist und doch mehr (als) Licht (plus de lumiere), zum Vorschein kommen läßt, sie spricht zu dem anderen und sie bringt ihn zum Sprechen, den anderen, aber um ihn sprechen zu lassen, denn der andere wird als erster gesprochen haben."10
Das, worüber der Text spricht, ist seine Seinsweise; sein Leben ist seine Metaphorik oder Allegorik. Weder ist die Natur in Lenaus Gedichten bloßes (Spiegel-) Bild des inneren Zustandes des Betrachters, noch wird nur das Menschenleben zum Gleichnis in der Natur. Das Leben, und hier fallen Menschenleben und Natur zusammen, ist zugleich die Metapher einer Metapher, d.h. die Metapher seines eigenen Metaphern-Seins, eingeschrieben in die Sprache.
Es wäre interessant, an diesem Punkt einzuhalten und den Blick auf Lenaus Naturpoesie und seiner Auffassung über Symbol und Metapher zu lenken. Für Lenau stand die Frage, wie aus dem Naturleben Poesie zu machen sei; wie, in welcher Art sei in der Poesie ein Zusammenhang zur Natur herzustellen und welcher? Die Natur sollte dabei nicht einfach als Metapher für das Menschenleben stehen und letztlich auf dieses verweisen. Vielmehr dachte Lenau daran, die Natur als Gleichnis für etwas Anderes einzusetzen. Doch was ist dieses Andere ? Und worin besteht der Einsatz ?
Lenau schrieb: ,,Ich meine, der Dichter soll seine Gebilde im Innern und aus seinem Innern hervorschaffen, und die äußere Natur soll ihm nur aus der Erinnerung, die im Augenblicke der dichterischen Tätigkeit freilich zur fruchtbaren Anschauung werden muss, gewisse Mittel suppeditieren! Kürzer, die angeschaute und zum Symbol gewandelte Naturerscheinung soll nie Zweck, sondern nur Mittel sein zur Darstellung einer poetischen Idee."11
Zwei Dinge erscheinen mir wichtig: Die Naturerscheinung wird zum Symbol (sie muss nicht konkret sein - es geht nicht um Naturdarstellung -, sie kann und sollte deshalb aus der Erinnerung geschöpft werden) und sie soll nie Zweck sein, für sich alleine stehen, sondern ,,Mittel zur Darstellung einer poetischen Idee"; sie soll auf etwas verweisen.
,,Die wahre Naturpoesie", sagt Lenau an anderer Stelle vier Jahre später, muss ,,die Natur und das Menschenleben in einen innigen Konflikt bringen, und aus diesem Konflikte ein drittes Organischlebendiges resultieren lassen, welches ein Symbol darstelle jener höheren geistigen Einheit, worunter Natur und Menschenleben begriffen sind."12
In der Tat hat dieser Gedanke viel mit Hegels Vorstellung der Synthese und der Aufhebung speziell im Sinne des Höherhebens gemein. Die ,,wahre Naturpoesie" eröffne also den Blick auf etwas Drittes im Widerstreit von Natur und Menschenleben und dieses Dritte sei wiederum Symbol einer ,,höheren geistigen Einheit", welche die Synthese ist. Natur und Menschenleben müssten demnach in jenem Dritten zusammenlaufen, um nicht zu sagen verschmelzen, bevor sie zum Symbol für etwas Höheres werden können. Nicht die Natur, sondern die Naturpoesie oder ,,poetische Idee", jenes Dritte, soll ein Symbol sein (was mit dem vorangehenden Zitat kontrastiert, da dort bereits die Naturerscheinung zum Symbol gewandelt werden soll, es sei denn man spricht von einer aufsteigenden Symbolisierung) und zwar nicht des Menschenlebens oder anschauenden Ichs, sondern ,,jener höheren geistigen Einheit, worunter Natur und Menschenleben begriffen sind".
Ich möchte an die zwei mir wichtigen Dinge anknüpfen: das Symbol und die poetische Idee, die unversehens zu einem Problem verschmolzen, gesetzt, ich wähle das spätere Zitat zum Ausgangspunkt meiner Betrachtung, und dafür ein weiteres Problem eröffnen: die ,,höhere geistige Einheit".
Ich glaube nicht, dass es sinnvoll und notwendig ist, diese ,,höhere geistige Einheit" als ,,geistig er" zu fassen und unabhängig existent von der poetischen Tätigkeit13, was darauf hinauslaufen würde, Lenau naive Metaphysik zu unterstellen und selbst diese zu betreiben und eine Hierarchie von Geistigkeiten zu etablieren.
Doch sei zunächst mit dem Symbol begonnen. Entgegen einer Dominanz der Allegorie in der Dichtung des Mittelalters und Renaissance beginnt in der Romantik, sogar schon in der deutschen Klassik, nämlich, so will es der Meister selbst, mit Goethe, der Aufstieg des Symbols:
,,Es ist ein großer Unterschied, ob der Dichter zum Allgemeinen das Besondere sucht oder im Besonderen das Allgemeine schaut. Aus jener Art entsteht, wo das Besondere nur als Beispiel, als Exempel des Allgemeinen gilt; die letztere aber ist eigentlich die Natur der Poesie, sie spricht ein Besonderes aus, ohne ans Allgemeine zu denken oder darauf hinzuweisen. Wer nun dieses Besondere lebendig fasst, erhält zugleich das Allgemeine mit, ohne es gewahr zu werden, oder erst spät."14
,,Die Symbolik verwandelt die Erscheinung in eine Idee, die Idee in ein Bild, und so, dass die
Idee im Bild immer unendlich wirksam und unerreichbar bleibt und, selbst in allen Sprachen ausgesprochen, doch unaussprechlich bliebe.
Die Allegorie verwandelt die Erscheinung in einen Begriff, den Begriff in ein Bild, doch so, dass der Begriff im Bilde immer noch begrenzt und vollständig zu halten und zu haben und an demselben anzusprechen sei."15
Das Symbol drückt nach Goethe etwas Einzelnes, Individuelles, Besonderes aus; es schaut das Allgemeine im Besonderen; es überschreitet die Sprache. Das Symbol ist kein Zeichen (sic!), es ist und es ist das Objekt. Für einen Christen wäre es Blasphemie zu behaupten, Brot und Wein seien nichts weiter als ein Zeichen, etwas steht für etwas anderes, für das Fleisch und Blut Jesu; das Brot ist das Fleisch, der Wein ist das Blut Jesu. Es bliebe zu untersuchen, in wie fern das Symbol mit der Religiosität des Menschen verflochten ist, wobei ich nicht die Möglichkeit eines ,,reinen" Atheismus unterstelle, denn ich bezweifle, ob so etwas überhaupt möglich ist. Jeder Mensch hat Werte und eben ein Wert beruht auf der Wirkungsweise des Symbols. Es sei denn wir stellten die Frage nach dem Nichts.
Ist die Allegorie diskursiv (und Diskursivität verweist immer auf einen Kontext), dann ist das Symbol, und der Leser verzeihe mir bitte diese Tautologie, ,,symbolisch" (Lacan allerdings würde ,,imaginär" sagen), d.h. die Projektion eines Wertes auf ein Ding oder Wort - eine nicht reflektierte oder nicht mittelbare (also un mittelbare) Sinnzuweisung. Etwas erhält Sinn aufgrund seines Da- Seins. So verweist das Symbol (das Ding als Symbol) über sich hinaus auf einen allgemeineren, abstrakten, ,,geistig-höheren" Zusammenhang wie das Kreuz auf den christlichen Glauben, die Rose auf die Liebe. Es ist sinnliches Zeugnis für etwas Ideenhaftes. Für Goethe ist es die ,,Begrifflichkeit", die als Hemmnis in der Allegorie wirkt: ,,[...] doch so, dass der Begriff im Bilde immer noch begrenzt und vollständig zu halten und zu haben und an demselben anzusprechen sei." Der Begriff begrenzt das Bild, denn er ist immer noch in diesem enthalten (der Begriff ist a priori begrenzend), während im Symbol die Abwesenheit des Begriffes eine ,,Unendlichkeit" und ,,Unaussprechlichkeit" bewirke. Das Nicht-Gewahr-Werden, die Unaussprechlichkeit, kurz das Widerstreben jeglichen Verstehens führt uns zum Sublimen (und zurück zur Ferne). Das Symbol bietet für die Romantik, und Goethe steht hier auf der Schwelle zu ihr, der alte, ,,kranke" (wie er die Romantik selbst beschrieb) Goethe, ein Ausbrechen aus der Sprache zu einer Art Intuition, einem erhabenen Gefühl, das in dem Maße entweder mit Schauder und Schrecken oder mit religiöser Erhabenheit und Ehrfurcht gefüllt ist, so dass die Worte fehlen, dass Worte nicht mehr genügen, um etwas Gleichwertiges darzustellen oder auszudrücken, gerade weil das Sublime die Idee des Maßlosen ist. Für Kant wäre sogar alles, was aus der Kategorie der Vernunft stammt, jede Idee undarstellbar bzw. nur negativ darstellbar, wobei sichtbar gemacht wird, indem verboten wird zu sehen.
Zugleich kommt etwas anderes ins Spiel und ich bleibe dazu bei Kant. Zwischen Vernunft und Verstand, so Kant, liegt etwas Drittes, ein ,,Mittelglied"; zwischen der ,,praktischen Vernunft", die uns die Idee der Freiheit gibt, und der ,,reinen, theoretischen Vernunft", unserer Erkenntniskraft, befindet sich die ,,ästhetische Urteilskraft". Sie fungiert als ,,Bindeglied".16
Ist vielleicht hier zwischen menschlicher Vernunft und dem Verstehen der Naturerscheinungen das ,,Dritte" zu suchen? Die Frage beantwortet sich von selbst, wenn das ,,dritte Organischlebendige" mit der ,,poetischen Idee" identifiziert wird. Bleibt zu fragen, wo die ,,höhere geistige Einheit" zu finden ist.
Der beschriebene Mechanismus des Symbols plaziert den Ort dieser Einheit ins Außersprachliche, in die Sphäre der Intuition, der erhabenen Empfindung, vielleicht in einen Bereich eines Mystisch-Höhergeistigen. Vielleicht aber ist dieser Ort aber auch nur ein Effekt des sprachlichen Systems, der ,,Sprache-als-Gesetz", wie Foucault sagt17 und diese ,,höhere geistige Einheit" ist nirgendwo anders zu finden als in der ,,sprachlichen Bewegung" oder der ,,Sprache-als-Gesetz", denn es ist das System selbst, das seine eigene Überschreitung, sein Außen produziert und generiert. Und es bleibt zu fragen, ob nicht dieses Äußere ,,geordneter" und affirmativer ist als das Innere, Umrahmte des Systems, gesetzt, das System trachtet danach, alle Erscheinungen und alles Ereignishafte zu assimilieren. Das System wäre deshalb besorgter, ein geordnetes Außen zu installieren, in der Illusion es beherrsche bereits das Assimilierte.18 Es folgt konsequent: Im System liegt das Chaotische und der Widerstand, nicht außerhalb.19,,Wo es Macht gibt, gibt es Widerstand."20
Was heißt das für unsere Betrachtung? Nicht außerhalb der Sprache-als-Gesetz, nicht außerhalb der sprachlichen Bewegung, nicht in Sphären einer Intuition ist die gesuchte
,,Einheit" zu finden, nicht in der Intuition funktioniert der Mechanismus des symbolischen Verweises, sondern gerade in der Sprache-als-Gesetz. Und vielleicht habe ich schon einen Schlüssel gegeben. Um nicht zu sagen: Ich habe schon gesagt, was ich meinte zu sagen. Das Leben ist Metapher der Metapher, des Metaphern-Seins der Sprache, ihres alle-gorischen (allos = das Andere) Charakters. Der Strom des Lebens ist zugleich der Wechsel zwischen An- und Abwesenheit, zwischen Licht und Dunkel:
Trübe wird's, die Wolken jagen,
Und der Regen niederbricht,
Und die lauten Winde klagen:
,,Teich, wo ist dein Sternenlicht?"
Den Strom des Lebens finden wir wieder in der Unentscheidbarkeit unseres Lesens, entweder in der von mir aufgegriffenen Passage aus der ersten Strophe der Schilflieder oder hinsichtlich weltanschaulicher Fragen und poetisch-methodischer Auffassungen.21
Und Leben ist nichts weiter als sprachliche Bewegung, als das, was die Sprache über sich aussagt und nur aussagen kann: Lesen und Schreiben - eine doppelte Geste.
[...]