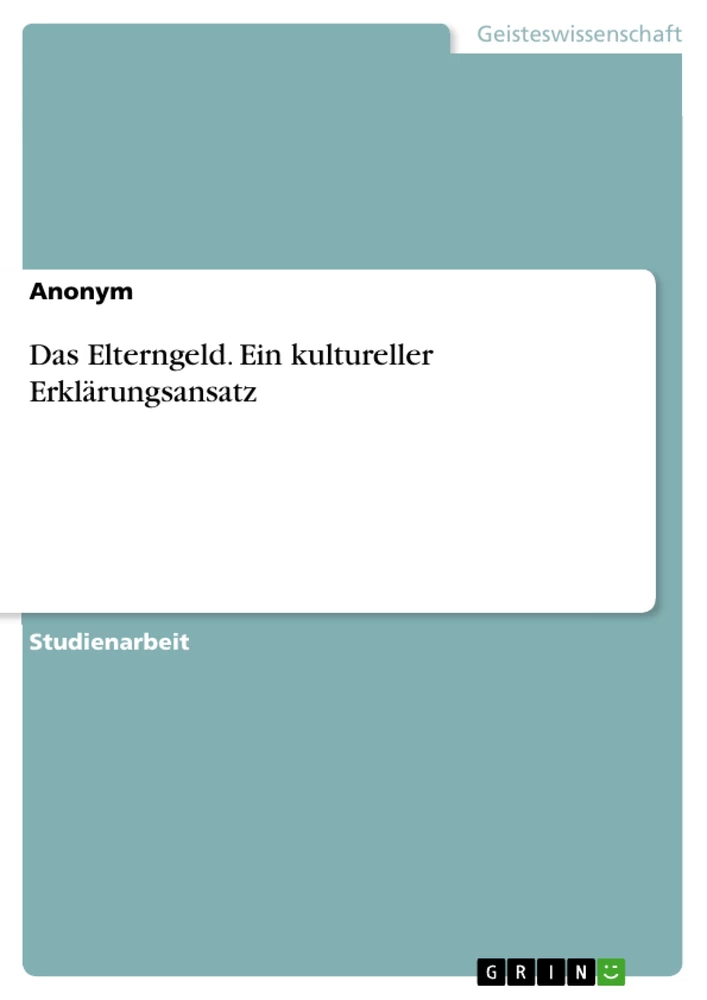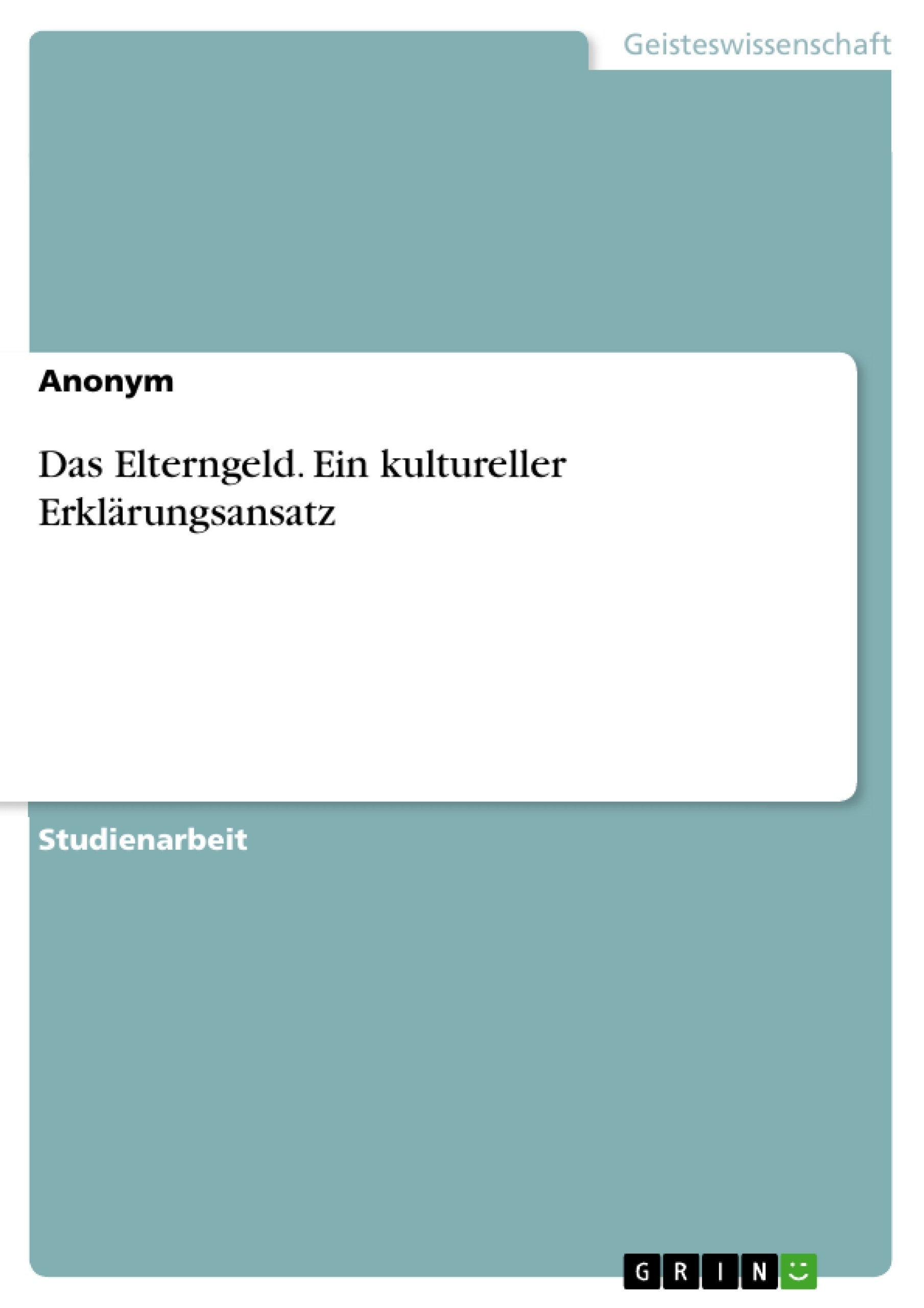Ziel dieser Arbeit soll sein, der Frage nachzugehen, ob eine kulturelle Erklärung des Elterngelds tatsächlich möglich ist. Methodisch fußt sie auf der Analyse von Sekundärliteratur. Im nachfolgenden zweiten Kapitel werden Kultur allgemein sowie die Kultur des deutschen Wohlfahrtsstaats definiert. Kapitel 3 gibt einen kurzen Überblick über die deutsche Familienpolitik, während das Elterngeld in Kapitel 4 vorgestellt wird. Mögliche Erklärungsansätze werden im fünften Kapitel diskutiert. Ich schließe mit einem Fazit.
Das 2007 paradoxerweise von einer konservativen Ministerin eingeführte Elterngeld hat in der Wissenschaft zu einiger Verwunderung geführt, da es in Gender-Aspekten einem Paradigmenwechsel gleichkam. Ausgehend von der kulturellen Fundierung hätte eine solche Reform eigentlich nicht stattfinden dürfen. Eine mögliche Argumentation wäre, dass Politik eben doch „matters“ und sie die Reform als Antwort auf ökonomische Zwänge (Stichwort demographischer Wandel) durchsetzte. Andererseits könnte aber auch beim Elterngeld ein kultureller Erklärungsansatz verwendet werden, denn auch wenn der Idealtypus der klassischen Kernfamilie nach wie vor hohe Relevanz in Deutschland hat, so ist es in den letzten Jahrzehnten dennoch zu einer deutlichen Pluralisierung der Lebensformen gekommen. Gleiches gilt für die Erwerbsquote von Frauen mit Kindern. Die kulturellen Rahmenbedingungen hätten sich demnach geändert und so die Einführung des Elterngelds ermöglicht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition von Kultur
- Familienpolitik in Deutschland: Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Das Elterngeld
- Erklärungsansätze
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die kulturelle Erklärung des 2007 eingeführten deutschen Elterngeldes. Sie hinterfragt, ob ein kulturalistischer Ansatz die Einführung dieser familienpolitischen Maßnahme ausreichend erklären kann, insbesondere im Kontext des konservativen deutschen Wohlfahrtsstaatsmodells. Die Arbeit analysiert die relevanten Aspekte der deutschen Familienpolitik, das Elterngeld selbst und diskutiert verschiedene Erklärungsansätze.
- Definition und Anwendung des Kulturbegriffs im Kontext des deutschen Wohlfahrtsstaats
- Analyse der traditionellen Geschlechterrollen und Familienstrukturen in Deutschland
- Die Rolle der Religion und des katholischen Weltbildes in der deutschen Familienpolitik
- Das deutsche Elterngeld als Beispiel für einen politischen Paradigmenwechsel
- Diskussion verschiedener Erklärungsansätze für die Einführung des Elterngeldes (kulturell vs. ökonomisch)
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt den deutschen Wohlfahrtsstaat im Kontext der Typologisierung von Esping-Andersen vor und skizziert das „male-breadwinner-model“ mit seinen klar definierten Geschlechterrollen. Sie führt das Elterngeld als scheinbar paradoxen Fall innerhalb dieses Modells ein und formuliert die Forschungsfrage nach der Möglichkeit einer kulturellen Erklärung für dessen Einführung. Die Einleitung umreißt die methodische Vorgehensweise und den Aufbau der Arbeit.
Definition von Kultur: Dieses Kapitel analysiert den vielschichtigen Kulturbegriff, beleuchtet dessen etymologischen Ursprung und die Schwierigkeiten einer eindeutigen Definition. Es werden verschiedene, teils wertfreie und werthaltige Bedeutungsfacetten des Begriffs „Kultur“ diskutiert, um einen Rahmen für die spätere Analyse zu schaffen. Die Vieldeutigkeit des Begriffs wird hervorgehoben und die Grenzen einer umfassenden Definition aufgezeigt.
Die Kultur des deutschen Wohlfahrtsstaats: Dieser Abschnitt untersucht den Einfluss kultureller Faktoren auf den deutschen Wohlfahrtsstaat. Er betrachtet die religiöse Fundierung, die Rolle der Sozialversicherungen und die traditionellen Geschlechterrollen als wichtige Bestandteile der deutschen Wohlfahrtskultur. Die negative Einstellung gegenüber Langzeitarbeitslosigkeit und atypischen Beschäftigungsformen wird im Kontext der beitragsfinanzierten Sozialversicherungen erklärt. Die Bedeutung religiöser Institutionen im sozialen Bereich wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Elterngeld, Familienpolitik, Wohlfahrtsstaat, Deutschland, Kultur, Geschlechterrollen, Dekomodifizierung, katholisches Weltbild, Esping-Andersen, kulturelle Erklärung, Paradigmenwechsel, demographischer Wandel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Kulturelle Erklärung des deutschen Elterngeldes
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die kulturelle Erklärung der Einführung des deutschen Elterngeldes im Jahr 2007. Sie analysiert, ob ein kulturalistischer Ansatz die Einführung dieser familienpolitischen Maßnahme im Kontext des konservativen deutschen Wohlfahrtsstaatsmodells ausreichend erklären kann.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Anwendung des Kulturbegriffs im Kontext des deutschen Wohlfahrtsstaats, die Analyse traditioneller Geschlechterrollen und Familienstrukturen in Deutschland, die Rolle der Religion (insbesondere des katholischen Weltbildes) in der deutschen Familienpolitik, das deutsche Elterngeld als Beispiel für einen politischen Paradigmenwechsel und eine Diskussion verschiedener Erklärungsansätze für die Einführung des Elterngeldes (kulturell vs. ökonomisch).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zur Definition von Kultur, ein Kapitel zur Familienpolitik in Deutschland mit Fokus auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und das Elterngeld, ein Kapitel zu Erklärungsansätzen und einen Schluss. Die Einleitung stellt den deutschen Wohlfahrtsstaat vor und führt das Elterngeld als scheinbar paradoxen Fall ein. Die Zusammenfassung der Kapitel bietet detailliertere Einblicke in den Inhalt jedes Kapitels.
Welche methodische Vorgehensweise wird angewendet?
Die methodische Vorgehensweise wird in der Einleitung umrissen. Die Arbeit analysiert den Kulturbegriff, untersucht den Einfluss kultureller Faktoren auf den deutschen Wohlfahrtsstaat und diskutiert verschiedene Erklärungsansätze für die Einführung des Elterngeldes, um die Forschungsfrage nach der Möglichkeit einer kulturellen Erklärung zu beantworten.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Elterngeld, Familienpolitik, Wohlfahrtsstaat, Deutschland, Kultur, Geschlechterrollen, Dekomodifizierung, katholisches Weltbild, Esping-Andersen, kulturelle Erklärung, Paradigmenwechsel, demographischer Wandel.
Wie wird der Kulturbegriff definiert und angewendet?
Das Kapitel zur Definition von Kultur analysiert den vielschichtigen Kulturbegriff, beleuchtet dessen etymologischen Ursprung und die Schwierigkeiten einer eindeutigen Definition. Es werden verschiedene Bedeutungsfacetten diskutiert, um einen Rahmen für die spätere Analyse zu schaffen. Die Vieldeutigkeit des Begriffs und die Grenzen einer umfassenden Definition werden hervorgehoben.
Welche Rolle spielt der deutsche Wohlfahrtsstaat?
Die Arbeit untersucht den Einfluss kultureller Faktoren auf den deutschen Wohlfahrtsstaat, betrachtet dessen religiöse Fundierung, die Rolle der Sozialversicherungen und die traditionellen Geschlechterrollen. Die negative Einstellung gegenüber Langzeitarbeitslosigkeit und atypischen Beschäftigungsformen wird im Kontext der beitragsfinanzierten Sozialversicherungen erklärt. Die Bedeutung religiöser Institutionen im sozialen Bereich wird hervorgehoben.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Schlussfolgerung der Arbeit wird im Kapitel "Schluss" gezogen und fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen. Es wird bewertet, inwieweit eine kulturelle Erklärung die Einführung des Elterngeldes hinreichend erklärt.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2012, Das Elterngeld. Ein kultureller Erklärungsansatz, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1002106