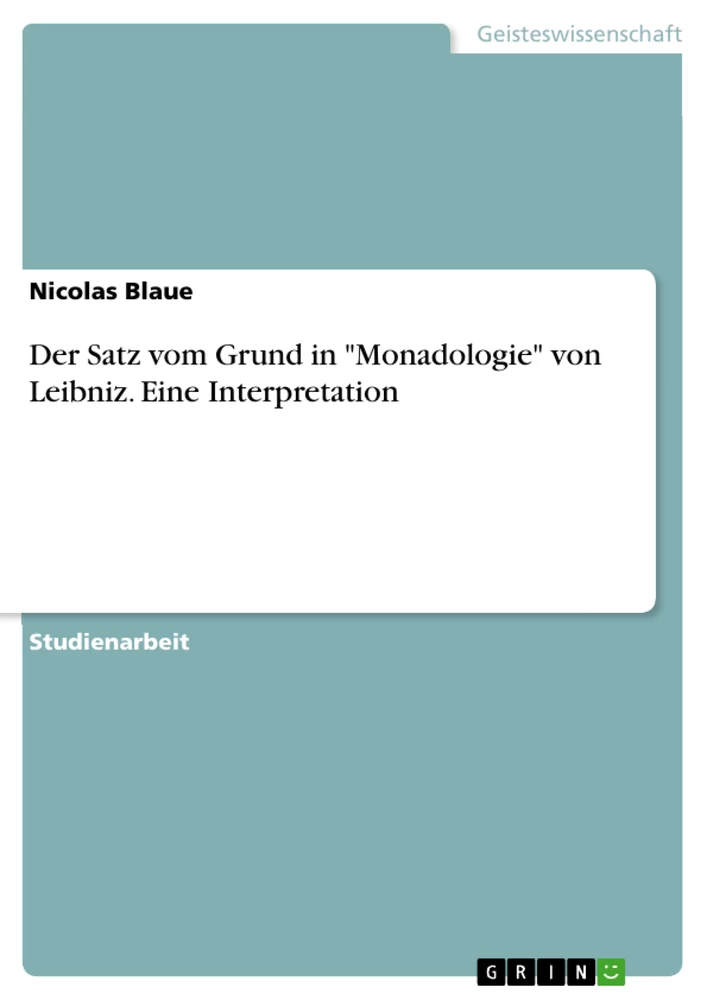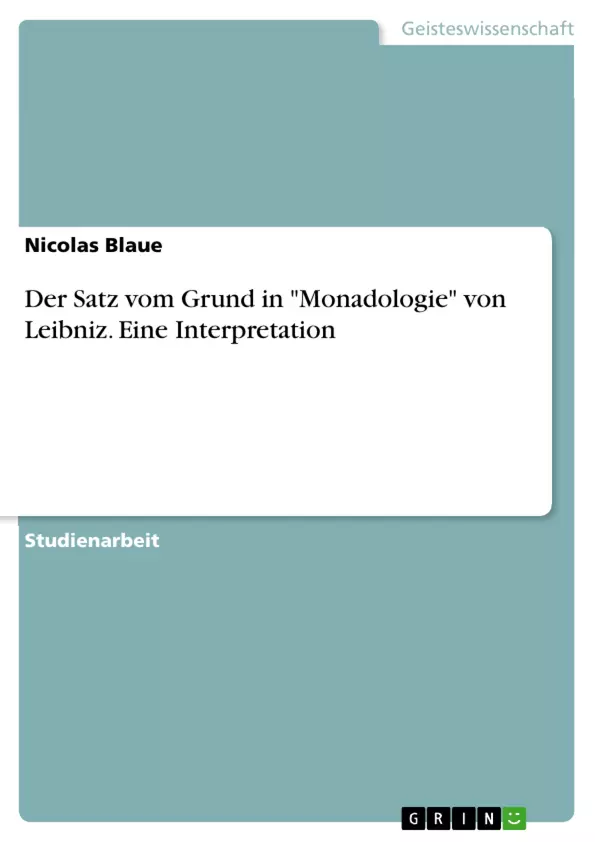In dieser Arbeit soll Leibniz‘ Behandlung der Grundthematik am Textbeispiel der Monadologie aufgezeigt werden. Diese Arbeit will eine interpretatorische sein.
In diesem Spätwerk von Leibniz wird das Modell der Monaden aufgeführt, welches im Verlaufe des Werks zu den ewigen Wahrheiten und dessen letzten Grund führt, der auch der letzte Grund des Seienden ist. Darauf baut Leibniz eine metaphysische Gottesphilosophie auf, woran sich eine Erörterung anschließt, wie Gott mit den übrigen Wesenheiten zusammenarbeitet.
Diese Arbeit arbeitet nah an der Primärliteratur und nimmt einen größtenteils chronologischen Durchgang des Werks mit den wichtigsten Passagen vor, die der Hinführung zur Grundthematik und der Urmonade Gott in Leibnizens Philosophie dienlich sind.
Der erste Teil beschäftigt sich vor allem mit der Monaden-Theorie, während der zweite Teil explizit die Grundthematik herausstellt und den Übergang zur Gottesphilosophie aufzeigt. Die Monadologie sticht deswegen aus Leibniz Werken heraus, weil sie das System der Monaden aufzeigt und darauf aufbauend die These des zureichenden Grundes einführt.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Monadologie
1.1. Der Begriff der Monade und der einfachen Substanz
1.2.Perzeption, Apperzeption und Appetition
2. Der Satz vom Grund in der Monadologie
2.1.Der zureichende Grund und die Wahrheit
2.2.Die Urmonade Gott und die prästabilisierte Harmonie
Fazit
Quellen
Einleitung
Gottfried Wilhelm Leibniz (geboren am 21. Juni 1646 in Leipzig und gestorben am 14. November 1716 in Hannover) gilt als einer der genialsten Metaphysiker der Aufklärung und als einer der großen Philosophen der Neuzeit. Als Metaphysiker knüpft Leibniz wieder an Aristoteles und an dessen „Philosophen-Gott“ in dessen Erster Philosophie, womit Leibniz die Thematik des letzten Grundes aufgreift. Leibniz sieht den letzten Grund, also Gott, allerdings nicht wie Aristoteles nur als Beweger im Kosmos und als Träger der höchsten Gedanken an, ihm kommen bei Leibniz noch ausdifferenziertere Aufgaben zu.
In dieser Hausarbeit soll Leibniz‘ Behandlung der Grundthematik am Textbeispiel der Monadologie aufgezeigt werden d.h., diese Hausarbeit will eine interpretatorische sein. In diesem Spätwerk von Leibniz wird das Modell der Monaden aufgeführt, welches im Verlaufe des Werks zu den ewigen Wahrheiten und dessen letzten Grund führt, der auch der letzte Grund des Seienden ist. Darauf baut Leibniz eine metaphysische Gottesphilosophie auf, woran sich eine Erörterung anschließt, wie Gott mit den übrigen Wesenheiten zusammenarbeitet. Diese Hausarbeit arbeitet nah an der Primärliteratur und nimmt einen größtenteils chronologischen Durchgang des Werks mit den wichtigsten Passagen vor, die der Hinführung zur Grundthematik und der Urmonade Gott in Leibnizens Philosophie dienlich sind. Der erste Teil der Hausarbeit beschäftigt sich vor allem mit der Monaden-Theorie, während der zweite Teil explizit die Grundthematik herausstellt und den Übergang zur Gottesphilosophie aufzeigt. Die Monadologie sticht deswegen aus Leibniz Werken heraus, weil sie das System der Monaden aufzeigt und darauf aufbauend die These des zureichenden Grundes einführt.
Die Monadologie, verfasst 1714, gilt als das wichtigste metaphysische Werk von Leibniz. Bekannt geworden ist es unter dem Titel „Lehrsätze der Philosophie“ (principii philosophiae).1 Das Werk selbst besteht aus insgesamt 90 Paragrafen.
Als Kind seiner Zeit schrieb Leibniz auf Französisch. Für diese Hausarbeit wird nicht das französische Original der Monadologie (ursprünglich: Eclaircissement sur les Monades) verwendet, sondern ausschließlich die deutsche Übersetzung von Ulrich Johannes Schneider, die im Felix Meiner Verlag erschienen ist. Für eine bessere Übersichtlichkeit werden nach direkten und indirekten Zitaten für die jeweiligen Textpassagen, auf die Bezug genommen wird, nur die entsprechenden Paragrafen in Klammern angeführt, welche auf die Übersetzung von Ulrich Johannes Schneider verweisen. Das Werk findet sich am Ende der Hausarbeit in den Quellverweisen.
1. Monadologie
1.1. Der Begriff der Monade und der einfachen Substanz
Leibniz stellt in seiner metaphysischen Schrift, der Monadologie, das Weltsystem der Monaden vor, wie aus dem Namen bereits zu entnehmen ist d.h., dass im Prinzip alles aus Monaden bestehe. Die Monade ist dem griechischen Terminus monás (μονάς) entlehnt und bedeutet so viel wie „Einheit“. Als erste Einführung in seine Monadentheorie charakterisiert Leibniz die Monade als einfache Substanz, die selbst keine Teile hat (§1). Diese einfache Substanz hält nach Leibniz Einzug in die zusammengesetzten Dinge; hier vollzieht Leibniz gleich eine grundlegende Differenzierung der vorhandenen Dinge (§§1,2). Auf der einen Seite steht die einfache Substanz, die als Essenz der Dinge verstanden werden kann, und auf der anderen Seite ein Konglomerat aus verschiedenen Teilen mit bestimmten Gestaltungen, Ausformungen und Ausdehnungen, die im Zusammenwirken das zusammengesetzte Ding ergeben, in das die einfache Substanz hineinkommt. Leibniz spricht von der Monade der einfachen Substanzen auch als von den „wahrhaften Atome[n] der Natur“ (§3). Die reine Monade der einfachen Substanz kennt somit weder Form, Gestalt, Teilbarkeit und Ausdehnung, noch kennt sie Anfang und Vergängnis, wie Leibniz weiter beschreibt (§§3-5).
Im sechsten Paragrafen erläutert Leibniz den Seinsgrund der Monaden in einer proleptischen Vorausdeutung; im Vorblick auf die Entwicklung der Gottesphilosophie im späteren Verlauf des Werks:
„6. So läßt sich sagen, daß die Monaden nur auf einen Schlag anfangen und enden können, d.h. sie können nur durch Schöpfung anfangen und durch Vernichtung enden; während das, was zusammengesetzt ist, durch Teile anfängt oder endet.“ (§6)
Einen dualistischen Weltentwurf stellt Leibniz in diesem Paragrafen vor; die Monaden, die nur von Gottes Gnaden existieren und nur durch dessen Eingreifen enden können, stehen konträr zu den zusammengesetzten Dingen, die sich nach dem ersten Beginn der Schöpfung zusammensetzen und sich vor dem Ende derselben wieder auflösen. Man könnte auch sagen, die ewige geistige Essenz der Dinge steht in seinem Wesen polar den vergänglichen Teilen der Welt gegenüber.
Weiters sind die Monaden unbeweglich durch äußere Einwirkungen von Lebewesen z.B. und erfahren somit keine Veränderung von außen, da es in ihnen keine Teile gibt, welche aufeinander einwirken könnten (§7). Um nun nicht in ein völlig statisches und zugleich von Qualitäten befreites Bild der Monaden zu verfallen, entwirft Leibniz ein deszendent bestimmendes und gestaltendes Prinzip der Monaden, denn nur so kann die Monade noch erklärbar sein, wenn Leibniz über sie sagt:
„So kann weder Substanz noch Akzidenz von außen in eine Monade eintreten“ (§7).
Wenn nach Leibniz die Monaden nach außen hin hermetisch verschlossen sind, so müssen sie deszendent veränderbar sein. In den Paragrafen acht bis zehn schreibt Leibniz zu dieser Problematik Folgendes:
„8. Gleichwohl müssen die Monaden einige Qualitäten haben, sonst wären sie nicht einmal Seiende. Und wenn die einfachen Substanzen sich nicht durch ihre Qualitäten unterschieden, gäbe es kein Mittel, sich einer Veränderung in den Dingen bewußt zu werden, denn was in dem Zusammengesetzten ist, kann nur aus den einfachen Zutaten kommen; Monaden ohne Qualitäten wären untereinander ununterscheidbar, da sie sich in der Qualität ebensowenig unterscheiden: Bei vorausgesetzter Fülle würde folglich jeder Ort in der Bewegung immer nur das Äquivalent dessen erhalten, was er empfangen hat; und ein Zustand der Dinge wäre vom anderen ununterscheidbar.
9. Es ist sogar erforderlich, daß jede Monade von jeder anderen unterschieden sei. Denn es gibt in der Natur niemals zwei Seiende, die vollkommen eins wie das andere wären und wo es nicht möglich wäre, einen inneren oder auf einer intrinsischen Bezeichnung gegründeten Unterschied zu finden.
10. Ich nehme als zugestanden an, daß jedes geschaffene Seiende der Veränderung unterliegt und folglich auch die geschaffene Monade, und sogar, daß diese Veränderung in einer jeden kontinuierlich ist.“ (§§8-10)
Aus diesen Paragrafen kann festgehalten werden, dass Monaden untereinander durchaus unterschiedlich sind und dass sie einer steten Veränderung unterliegen und es kann geschlussfolgert werden, dass die Unterschiedlichkeit der Dinge in der Welt nach Leibniz in der intrinsischen Unterschiedlichkeit der Monaden selbst, welche als einfache Substanzen in den Dingen selbst sind, liegt. Daraus ergibt sich die Frage, wie die Veränderung und die Unterschiedlichkeit der Monaden zustande kommt und wie diese beeinflusst werden, wenn eben dies doch, so Leibniz, akzidentell unmöglich ist. Die Antwort auf die Frage der Veränderung sieht Leibniz in dem konstituierenden inneren Prinzip der Monaden (§11). Die Veränderung im speziell Einzelnen bewirkt allerdings eine Differenz und Unterscheidbarkeit der einfachen Substanzen untereinander und zwar dadurch, dass „in der Einheit oder im Einfachen eine Vielheit ein[ge]hüll[t]“ wird, „auch wenn es in ihr keine Teile gibt“ (§§12,13). Obwohl Leibniz den einfachen Substanzen eine absolute Einheit und Indifferenz zugesteht, in der es keine Teile gibt, meint er dennoch, dass es in dieser Einheit eine Vielheit gibt, unter der sich eine Vielzahl von Wechselbeziehungen abspielt, die das Einzelne zum spezifisch Besonderen und Unterscheidbaren macht.
1.2. Perzeption, Apperzeption und Appetition
Im 14. Paragrafen führt Leibniz erstmalig in seiner Schrift die Begriffe Perzeption und Apperzeption ein. Dort heißt es:
„14. Der vorübergehende Zustand, der in der Einheit oder in der einfachen Substanz eine Vielheit einhüllt und vorstellt, ist nichts anderes als das, was man die Perzeption nennt, die man von der Apperzeption oder dem Bewußtsein wohl unterscheiden muß, wie sich in der Folge zeigen wird.“ (§14)2
Die Vielheit in der Einheit selbst erklärt Leibniz somit mit dem profanen Wahrnehmungsvorgang an sich, der an das Sein gebunden ist, der allerdings ungleich der scharfen Inhaltswahrnehmung, der Apperzeption, gegenübersteht.3 Weiters sagt er:
„16. Wir erfahren selbst eine Vielheit in der einfachen Substanz, sobald wir finden, daß der kleinste uns bewußte Gedanke in seinem Gegenstand eine Vielheit einhüllt.“ (§16)
Eine Perzeption der Monade, oder der einfachen Substanz, bezieht sich also auf den Gegenstand der Sache selbst und auf die Vielheit, die darin monadisch vorhanden ist, dennoch die Vielheit darin eine Einheit bildet. Weiterhin gibt es verschiedene Seinszustände der Monaden, die Leibniz auch Perzeption nennt. Das Übergehen von einer Perzeption zu bzw. in eine andere begründet Leibniz mit der Handlung des inneren Prinzips (§15). Diesen Übergang beschreibt Leibniz mit dem Begriff Appetition. Dieser Prozess führe zu immer weiteren Perzeptionen.
Da die einfachen Substanzen bzw. Monaden nach Leibniz Vollkommenheit und Selbstgenügsamkeit aufweisen, nennt er sie auch Entelechien (§18). Nach Leibniz liegt die Quelle der Handlung der Entelechien in denselben, womit er diesen Entelechien eine große Autonomie zuschreibt.
Eine zentrale Differenzierung zwischen einfacher Substanz, tierischer Seele und menschlicher Seele vollzieht Leibniz ab dem 19. Paragrafen:
„[…] weil aber die Empfindung etwas mehr als die einfache Perzeption ist, stimme ich zu, daß der der allgemeine Name der Monaden oder Entelechien für die einfachen Substanzen zureicht, die nur dieses haben, und daß man Seele allein diejenigen nennt, deren Perzeption deutlicher ist und von Gedächtnis begleitet.“ (§19)
Somit ist eine einfache Substanz etwas, das zwar auch eine Perzeption besitzt, allerdings ist diese undeutlicher. Das Gedächtnis wie auch das Bewusstsein der eigenen Perzeptionen bleibt nur den Seelen vorbehalten. Die Monaden der einfachen Substanzen sind bewusstseinsmäßig nach Leibniz in einer tiefen, unbewussten Benommenheit (§23).
Die Differenzierung zwischen Seele und einfacher Substanz erläutert Leibniz in den folgenden Paragrafen noch weiter:
„20. Denn wir erfahren in uns selbst einen Zustand, in dem wir uns an nichts und von dem wir uns an nichts erinnern und von dem wir keine deutliche Perzeption haben; wie wenn wir in Ohnmacht oder in einen traumlosen, tiefen Schlaf fallen. In diesem Zustand unterscheidet sich die Seele nicht merkbar von einer einfachen Monade, weil aber dieser Zustand nicht dauerhaft ist und sie sich ihm entzieht, ist sie etwas mehr.
[…]
23. … wenn man sich also beim Erwachen aus der Benommenheit seiner Perzeptionen bewußt wird, muß man unmittelbar zuvor welche gehabt haben, auch wenn man sich ihrer nicht bewußt war. Denn eine Perzeption kann natürlicherweise nur aus einer anderen Perzeption stammen […].
24. Von daher sieht man, daß wir immer in der Benommenheit wären, wenn wir nichts Deutliches und sozusagen Hervorgehobenes und Vorschmeckendes in unseren Perzeptionen hätten. Das ist der Zustand der gänzlich nackten Monaden.“ (§§20, 23, 24)
So gibt es also einen Zustand, in der die Seele ähnlich den einfachen Substanzen ist, nämlich während des Schlafes (§20). Sobald die Seele in den Wachzustand kommt, wird sie sich ihrer selbst bewusst und verlässt den Seinszustand der einfachen Substanzen (§23). Eine Besonderheit ist „der Zustand der gänzlich nackten Monaden“, den Leibniz beschreibt (§24). Dieser bestünde darin, den Perzeptionen vollkommen und gänzlich ausgeliefert zu sein ohne jegliches Vorfühlendes, das einen Voreindruck vermittelt (§24). Die Lebewesen haben also vorausgehende, aber unscharfe Perzeptionen, die durch die Sinnesorgane vermittelt werden (§25).
Den Unterschied zwischen tierischen Seelen und menschlichen Seelen beschreibt Leibniz wie folgt:
„28. Die Menschen handeln wie Tiere, sofern die Aufeinanderfolge ihrer Perzeptionen sich nur durch das Prinzip des Gedächtnisses ergibt; ähnlich den empirischen Medizinern, die eine einfache Praxis ohne Theorie haben; und wir sind Empiriker in drei Vierteln unserer Handlungen. Wenn man beispielsweise erwartet, daß es morgen hell wird, handelt man als Empiriker, weil das bis jetzt immer so geschah. Nur der Astronom urteilt darüber aus Vernunft.“ (§28)
In anderen Worten könnte man nach Leibniz auch sagen, dass der durchschnittliche Mensch zu drei Vierteln wie ein Tier handelt, da das Tier nur auf der Erfahrung aufbaut, die sich im Gedächtnis verankert; der Mensch aber kann auch aus Vernunft handeln, so Leibniz, selbst wenn er im Alltag vieles von Erfahrungswerten abhängig macht.
Man könnte die qualitativ unterschiedlichen Monaden nach Leibniz in folgender Weise darstellen:
- Einfache Substanzen: Unklare Perzeptionen
- Tierische Seelen: Klarere Perzeptionen + Gedächtnis
- Menschliche Seelen: Klare Perzeptionen (Apperzeption) + Gedächtnis + Vernunft
Außerdem muss hinzugefügt werden, dass Leibniz in allen Monaden einen Spiegel des Universums sieht, wodurch sich unter anderem die einmalige Individualität der Monade zeigt; dass sie auf die selbe ewige Wahrheit einen völlig anderen Blick hat als alle anderen (§§56,57). Dies ist eine der wenigeren Stellen der Monadologie, wo der Ontologe Leibniz Anwandlungen von individuellen und subjektiven Erkenntnisansätzen gelten lässt und nicht nur versucht, reine Objektivität im Erkennen darzustellen.
Unerwähnt dürfen an dieser Stelle nicht die letzten Paragrafen der Monadologie bleiben, die der Interpretation sehr schwerfallen. So schreibt er den Menschen, den Geistern, wie schon vorher erwähnt, die Fähigkeit zu, das Universum zu erkennen. Nun seien die Geister aber nicht nur ein Spiegel des Universums, sondern auch ein Spiegel von Gott selbst. Die Erkenntnis hebe die Geister auf die Stufe einer kleinen Gottheit (§83). Die Beziehung zu Gott sei in diesem Fall auch eine besondere, da dieser für die Menschen nicht ein Erfinder sei, sondern eher wie ein Vater (§84). Anschließend daran die prekärste Textstelle:
„85. Von daher fällt es leicht zu schließen, daß die Ansammlung aller Geister den Gottesstaat bilden muß […]“ (§85)
Leibniz erklärt diesen Gottesstaat nicht weiter, außer dass er Harmonie und moralische Vollkommenheit bringen müsse (§§86-90). Diese Aussage ist durchaus kritisch zu betrachten, da sie fast ohne Grund und ohne weitere Erklärung vorgebracht wird.
2. Der Satz vom Grund in der Monadologie
2.1. Der zureichende Grund und die Wahrheit
Leibniz geht in seiner Monadologie davon aus, dass es ewige Wahrheiten gibt, die unmittelbar mit Gott verknüpft sind und die vom Menschen erkannt werden können (§29). Auch zur Erkenntnis eines übergeordneten Ichs des Menschen, seiner wahren Identität, könne der Mensch, so Leibniz, gelangen (§30). Dies benennt Leibniz als den Geist im Menschen. Dazu schreibt Leibniz:
„30. Durch die Erkenntnis ewiger Wahrheiten und ihrer Abstraktionen haben wir uns auch zu reflexiven Akten erhoben, die uns an das denken lassen, was sich Ich nennt, und zur Betrachtung darüber, daß dieses oder jenes in uns ist: So denken wir, indem wir an uns denken, an das Sein, an die Substanz, an das Einfache und das Zusammengesetzte, an das Immaterielle und an Gott selbst, indem wir begreifen, daß das, was in uns beschränkt ist, in ihm ohne Schranken ist. Diese reflexiven Akte liefern die Hauptgegenstände unserer Überlegungen.“ (§30)
Hiermit zeichnet Leibniz ein Bild des Menschen, das Gott mindestens ähnlich ist. Dass der Mensch überhaupt mit der Vernunft befähigt ist, lässt ihn Gedanken denken, die ihm die Welt erschließen und ihn zu den ewigen Wahrheiten führen, so Leibniz. Beachtlich ist, dass nach Leibniz der Mensch die Dinge in sich trägt, die auch Gott innehat, nur sind sie in ihm, anders als im Menschen, ohne Beschränkung (§30).
Für Leibniz ist die Erkenntnis und der Seinszustand Gottes im Reich der ewigen Wahrheiten angesiedelt, welche ihrerseits aber nur aufgrund Gottes bestehen (§43); weshalb er zuerst eine Überleitung zum Urgrund Gottes über den Bereich der Vernunft sucht, den er reflexive Akte nennt. Dieser einzusehende Vernunftbereich ist der der Differenzierung zwischen Wahrem und Unwahrem und dem diesen zugrundeliegenden Grund (§§31-33). Hierfür differenziert Leibniz zwischen zwei Arten von Wahrheiten. Die erste Art der Wahrheit nennt er die der Überlegung und die zweite die der Tatsache. Diese verschieden gearteten Wahrheiten werden im Gedankengerüst von Leibniz mit jeweils unterschiedlichen Attributen bestückt. Die Überlegungs-Wahrheiten sind nach Leibniz nämlich notwendig und können kein ihnen Entgegengesetztes haben. Wie ein solches Entgegengesetztes konkret aussehen könne, nennt Leibniz nicht, jedoch meint er, dass ein solches Entgegengesetztes einen Widerspruch in sich tragen müsse und sich dadurch selbst unmöglich mache. Des Weiteren können die Überlegungs-Wahrheiten nach Leibniz aber in einfachere Ideen aufgedröselt werden, wodurch man zu anfänglichen Prinzipien gelangt. Leibniz bringt an dieser Stelle das Beispiel der Mathematik ein, dass man durch diese Zurückführung nämlich zu Definitionen, Axiomen und Postulaten gelange (§§33-35). Die zweite Art der Wahrheit, die Leibniz einbringt, die Tatsachen-Wahrheit, sei jedoch kontingent und ihr Entgegengesetztes theoretisch möglich. Warum die Überlegungs-Wahrheit notwendig und die Tatsachen-Wahrheit kontingent ist, weiß Leibniz jedoch nicht mit einer diesseitigen Begründung anzugeben, erst in seiner Vertiefung in die Urmonade Gottes gibt er einen metaphysischen Grund dafür an; denn dass die ewigen Wahrheiten zur Erkenntnis Gottes führten, ist für Leibniz zweifelsfrei bewiesen:
„[…] Wir haben sie [die Existenz Gottes] gleichfalls durch die Realität der ewigen Wahrheiten bewiesen.“ (§45)
Der Weg über die Wahrheit ist für Leibniz somit ein Weg, um Gott zu erkennen und seine Existenz zu beweisen.
Die Thematik des Grundes wird in Leibnizens Monadologie im 36. Paragrafen das erste Mal explizit genannt, und zwar als denjenigen Grund, der den Wahrheiten zugrunde liegt und an den Leibniz im weiteren Verlauf der Monadologie seine Gottes-Philosophie anknüpft (§36). Leibniz nennt diesen Grund meist den zureichenden Grund (raison suffisante) und seltener auch den letzten Grund (derniére raison) (§§37,38). So ist die Brücke, die Leibniz zwischen den Wahrheiten und Gott schlägt, also der zureichende Grund, recht kurz; in nur vier Paragrafen von insgesamt 90 schreibt er über den zureichenden Grund.4
Leibniz lehnt die aristotelische Vorstellung von der Ursache aller Bewegungen im Kosmos als Urgrund ab, indem er behauptet:
„[…] da jede Einzelheit nur andere, frühere oder vereinzelte Kontingente einhüllt, die wiederum eine ähnliche Analyse erfordern, um dem Grund dafür zu geben, so ist man dadurch nicht weitergekommen: Der zureichende Grund oder letzte Grund muß also außerhalb der Folge oder Reihe dieser einzelnen Kontingenten sein, wie unendlich sie auch sein mögen.“ (§37)
Der Grund bei Leibniz definiert sich hier ex negativo über Folge der Bewegungen und Kausalitäten im Universum, stattdessen muss es für Leibniz etwas geben, eine Substanz, in dem alle anderen Substanzen vorhanden sind, ihre Veränderungen durchmachen und die Substanzen untereinander verbindet. An dieser Stelle setzt bei Leibniz die Erkenntnis des Urgrundes Gottes ein:
„[…] so muß der letzte Grund der Dinge in einer notwendigen Substanz liegen, worin einzelne Veränderungen allein eminent sind, wie in ihrer Quelle, und dies nennen wir Gott.
39. Nun ist diese Substanz ein zureichender Grund aller Einzelheit, welches zudem überall verbunden ist; es gibt nur einen Gott, und dieser Gott reicht zu.“ (§§38,39)
Leibniz setzt Gott somit in die Rolle des letzten Grundes, der eine notwendige Rolle im Weltgeschehen spiele, da alles in ihm ist, und da alles in diesem einen ist, so kann es nur diesen einen geben. Gott selbst ist damit aber ohne Grund, beziehungsweise trägt er den Grund für sich in sich selbst (§45). Zu dieser Gotteserkenntnis-Thematik über den Weg des Grundes der Substanzen äußert sich Leibniz wie folgt:
„[…] Wir haben sie [die Realität Gottes] eben aber auch a posteriori bewiesen, denn kontingente Seiende existieren, welche ihren letzten Grund nur im notwendigen Sein haben können, welches den Grund seiner Existenz in sich selbst hat.“ (§45)
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Leibniz zwei Überleitungen zur Erkenntnis Gottes sieht; den apriorischen Weg über den Grund der ewigen Wahrheiten und den aposteriorischen Weg über den Grund der existierenden Monaden. In beiden Fällen nimmt bei Leibniz Gott die Rolle des Urgrundes ein.
2.2. Die Urmonade Gott und die prästabilisierte Harmonie
In diesem Abschnitt wird es darum gehen, den Begriff Gottes als ursprüngliche Monade bei Leibniz herauszustellen und dann den Blick darauf zu richten, in welcher Weise diese Urmonade auf die Ordnung der Welt und deren Gegenstände einwirkt; dies wird zum Begriff der sogenannten prästabilierten Harmonie führen.
Im letzten Kapitel wurde festgestellt, dass in Leibniz Gedankensystem Gott das Wesen des Urgrundes ist, in dem alles Vorhandene existiert. Dies kann mit noch einer weiteren Aussage von Leibniz dementiert werden:
„44. Es muß nämlich, wenn es eine Realität in den Wesen oder Möglichkeiten oder eben in den ewigen Wahrheiten gibt, diese Realität auf etwas Existierendem und Wirklichem gründen; und folglich in der Existenz des notwendigen Seins, worin das Wesen die Existenz einschließt, oder worin es genügt, möglich zu sein, um wirklich zu sein.
45. So kommt allein Gott oder dem notwendigen Sein das Privileg zu, daß es existieren muß, wenn es möglich ist.“ (§§44,45)
Leibniz stellt hier einen besonderen Gottesbegriff vor, denn Gott verkörpert hier zugleich das notwendige Sein, in dem alles Vorhandene nicht nur existiert, sondern sich auch verändert und in dem alle theoretischen Möglichkeiten der vorhandenen Substanzen und Monaden vorhanden sein müssen, bevor sie in das Sein treten bzw. haben diese in Gott selbst schon ein Sein. Nur unterscheidet dies eben Gott von den restlich Vorhandenen, denn diese haben verschiedene Möglichkeiten, ihr Sein zu äußern, während die ungeäußerten Möglichkeiten ihr Sein in Gott haben, derweil Gott aber in seiner Möglichkeit schon im Sein sein muss.
Weiters kommt bei Leibniz Gott die Rolle eines Vermittlers zwischen den Monaden selbst zu, da sie nicht direkt gegenseitig aufeinander einwirken könnten und nur in bzw. durch ihren Grund, also Gott, dies bewirken könnten (§51).
Des Weiteren bringt Leibniz die Thematik der Unendlichkeit der möglichen Universen ein und die damit verbundene Frage, warum gerade dieses eine Universum existiert. Der Grund für diese Wahl liegt wiederum in Gott, der nach dem Besten entscheidet (§§53-55).
Mit diesen Aufgaben Gottes wird ersichtlich, dass Gott als Urgrund bei Leibniz nicht nur einen anfänglichen Grund des Daseins darstellt, sondern auch eine dauerhafte pantokratische Rolle innehat, in der er das Dasein und die Dinge untereinander regelt.
In dem Gottesbegriff von Leibniz enthüllt sich ein starker Dualismus, während das Modell der Monaden und Entelechien sehr monistisch gedacht ist. Gott ist das einzige existierende Wesen, dem Leibniz eine reine Geistigkeit zuschreibt, während die restlichen existierenden Wesenheiten im Universum auch eine gewisse Körperlichkeit besäßen. Dies wird an folgender Stelle deutlich:
„[…] Es gibt auch keine […] Geister ohne Körper: Gott allein ist vom Körper gänzlich entkoppelt.“ (§72)
Somit wird implizit deutlich, dass Leibniz allein im Urgrund bzw. in Gott eine reine Geistigkeit sieht, während der Rest der vorhandenen Dinge zusätzlich körperhaft sei.
Die Frage, der sich Leibniz weiterhin widmet, ist die, auf welche Weise die Seelen mit den Körpern harmonisch in Kontakt treten und miteinander arbeiten können, um letztendlich zum Begriff der prästabilisierten Harmonie hinzuführen. Dafür verwendet Leibniz ein analogiehaftes Beispiel aus der Natur:
„[…] Heute allerdings hat man aus genauen Erforschungen der Pflanzen, der Insekten und der Lebewesen gelernt, daß die organischen Körper der Natur niemals aus einem Chaos oder einer Fäulnis hervorgebracht werden, sondern immer durch die Samen, in denen es zweifellos Präformationen gibt. So hat man geurteilt, daß nicht allein die organischen Körper bereits vor der Empfängnis in den Samen waren, sondern auch eine Seele in diesem Körper, kurz gesagt, das Lebewesen selbst, und daß durch das Mittel der Empfängnis dieses Lebewesen lediglich zu einer großen Transformation disponiert wurde, um Lebewesen einer anderen Art zu werden.“ (§74)
Was Leibniz dadurch sagt, ist, dass die Seelen schon vor ihrer Geburt in einem zum Teil vorgeformt und vorbestimmten Körper wohnen und diesen somit präformieren. Impliziert wird dadurch aber auch, dass es durch die Geburt keine absolute Neuentstehung eines Lebewesens geben könne, sondern nur eine andere Seinsform des schon vorhandenen Wesens entsteht (§76). Gleichzeitig sagt Leibniz damit auch, dass die Seele nach dem Tod nicht stirbt und das ganze Wesen des Lebewesens eigentlich unzerstörbar ist, dass nur die äußere Hülle sich verändert und/oder auflöst (§77). Dennoch sieht Leibniz in der materiellen Hülle eine göttliche Maschine, da die Monaden und Entelechien in ihre Hülle so hineinwirken würden, dass jedes kleinste Teil der der Materie zur Hülle bzw. Maschine bereitet wird und zu ihrem Wesen gehören (§64). Mit diesen hinführenden Gedanken bringt Leibniz den Begriff der prästabilisierten Harmonie ein:
„[…] Die Seele folgt ihren eigenen Gesetzen, wie der Körper den seinen; und sie treffen aufeinander kraft der prästabilisierten Harmonie zwischen allen Substanzen, weil sie alle Vorstellung eines und desselben Universums sind.
79. Die Seelen handeln gemäß den Gesetzen der Zweckursachen durch Appetition, Zwecke und Mittel. Die Körper handeln gemäß den Gesetzen der Wirkursachen oder der Bewegungen. Die beiden Reiche, dasjenige der Wirkursachen und dasjenige der Zweckursachen, sind miteinander harmonisch.“ (§§78,79)
Die prästabilisierte Harmonie sorgt somit für ein gelungenes Zusammenspiel der beiden von Leibniz charakterisierten Reiche. Bisweilen lässt Leibniz allerdings aus, auf welche Weise die prästabilisierte Harmonie zustande kommt. Leibniz setzt sie als gegeben und keiner weiteren Erklärung bedürftig.
Somit wäre Gott in Leibniz metaphysischem System die Urmonade oder der Urgrund, der rein geistig auf die Welt einwirkt, da die gesamte Welt in ihm selbst vorhanden ist, während die prästabilisierte Harmonie für ein harmonisches Zusammenspiel zwischen Geistigem bzw. Seelischem und Physischem sorgt. Leibniz versucht hiermit, nicht nur eine Metaphysik zu entwerfen, sondern will ernsthaft reale Wirkungen Gottes im Erfahr- bzw. Erkennbaren festmachen.
Fazit
Leibniz beginnt seine Monadologie mit einem ausgeklügelten und differenzierten System der verschiedenen Seinsebenen der vorhandenen Dinge, den Monaden. Dieses System scheint nachvollziehbar und in sich schlüssig, wenn man die prästabilisierte Harmonie zusätzlich heranzieht, um das Funktionieren und Ineinandergreifen des seelischen Aspekts und des physischen miteinander zu erklären. Neben dieser zweckorientierten Rolle der prästabilisierten Harmonie erläutert Leibniz jedoch keine weiteren Attribute derselben, es gibt keinerlei Angaben dazu, wie diese entstanden sei, noch wie sie im konkreten Fall arbeite. Auch gibt es keinen Hinweis darauf, um was für eine Art von Wesenheit es sich bei der prästabilisierten Harmonie handelt; der Leser muss sich selbst die gedankliche Brücke bauen, dass diese wohl ein von Gott geschaffenes Instrument zur Aufrechterhaltung der vollkommenen göttlichen Ordnung darstellt.
Ab der zweiten Hälfte des Werks versucht Leibniz, eine logische und rationale Hinleitung zum letzten Grund zu kreieren, was bisweilen durchaus nachvollziehbar und teilweise genial scheint, im Kontext des gesamten Werks jedoch sehr kurz ausfällt und ausführlicheren Darstellungen bedurft hätte. Daran schließt sich Leibniz Gottesphilosophie an, die er dadurch bewiesen sieht, dass er Gott mit dem letzten Grund gleichsetzt. Diese Gleichsetzung scheint jedoch nur teilweise hinreichend und ist eher einer Analogie gleich, denn in der von Leibniz vorgestellten Metaphysik spielt Gott eine sehr viel weitreichendere Rolle als der letzte Grund. Sobald Leibniz die Ebene Gottes als gleichgesetztes Element mit dem letzten Grund verlässt, beginnt eine nicht mehr erfahrbare und nur noch theoretisch nachvollziehbare Darstellung Gottes als Ontotheologie. Immer wieder bringt Leibniz neue Aspekte ein und scheint dabei immer mehr auf Nachvollziehbarkeit zu verzichten. Besonders der von ihm kaum erklärte, von Menschen zu errichtende Gottesstaat entbehrt fast völlig jeder rationalen Grundlage. Leibniz stellt sich hiermit im vollsten Sinne in die scholastische Tradition des Realismus, da er die behandelten Gegenstände als fest und gegeben hinstellt und obwohl es im ersten Teil der Monadologie durchaus Ansätze eines individuellen Erkenntnisweges gibt, fehlen diese seiner Metaphysik völlig. Auch wenn man Leibniz zugestehen muss, dass sein Werk mit aufklärerischer Logik und Vernunft durchzogen ist, so scheint seine Arbeitsweise vollkommen deduktiv zu sein und von der These auszugehen „Gott existiert als Absolutes und ist als solcher allen Zweifeln erhaben“. Dieses Bild festigt sich auch an seinen Differenzen mit René Descartes und den Cartesianern, die er durch das Werk durchgehend anführt. Zwar stimmt Leibniz Descartes in der Erkenntnis des eigenen Subjekts zu, bezichtigt ihn jedoch, alles darüber Hinausgehende unzureichend erkannt zu haben.
Leibnizens metaphysisches System zeigt sich an vielen Stellen eher als ein mystisches oder gar okkultes Gedankengebäude und verweigert in gewisser Hinsicht eine moderne Herangehensweise an die Metaphysik und einen individuellen Erkenntnisweg zu einem Gottesbeweis.
Man muss Leibniz jedoch dafürhalten, dass das Werk der Monadologie nie von ihm selbst veröffentlicht worden und erst posthum aus seinem Nachlass erschienen ist (nur Nicolas François Rémond hatte 1714 Einsicht in das Werk, bevor Leibniz starb).5 Somit ist nicht abzusehen, wie das Werk ausgesehen hätte, wenn Leibniz sein System selbst zur Veröffentlichung gebracht hätte und ob er noch Veränderungen oder Erweiterungen vorgenommen hätte.
Die Monadologie von Leibniz ist ein durchgängig scharfsinnig geschriebenes Werk, das vor Genialität strotzt, wenngleich diese nicht völlig zureichend auf die Problematik einer modernen und logisch-rationalen Gotteserkenntnis gerichtet ist.
Quellen
- Ulrich Johannes Schneider [Hrsg.]: Gottfried Wilhelm Leibniz. Monadologie und andere metaphysische Schriften. Französisch-Deutsch, Felix Meiner Verlag, Hamburg, 2., verbesserte Auflage 2014
- Hubertus Busche [Hrsg.]: Einführung: Gottfried Wilhelm Leibniz. Monadologie, Akademie-Verlag, Berlin 2009
- Rudolf Eisler: Wörterbuch der Philosophischen Begriffe, Mittler Verlag, Berlin 1904
[...]
1 Ulrich Johannes Schneider [Hrsg.]: Gottfried Wilhelm Leibniz. Monadologie und andere metaphysische Schriften. Französisch-Deutsch, Felix Meiner Verlag, Hamburg, 2., verbesserte Auflage 2014, S. XVIII
2 In diesem Paragrafen knüpft Leibniz auch an den Universalienstreit der Hochscholastik an und sieht im Cartesianismus eine Fortführung des Nominalismus. Indem Leibniz den Blick auf diejenigen Perzeptionen lenkt, von denen man gewöhnlich kein Bewusstsein hat, die aber dennoch objektiv vorhanden sind, stellt sich Leibniz in die Tradition des Realismus. Dazu schreibt Leibniz: „Eben das haben die Cartesianer stark verfehlt, indem sie diejenigen Perzeptionen, von denen man kein Bewußtsein hat, als nichts ansahen.“ (§14)
3 Leibniz führt als erster in der Philosophiegeschichte eine klare und eindeutige Lehre der Apperzeption ein, um klar zwischen einer halbwegs unbewussten Wahrnehmung, der Perzeption, und der klaren Wahrnehmung des Inhaltes eines Gegenstandes, der Apperzeption, zu differenzieren. (Vgl. Eintrag „Apperception“ im Wörterbuch der Philosophischen Begriffe von Rudolf Eisler, Mittler Verlag, Berlin 1904, S.58)
4 Vgl. Begriffsregister von Ulrich Johannes Schneider [Hrsg.] in: Gottfried Wilhelm Leibniz. Monadologie und andere metaphysische Schriften. Französisch-Deutsch, Felix Meiner Verlag, Hamburg, 2., verbesserte Auflage 2014, S.192, Eintrag: Grund, zureichender (raison suffisante)
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema der Monadologie von Leibniz?
Die Monadologie von Gottfried Wilhelm Leibniz behandelt die Theorie der Monaden, die einfachen Substanzen, aus denen die Welt besteht, und untersucht deren Beziehung zu Gott als dem letzten Grund und der Quelle der prästabilisierten Harmonie.
Was sind Monaden nach Leibniz?
Monaden sind einfache, unteilbare Substanzen, die die Grundbausteine der Realität bilden. Sie haben keine Teile, sind aber durch Perzeptionen und Appetitionen charakterisiert, die ihre innere Aktivität und Veränderung darstellen.
Was ist der Unterschied zwischen Perzeption und Apperzeption?
Perzeption ist die Wahrnehmung einer Monade, während Apperzeption das bewusste Wahrnehmen oder das Bewusstsein einer Perzeption ist. Nicht alle Monaden haben Apperzeption; nur Seelen, insbesondere menschliche Seelen, besitzen diese Fähigkeit.
Was bedeutet der Satz vom zureichenden Grund in Leibniz‘ Philosophie?
Der Satz vom zureichenden Grund besagt, dass für jede Tatsache oder Wahrheit ein Grund oder eine Erklärung vorhanden sein muss, warum sie so ist und nicht anders. Leibniz verwendet diesen Satz, um die Notwendigkeit einer letzten Erklärung für alle existierenden Dinge zu argumentieren, was er mit Gott identifiziert.
Wer oder was ist die "Urmonade Gott" bei Leibniz?
Die Urmonade Gott ist der letzte und notwendige Grund aller Dinge. Gott ist die Quelle aller Möglichkeiten und existiert notwendig, wenn er möglich ist. Er ist auch der Vermittler zwischen den Monaden und sorgt für die prästabilisierte Harmonie.
Was ist die prästabilisierte Harmonie?
Die prästabilisierte Harmonie ist Leibniz‘ Erklärung dafür, wie Körper und Seele (oder verschiedene Monaden) miteinander interagieren, ohne tatsächlich kausal aufeinander einzuwirken. Gott hat von Anfang an die Welt so geschaffen, dass die Handlungen der Seelen und die Bewegungen der Körper perfekt aufeinander abgestimmt sind.
Wie unterscheidet Leibniz zwischen einfachen Substanzen, tierischen Seelen und menschlichen Seelen?
Einfache Substanzen haben unklare Perzeptionen, tierische Seelen klarere Perzeptionen und Gedächtnis, und menschliche Seelen klare Perzeptionen (Apperzeption), Gedächtnis und Vernunft.
Was ist der "Gottesstaat" bei Leibniz?
Der Gottesstaat, oder das Reich der Geister, ist die Gemeinschaft aller Geister (vernünftiger Seelen oder Menschen), die Gott erkennen und lieben. Dieser Staat ist idealerweise durch Harmonie und moralische Vollkommenheit gekennzeichnet.
Welche Quellen werden in der Analyse der Monadologie von Leibniz verwendet?
Die Analyse basiert hauptsächlich auf der deutschen Übersetzung der Monadologie von Ulrich Johannes Schneider, sowie Einführungen von Hubertus Busche und dem Wörterbuch der Philosophischen Begriffe von Rudolf Eisler.
Welche Kritik wird an Leibniz' Monadologie geübt?
Kritisiert wird unter anderem die mangelnde Erklärung der prästabilisierten Harmonie, die Kürze der Darstellung des zureichenden Grundes im Verhältnis zur Gottesphilosophie, und die fehlende rationale Grundlage für den von Menschen zu errichtenden Gottesstaat. Auch wird angemerkt, dass Leibniz‘ Ansatz eher deduktiv ist und von einer vorgefassten These von der Existenz Gottes ausgeht.
- Citar trabajo
- Nicolas Blaue (Autor), 2020, Der Satz vom Grund in "Monadologie" von Leibniz. Eine Interpretation, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1002949