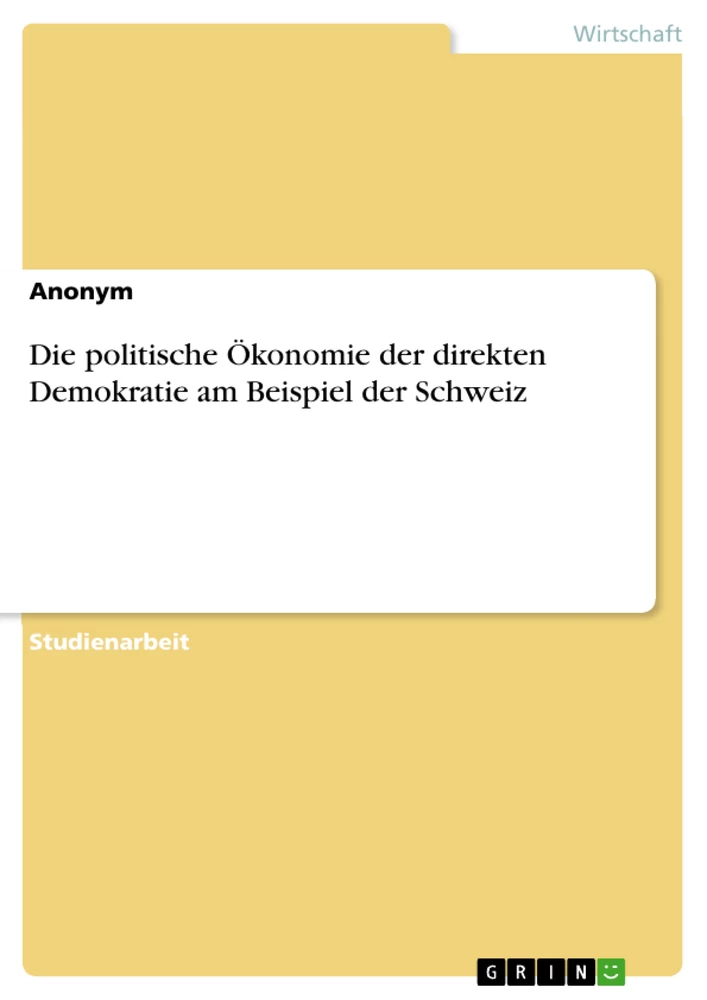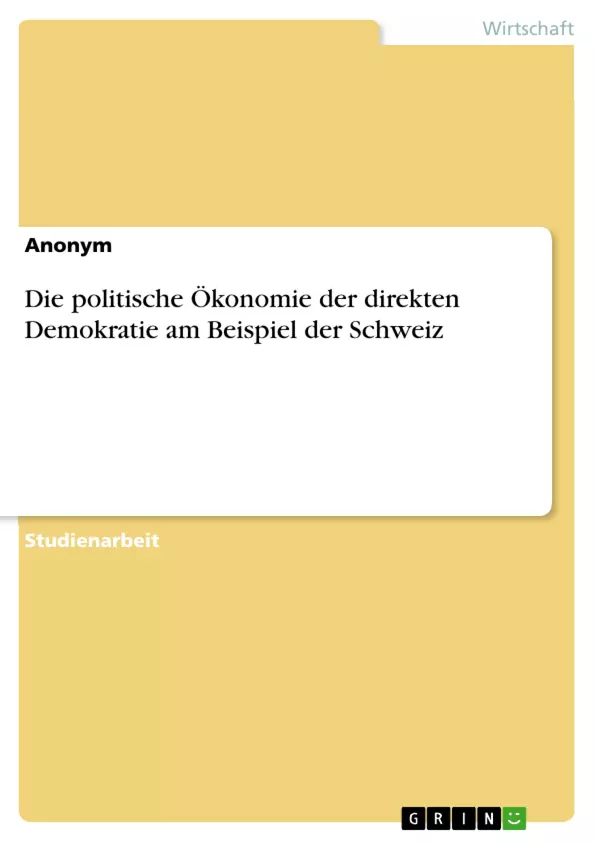Wie kann das Schweizer Modell der direkten Demokratie politökonomisch erklärt werden? Diese Frage soll mit Hilfe der "Ökonomischen Theorie der Demokratie" von Anthony Downs beantwortet werden. Dabei wird vorausgesetzt, dass der Leser weiß, wie die Wahlen in indirekten Demokratien funktionieren. Des Weiteren soll keine Kritik an der repräsentativen oder der direkten Demokratie geübt werden. Einzig und allein die politökonomische Betrachtungsweise von Downs spielt hier eine Rolle. Zur Vereinfachung werden auch keine mathematischen Formeln herangezogen und aufgrund des Umfangs dieser Arbeit kann kein empirisches Forschungsdesign angelegt werden.
Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass sich die politische Repräsentation in den Staaten Europas und anderer westlicher Länder in einer Krise befindet. Über Jahrzehnte gewachsene Bindungen zwischen Wählern und Parteien scheinen zunehmend aufzuweichen. Immer mehr Menschen ändern ihr gewohntes Wahlverhalten und laut Meinungsumfragen wächst die Zahl derer, welche es ablehnen sich überhaupt mit einer Partei zu identifizieren. In den betroffenen Staaten gibt es daher immer mehr Stimmen, die eine stärkere Beteiligung des Volkes an den politischen Willensbildungen fordern, um diesem Phänomen eine wirksame Antwort entgegenzusetzen. Sehen sie die Ursache hierfür, doch in einer zunehmenden Entfernung zwischen der Regierungselite und dem Wahlvolk. Ein vielbeachtetes Beispiel, besonders in Deutschland, ist das direktdemokratische Modell der Schweiz. Es hat seinen festen Platz zwischen all den anderen Demokratieformen in Europa und kann auf eine lange Tradition zurückblicken.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Anthony Downs \"An Economic Theory of Democracy\"
- Der rationale Wähler
- Die rational handelnden Parteien
- Das politische System der direkten Demokratie in der Schweiz
- Die Demokratietheorie Downs und die Direktdemokratie der Schweiz
- Das Problem der Informationskosten
- Das Prinzipal-Agent Problem
- Kritik an Downs Theoriemodell
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der politischen Ökonomie der direkten Demokratie am Beispiel der Schweiz. Die Arbeit untersucht, wie das Schweizer Modell der direkten Demokratie mit Hilfe der "Ökonomischen Theorie der Demokratie" von Anthony Downs erklärt werden kann. Im Fokus stehen dabei die Entscheidungsfindungen des rationalen Wählers und die Rolle von Informationskosten im Kontext der direkten Demokratie. Die Arbeit befasst sich nicht mit Kritik an der repräsentativen oder der direkten Demokratie, sondern konzentriert sich auf die politökonomische Betrachtungsweise von Downs.
- Die "Ökonomische Theorie der Demokratie" von Anthony Downs
- Das Modell des rationalen Wählers
- Die Rolle von Informationskosten in der direkten Demokratie
- Das politische System der direkten Demokratie in der Schweiz
- Die Anwendung der Theorie von Downs auf die Schweiz
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 stellt die "Ökonomische Theorie der Demokratie" von Anthony Downs vor und erklärt die Grundannahmen des Modells des rationalen Wählers. Kapitel 3 beschreibt das direktdemokratische System der Schweiz. In Kapitel 4 werden die Theorie von Downs und das Schweizer Modell der direkten Demokratie miteinander in Verbindung gebracht, wobei insbesondere die Probleme der Informationskosten und des Prinzipal-Agent Problems untersucht werden. Kapitel 5 setzt sich kritisch mit Downs Theoriemodell auseinander. Das Fazit fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Direkte Demokratie, Schweiz, Politische Ökonomie, Anthony Downs, Rationale Wahl, Informationskosten, Prinzipal-Agent Problem, Neue Politische Ökonomie, Homo Oeconomicus.
Häufig gestellte Fragen
Wie erklärt Anthony Downs die direkte Demokratie?
Downs nutzt die 'Ökonomische Theorie der Demokratie', in der Wähler und Parteien als rationale Akteure (Homo Oeconomicus) handeln, die ihren eigenen Nutzen maximieren wollen.
Was ist ein 'rationaler Wähler'?
Ein Wähler, der seine Stimme basierend auf einem Vergleich des erwarteten Nutzens der verschiedenen politischen Alternativen abgibt, wobei er den Aufwand für Informationen einbezieht.
Welche Rolle spielen Informationskosten in der Schweiz?
In einer direkten Demokratie sind die Informationskosten für den Bürger höher, da er sich zu Sachfragen detailliert informieren muss, statt nur eine Partei für mehrere Jahre zu wählen.
Was ist das Prinzipal-Agent-Problem in der Politik?
Es beschreibt das Spannungsfeld zwischen dem Volk (Prinzipal) und den gewählten Vertretern (Agenten), bei dem die Agenten eventuell eigene Interessen verfolgen, die von denen des Volks abweichen.
Hilft direkte Demokratie gegen die Politikverdrossenheit?
Die Arbeit diskutiert, ob eine stärkere Beteiligung, wie in der Schweiz, die Distanz zwischen Regierungselite und Wahlvolk verringern und so die Krise der Repräsentation lösen kann.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Die politische Ökonomie der direkten Demokratie am Beispiel der Schweiz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1003678