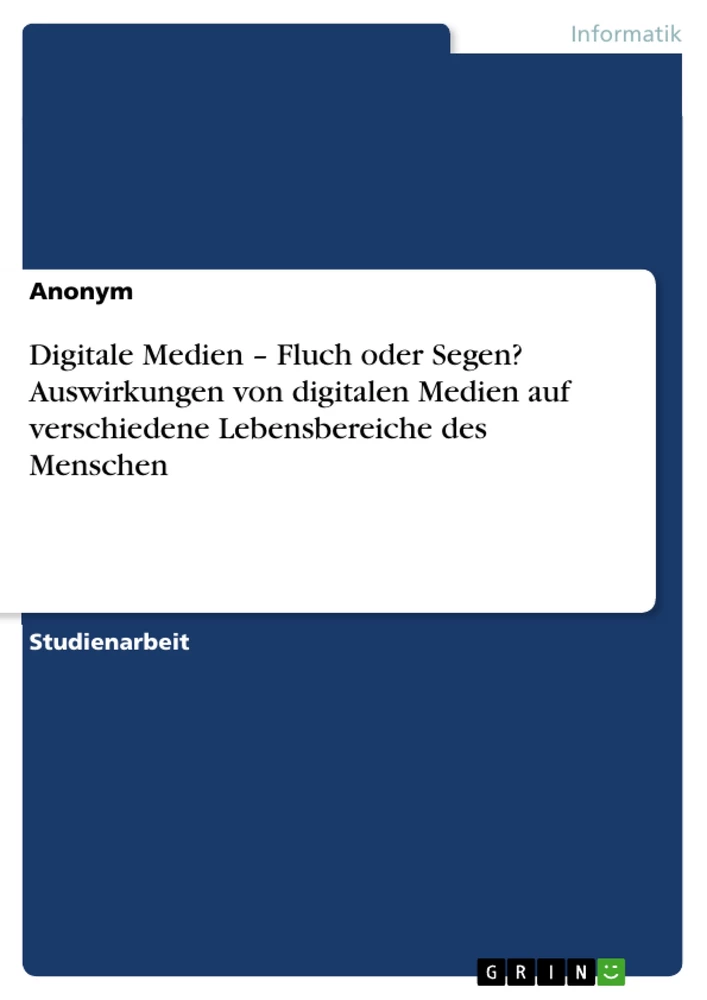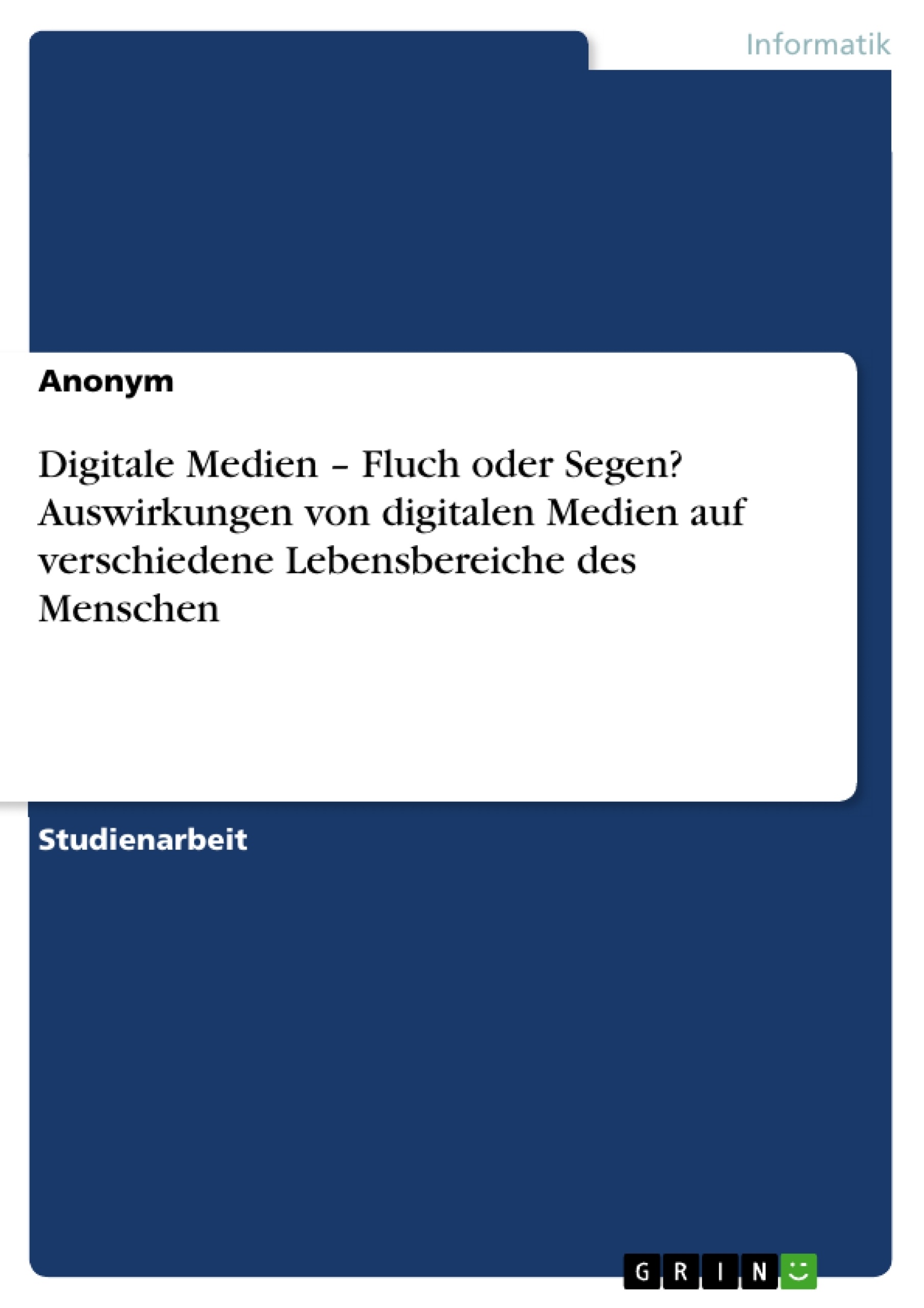Diese Seminararbeit behandelt die folgenden Forschungsfragen: Welche Lebensbereiche eines Menschen werden wie durch digitale Medien beeinflusst? Sind digitale Medien ein Fluch oder Segen?
Für das Erzielen des erstrebten Forschungsergebnisses werden zunächst die theoretischen Grundlagen über digitale Medien und dem Lifebalance Modell nach Dr. Peseschkian erläutert. Die theoretischen Grundlagen umfassen eine Abgrenzung der Begriffe „digitale Medien“ und „Lifebalance“, wobei auch der Aufbau des Lifebalance Modells behandelt wird. Nach einer einführenden Vorstellung der Vorgehensweise bei der Datenerhebung wird im Rahmen einer empirischen Studie eine Analyse zur Bedeutung digitaler Medien in der heutigen Lebenswelt hinsichtlich der Nutzungsgewohnheiten durchgeführt. Auf Basis der aus der empirischen Studie ermittelten Informationen werden die Auswirkungen auf die Lebensbereiche des Menschen anhand des Lifebalance Modells nach Dr. Peseschkian dargelegt. Mittels der konstatierten Ergebnisse werden die Forschungsfragen beantwortet. Das Fazit wird den Abschluss dieser Ausarbeitung darstellen und das Gesamtergebnis aufzeigen.
Die tägliche Nutzung von Smartphones, die zunehmende Begeisterung von Menschen für Online-Dienste und die damit verbundene Konfrontation mit diversen Informationen innerhalb sozialer Netzwerke stehen exemplarisch für einige Gegebenheiten, die in der heutigen Gesellschaft zu beobachten sind. Die dadurch implizierte Weiterentwicklung der Informationsgesellschaft hat die Notwendigkeit einer kritischen Betrachtung von digitalen Medien stark an Bedeutung gewinnen lassen, sodass in der heutigen Zeit eine vorhandene Medienkompetenz zur Hinterfragung der Potenziale und Anwendungsmöglichkeiten digitaler Medien erforderlich ist. Der Mensch ist als Teil dieser Gesellschaft permanent auf den Empfang dieser unzähligen Informationen ausgerichtet und kann mit der Verarbeitung gegebenenfalls überfordert sein.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- Digitale Medien
- Definition und Begriffsabgrenzung von „Medien“
- Digitale Medien und Onlinemedien
- Lifebalance Modell nach Nossrat Peseschkian
- Modellannahmen und Abgrenzung des Begriffs „Balance“
- Die vier Säulen des Lifebalance Modells
- 3. Empirische Studie zur Bedeutung digitaler Medien in der heutigen Lebenswelt
- Vorgehensweise bei der Datenerhebung
- Vergleichskriterien „Kategoriezugehörigkeit“ und „Zu- oder Abnahmetrend“
- Digitales Mediennutzungsverhalten
- Medienausstattung in deutschen Haushalten
- Nutzungsgewohnheiten in deutschen Haushalten
- Zwischenfazit zum Vergleich der Studienergebnisse
- 4. Medien – Fluch oder Segen?
- Auswirkungen von digitalen Medien auf das Lifebalance Modell
- Beruf und Finanzen
- Familie und Bekannte
- Gesundheit und Fitness
- Sinn und Kultur
- Medienkompetenz als Ausweg aus dem Dilemma
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Auswirkungen digitaler Medien auf verschiedene Lebensbereiche des Menschen. Sie analysiert, wie digitale Medien das Leben beeinflussen und ob sie eher als Fluch oder Segen einzuschätzen sind. Die Arbeit stützt sich auf theoretische Grundlagen der Medienwissenschaft und Psychologie, insbesondere das Lifebalance-Modell von Nossrat Peseschkian. Eine empirische Studie analysiert Mediennutzung und -ausstattung in deutschen Haushalten.
- Definition und Einordnung digitaler Medien im Kontext anderer Medienformen
- Analyse der Auswirkungen digitaler Medien auf das Lifebalance-Modell
- Empirische Untersuchung des Mediennutzungsverhaltens in der deutschen Bevölkerung
- Bewertung des Nutzens und der Risiken digitaler Medien
- Die Bedeutung von Medienkompetenz für einen verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Relevanz der Auseinandersetzung mit den Auswirkungen digitaler Medien im Kontext der Interdisziplinären Aspekte der Wirtschaftsinformatik. Sie formuliert die Forschungsfragen der Arbeit: Wie beeinflussen digitale Medien die Lebensbereiche des Menschen, und sind sie Fluch oder Segen? Die Methodik der Arbeit, die Anwendung des Lifebalance-Modells und die Verwendung empirischer Daten, wird skizziert.
2. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Medium“ und grenzt digitale Medien von anderen Medienformen ab. Es wird der Unterschied zwischen Primär-, Sekundär- und Tertiärmedien erklärt. Der Fokus liegt anschließend auf dem Lifebalance-Modell von Nossrat Peseschkian, seinen Modellannahmen und den vier Säulen (Beruf & Finanzen, Familie & Bekannte, Gesundheit & Fitness, Sinn & Kultur), die eine ganzheitliche Betrachtung des menschlichen Lebens ermöglichen. Die dynamische, qualitative Ausgewogenheit der Lebensbereiche im Modell wird hervorgehoben.
3. Empirische Studie zur Bedeutung digitaler Medien in der heutigen Lebenswelt: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung, die auf Daten der JIM-Studie und der Media Activity Guide-Studie basiert. Es werden die Vergleichskriterien „Kategoriezugehörigkeit“ (wenig, durchschnittlich, viel vorhanden) und „Zu- oder Abnahmetrend“ in der Medienausstattung und -nutzung erläutert, wobei die Berechnung von Quantilen und dem Interquartilsabstand beschrieben wird. Die Ergebnisse der Studien zum Medienbesitz (Smartphone, Computer, Fernseher etc.) und deren Nutzungsintensität werden verglichen und interpretiert.
4. Medien – Fluch oder Segen?: Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen digitaler Medien auf die vier Säulen des Lifebalance-Modells. Es werden sowohl positive als auch negative Einflüsse auf die Bereiche Beruf & Finanzen (z.B. Online-Bewerbungen vs. Risiken durch Social Media), Familie & Bekannte (z.B. digitale Kommunikation vs. soziale Isolation), Gesundheit & Fitness (z.B. Bewegungsmangel vs. Gesundheitsinformationen) und Sinn & Kultur (z.B. Identitätsfindung vs. Störung der Familienbeziehungen) diskutiert. Beispiele aus verschiedenen Studien werden herangezogen.
Schlüsselwörter
Digitale Medien, Onlinemedien, Medienkompetenz, Lifebalance-Modell, Nossrat Peseschkian, Mediennutzung, Medienausstattung, Empirische Studie, JIM-Studie, Media Activity Guide-Studie, Beruf, Finanzen, Familie, Gesundheit, Fitness, Sinn, Kultur, Soziale Medien, Informationsgesellschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Auswirkungen digitaler Medien auf das Leben
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Auswirkungen digitaler Medien auf verschiedene Lebensbereiche des Menschen und analysiert, ob diese eher als Fluch oder Segen einzuschätzen sind. Sie betrachtet dies aus den Perspektiven der Medienwissenschaft und Psychologie, unter Einbezug des Lifebalance-Modells von Nossrat Peseschkian und einer empirischen Studie zur Mediennutzung in deutschen Haushalten.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Definition und Einordnung digitaler Medien im Kontext anderer Medienformen. Schwerpunkt ist das Lifebalance-Modell von Nossrat Peseschkian mit seinen vier Säulen (Beruf & Finanzen, Familie & Bekannte, Gesundheit & Fitness, Sinn & Kultur). Dieses Modell dient als analytisches Rahmenwerk zur Bewertung der Auswirkungen digitaler Medien auf das ganzheitliche Wohlbefinden.
Welche empirische Studie wurde durchgeführt?
Die Arbeit basiert auf einer empirischen Untersuchung, die Daten der JIM-Studie und der Media Activity Guide-Studie nutzt. Die Studie analysiert die Medienausstattung und -nutzung in deutschen Haushalten anhand der Vergleichskriterien „Kategoriezugehörigkeit“ (wenig, durchschnittlich, viel vorhanden) und „Zu- oder Abnahmetrend“. Die Ergebnisse zum Medienbesitz (Smartphone, Computer, Fernseher etc.) und deren Nutzungsintensität werden verglichen und interpretiert.
Wie werden die Auswirkungen digitaler Medien auf das Leben bewertet?
Die Arbeit analysiert die Auswirkungen digitaler Medien auf die vier Säulen des Lifebalance-Modells. Es werden sowohl positive als auch negative Einflüsse auf die Bereiche Beruf & Finanzen, Familie & Bekannte, Gesundheit & Fitness und Sinn & Kultur diskutiert. Die Analyse berücksichtigt die Balance zwischen den einzelnen Lebensbereichen und beleuchtet den Einfluss von Medienkompetenz auf einen verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien.
Welche Forschungsfragen werden in der Arbeit behandelt?
Die zentralen Forschungsfragen lauten: Wie beeinflussen digitale Medien die Lebensbereiche des Menschen, und sind sie Fluch oder Segen? Die Arbeit untersucht den Einfluss digitaler Medien auf die einzelnen Lebensbereiche und die Notwendigkeit von Medienkompetenz für einen ausgewogenen Umgang mit digitalen Technologien.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: 1. Einleitung, 2. Theoretische Grundlagen, 3. Empirische Studie zur Bedeutung digitaler Medien in der heutigen Lebenswelt und 4. Medien – Fluch oder Segen? Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Thematik, beginnend mit einer Einleitung und einer Erläuterung der theoretischen Grundlagen, gefolgt von der Darstellung der empirischen Studie und einer abschließenden Diskussion der Ergebnisse.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Digitale Medien, Onlinemedien, Medienkompetenz, Lifebalance-Modell, Nossrat Peseschkian, Mediennutzung, Medienausstattung, Empirische Studie, JIM-Studie, Media Activity Guide-Studie, Beruf, Finanzen, Familie, Gesundheit, Fitness, Sinn, Kultur, Soziale Medien, Informationsgesellschaft.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Digitale Medien – Fluch oder Segen? Auswirkungen von digitalen Medien auf verschiedene Lebensbereiche des Menschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1004686