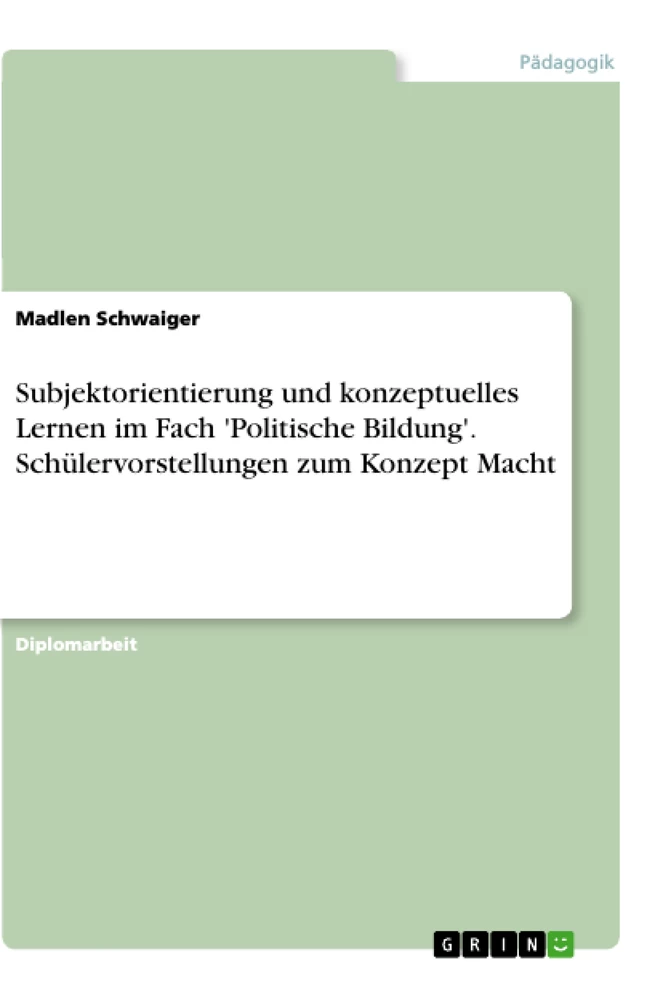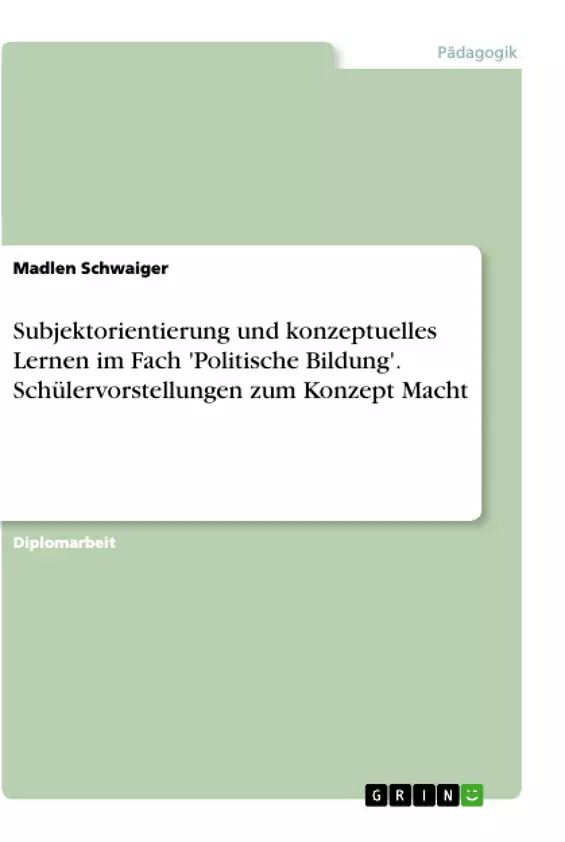Ziel der Arbeit ist es, im Rahmen einer explorativen empirischen Untersuchung in Form von Gruppendiskussionen zum Basiskonzept Macht, Erkenntnisse über Schülervorstellungen im Bereich des Politischen zu gewinnen. Die Basiskonzepte sind dabei: Macht, Gemeinwohl, Knappheit, System, Recht und Öffentlichkeit, als erste Grundlage, auf der sich politisches Verständnis konstituiert.
Die vorliegende explorative Studie gibt also einen Einblick in einen noch relativ unbekannten Forschungsgegenstand und soll Anreize und Ideen für weitere Forschungsfragen bieten. So soll im ersten Schritt die Untersuchung und die darauf aufbauende praktische Umsetzung theoretisch fundiert werden. Innerhalb des gesteckten Rahmens politischer Bildung im Kontext Schule widmen sich die Fragestellungen den Vorstellungen von Lernenden als Teil der Subjektorientierung, eingebettet ins fachdidaktische Modell des Pädagogen Wolfgang Sanders. Die Heranziehung des Modells Sanders’ ermöglicht die Effektivierung von Schülervorstellungen für die praktische Umsetzung nach dem Prinzip des konzeptuellen Lernens.
Der didaktische Zugang der Subjektorientierung ist facettenreich und vereint verschiedene Aspekte. Ein wesentlicher Bestandteil davon sind die Schülervorstellungen, die sich unter anderem im didaktischen Prinzip des konzeptuellen Lernens berücksichtigen lassen. Nach diesem Prinzip ist Unterricht so zu gestalten, dass an das Vorwissen, also an die Vorstellungen der Lernenden, angeknüpft werden kann.
Insbesondere das fehlende Wissen über diese Vorstellungen und im Weiteren über Konzepte von Lernenden stellt aber ein Problem des Unterrichts dar. Welche Entwürfe über den Bereich des Politischen bestehen, welche Annahmen und Urteile in diesen enthalten sind und wie differenziert und vielleicht problematisch diese sind, sind Fragen, mit denen sich die Didaktik beschäftigen sollte, um einen konstruktiven Unterricht zu gestalten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Forschungsvorhaben
- 1.2. Wissenschaftliche Verortung
- 1.3. Aufbau der Arbeit
- 2. Theoriebildung
- 2.1. Entwicklungen politischer Bildung
- 2.2. Herausforderungen des 21. Jahrhunderts
- 2.3. Ziele politischer Bildung
- 2.3.1. Von Werten und Normen
- 2.3.2. Das Individuum im Kollektiv
- 2.3.3. Kompetenzen als Ziele politischer Bildung
- 2.3.3.1. Politische Urteilsfähigkeit
- 2.3.3.2. Politische Handlungsfähigkeit
- 2.3.4. Subjektorientierung
- 2.3.5. Konzeptuelles Lernen
- 2.3.6. (Schüler_innen-) Vorstellungen, Konzepte und Schemata
- 2.4. Das ,,Sander-Modell"
- 2.4.1. Von der Idee konzeptuellen Wissens zu den Basiskonzepten
- 2.4.2. Basiskonzepte
- 2.4.3. Das Basiskonzept Macht
- 3. Forschungsmethodisches Vorgehen
- 3.1. Qualitatives Forschen (als Grundprinzip)
- 3.2. Erhebungsmethode
- 3.2.1. Kritik am Gruppendiskussionsverfahren
- 3.2.2. Auswahl der Zielgruppe
- 3.2.3. Gruppenbeschreibung
- 3.2.4. Entwicklung des Leitfadens
- 3.2.5. Ablauf
- 3.3. Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring
- 4. Ergebnisdarstellung
- 4.1. Kategoriensystem
- 4.2. Analyse der Schüler_innenvorstellungen zum Konzept Macht
- 4.2.1. Ergebnistabelle
- 4.2.2. Macht und Bildung
- 4.2.3. Soziale Figuration
- 4.2.4. Stolz
- 4.2.5. Bewertung von Macht
- 4.2.6. Machtverhältnisse
- 4.2.7. Macht als attributionales Phänomen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Frage, wie sich Schüler_innenvorstellungen zum Konzept Macht in der Politischen Bildung einbeziehen lassen. Dabei wird die Subjektorientierung und das konzeptuelle Lernen als zentrale pädagogische Konzepte herangezogen.
- Die Arbeit untersucht die Entwicklungen politischer Bildung im Kontext der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.
- Sie beleuchtet die Bedeutung von Subjektorientierung und konzeptuellem Lernen für die politische Bildung.
- Die Arbeit analysiert Schüler_innenvorstellungen zum Konzept Macht mithilfe qualitativer Forschungsmethoden.
- Sie untersucht die Relevanz von Schüler_innenvorstellungen für die Gestaltung von Politikunterricht.
- Die Arbeit liefert praktische Anregungen zur Einbeziehung von Schüler_innenvorstellungen im Politikunterricht.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung
Das erste Kapitel führt in das Forschungsvorhaben ein, stellt den wissenschaftlichen Kontext dar und erläutert den Aufbau der Arbeit.
Kapitel 2: Theoriebildung
Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklungen der Politischen Bildung, die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts und die Ziele politischer Bildung. Es geht dabei auf Konzepte wie Subjektorientierung, konzeptuelles Lernen und (Schüler_innen-) Vorstellungen, Konzepte und Schemata ein. Das Kapitel schließt mit einer detaillierten Betrachtung des ,,Sander-Modells" und des Basiskonzepts Macht.
Kapitel 3: Forschungsmethodisches Vorgehen
Dieses Kapitel erläutert die gewählte qualitative Forschungsmethode, die Gruppendiskussion, und die Anwendung der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring. Es beschreibt die Auswahl der Zielgruppe, die Entwicklung des Leitfadens und den Ablauf der Untersuchung.
Kapitel 4: Ergebnisdarstellung
Das vierte Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung. Es enthält das Kategoriensystem, das zur Analyse der Schüler_innenvorstellungen zum Konzept Macht entwickelt wurde, sowie die Ergebnisse der Analyse. Die Analyse der Schüler_innenvorstellungen gliedert sich in verschiedene Kategorien wie "Macht und Bildung", "Soziale Figuration", "Stolz" und "Bewertung von Macht".
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Politische Bildung, Subjektorientierung, Konzeptuelles Lernen, Schüler_innenvorstellungen, Macht, Qualitative Inhaltsanalyse, Gruppendiskussion.
- Quote paper
- Madlen Schwaiger (Author), 2020, Subjektorientierung und konzeptuelles Lernen im Fach 'Politische Bildung'. Schülervorstellungen zum Konzept Macht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1004990