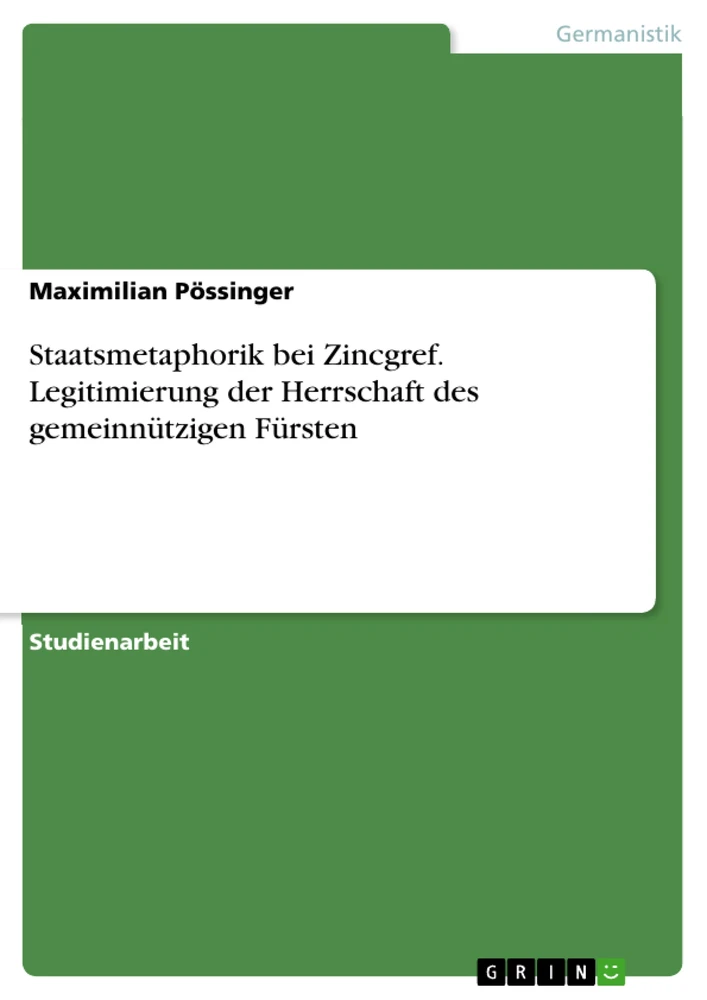Diese Arbeit widmet sich dem Werk des frühneuzeitlichen Dichters Julius Wilhelm Zincgref "Emblematum Ethico-Politicorum Centuria", das dem pfälzischen Kurfürsten Friedrich dem V. gewidmet ist. Es handelt es sich um eine Emblem-Sammlung, die in erster Linie in Form von Fürstenspiegeln auf die Eigenschaften des idealen Fürsten und des idealen Staates Bezug nehmen. Im Zuge dieser Arbeit wird eine gezielt ausgewählte Gruppe von Emblemen in dem Werk auf ihre Botschaften hin untersucht.
Gegenstand der Arbeit sind die Embleme II, XIX, XLIV und C. Die Auswahl fiel gerade auf diese Embleme, da diese trotz ihrer Verwendung unterschiedlicher Motive und Symbole eine oder mehrere gemeinsame Botschaften zu teilen scheinen, die möglicherweise zugleich als zentrale Aussagen zu verstehen sind, die Zincgref in seinem Werk treffen will. All diese Embleme appellieren nämlich auf ihre jeweils eigene Art an den Gemeinsinn des Fürsten und legitimieren doch zugleich seine Herrschaft.
Zincgref führt insgesamt 100 vom bedeutenden Kupferstecher Matthäus Merian gestochene Embleme auf, die jeweils mit unterschiedlichen Motiven auf den politischen Alltag anspielen und mehr oder weniger konkrete Botschaften vermitteln sollen. Die Gattung der Embleme hat sich im Laufe des 16. Jahrhunderts etabliert und ist als Bild-Text-Gattung immer doppelt kodiert. Das Emblem setzt sich zusammen aus einem knappen, oft rätselhaften Motto (Inscriptio), einem prägnanten Bildteil (Pictura) und einem erläuternden Text in Versform (Subscriptio). Die Kombination der verschiedenen Bild- und Textelemente des Emblems ergeben eine Botschaft, die nicht immer eindeutig zu entschlüsseln ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Staatsmetaphorik bei Zincgref: Legitimierung der Herrschaft des gemein-nützigen Fürsten
- 2.1. Historischer Kontext und Werkzusammenhang
- 2.2. Das Motiv vom Hirtenhund bei Zincgref
- 2.3. Das Staatsschiff-Motiv bei Zincgref
- 2.4. Das Motiv des Bienenstaats bei Zincgref
- 3. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert Julius Wilhelm Zincgrefs "Emblematum Ethico-Politicorum Centuria" (1619), indem sie ausgewählte Embleme auf ihre Botschaften hin untersucht. Ziel ist es, die Staatsmetaphorik in Zincgrefs Werk zu ergründen und die Legitimation der Herrschaft des gemein-nützigen Fürsten aufzuzeigen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der ausgewählten Embleme, insbesondere auf die Bildsymbole und ihre Botschaften.
- Staatsmetaphorik im frühneuzeitlichen Kontext
- Legitimation der Herrschaft des Fürsten durch Embleme
- Analyse ausgewählter Bildmotive (Hirte, Schiff, Bienenstaat)
- Gemeinsinn und politisches Handeln des Fürsten
- Zusammenhang zwischen Emblem, Kontext und Botschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Seminararbeit ein und stellt das Werk von Julius Wilhelm Zincgref, "Emblematum Ethico-Politicorum Centuria", vor. Sie beschreibt die Emblem-Sammlung als Fürstenspiegel, der die Eigenschaften des idealen Fürsten und Staates beleuchtet. Die Arbeit konzentriert sich auf eine Auswahl von Emblemen (II, XIX, XLIV und C), die trotz unterschiedlicher Motive ähnliche Botschaften vermitteln und den Gemeinsinn des Fürsten sowie die Legitimation seiner Herrschaft thematisieren. Die Analyse umfasst Inscriptio, Pictura und Subscriptio, wobei der Fokus auf den Bildteilen und ihren Symbolträgern liegt. Vor der Emblem-Analyse wird kurz der historische Kontext und der Werkzusammenhang beleuchtet, um eine fundierte Interpretation der Botschaften zu ermöglichen. Besonderes Augenmerk liegt auf Emblem I und seiner Beziehung zum Kurfürsten Friedrich V.
2. Staatsmetaphorik bei Zincgref: Legitimierung der Herrschaft des gemein-nützigen Fürsten: Dieses Kapitel untersucht den historischen und werkbezogenen Kontext von Zincgrefs "Emblematum Ethico-Politicorum Centuria", veröffentlicht 1619 zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges. Es beleuchtet Zincgrefs Position als "politischer Propagator" für die Kurpfalz und den Adressaten des Werkes, Kurfürst Friedrich V., der vor der Entscheidung zur Annahme der böhmischen Königswürde stand. Obwohl das Werk nicht direkt auf diese Entscheidung eingeht, wird der zeitgeschichtliche Kontext als Hintergrund für die Interpretation der Embleme herangezogen. Die Analyse des Werkes unterstreicht die Bedeutung der Embleme als Mittel der politischen Propaganda in einer Zeit großer Umbrüche.
Schlüsselwörter
Embleme, Staatsmetaphorik, frühneuzeitliche Literatur, Julius Wilhelm Zincgref, Legitimation der Herrschaft, Gemein-nütziger Fürst, Fürstenspiegel, Politische Emblematik, Dreißigjähriger Krieg, Kurpfalz, Friedrich V.
Häufig gestellte Fragen zu "Emblematum Ethico-Politicorum Centuria" von Julius Wilhelm Zincgref
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit analysiert die Staatsmetaphorik in Julius Wilhelm Zincgrefs "Emblematum Ethico-Politicorum Centuria" (1619) und untersucht, wie diese die Legitimation der Herrschaft eines gemein-nützigen Fürsten darstellt. Der Fokus liegt auf ausgewählten Emblemen und ihren Bildsymbolen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren Botschaften aufzuzeigen.
Welche Embleme werden im Detail analysiert?
Die Arbeit konzentriert sich auf eine Auswahl von Emblemen (II, XIX, XLIV und C), die trotz unterschiedlicher Motive ähnliche Botschaften vermitteln und den Gemeinsinn des Fürsten sowie die Legitimation seiner Herrschaft thematisieren. Die Analyse berücksichtigt Inscriptio, Pictura und Subscriptio, mit besonderem Augenmerk auf die Bildteile und ihre Symbolträger. Emblem I und seine Beziehung zum Kurfürsten Friedrich V. wird ebenfalls behandelt.
Welche Staatsmetaphoriken werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Staatsmetaphoriken in Zincgrefs Werk, darunter das Motiv vom Hirtenhund, das Staatsschiff und den Bienenstaat. Diese Metaphoriken werden im Kontext des Werkes analysiert, um ihre Bedeutung für die Legitimation der Herrschaft des Fürsten zu verstehen.
Welchen historischen Kontext berücksichtigt die Arbeit?
Die Arbeit beleuchtet den historischen Kontext von Zincgrefs Werk, das 1619 zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges veröffentlicht wurde. Sie berücksichtigt Zincgrefs Position als "politischer Propagator" für die Kurpfalz und den Adressaten des Werkes, Kurfürst Friedrich V., der vor der Entscheidung zur Annahme der böhmischen Königswürde stand. Der zeitgeschichtliche Kontext dient als Hintergrund für die Interpretation der Embleme.
Welche Schlüsselthemen werden behandelt?
Schlüsselthemen sind die Staatsmetaphorik im frühneuzeitlichen Kontext, die Legitimation der Herrschaft des Fürsten durch Embleme, die Analyse ausgewählter Bildmotive (Hirte, Schiff, Bienenstaat), Gemeinsinn und politisches Handeln des Fürsten sowie der Zusammenhang zwischen Emblem, Kontext und Botschaft.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel zur Staatsmetaphorik bei Zincgref und eine Zusammenfassung. Das Hauptkapitel analysiert den historischen Kontext und Werkzusammenhang, sowie die verschiedenen Staatsmetaphoriken (Hirtenhund, Staatsschiff, Bienenstaat) im Detail. Die Einleitung stellt das Werk von Zincgref vor und beschreibt die Ziele der Arbeit. Die Zusammenfassung fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Embleme, Staatsmetaphorik, frühneuzeitliche Literatur, Julius Wilhelm Zincgref, Legitimation der Herrschaft, Gemein-nütziger Fürst, Fürstenspiegel, Politische Emblematik, Dreißigjähriger Krieg, Kurpfalz, Friedrich V.
Welche Ziele verfolgt die Seminararbeit?
Das Ziel der Seminararbeit ist es, die Staatsmetaphorik in Zincgrefs "Emblematum Ethico-Politicorum Centuria" zu ergründen und die Legitimation der Herrschaft des gemein-nützigen Fürsten aufzuzeigen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der ausgewählten Embleme, insbesondere auf die Bildsymbole und ihre Botschaften.
- Quote paper
- Maximilian Pössinger (Author), 2018, Staatsmetaphorik bei Zincgref. Legitimierung der Herrschaft des gemeinnützigen Fürsten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1005131