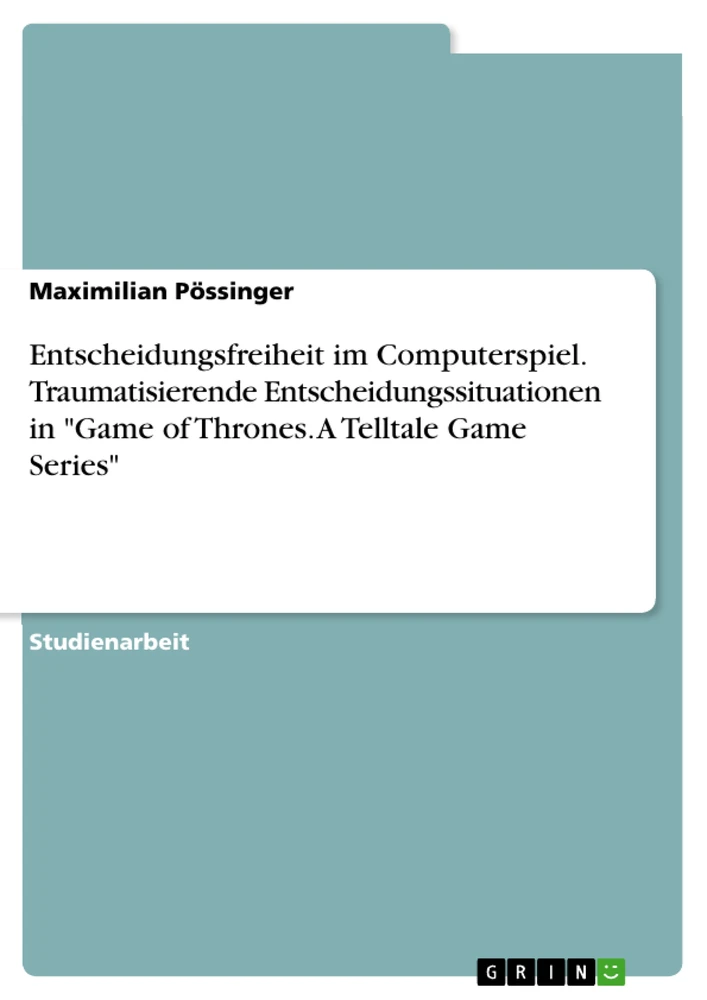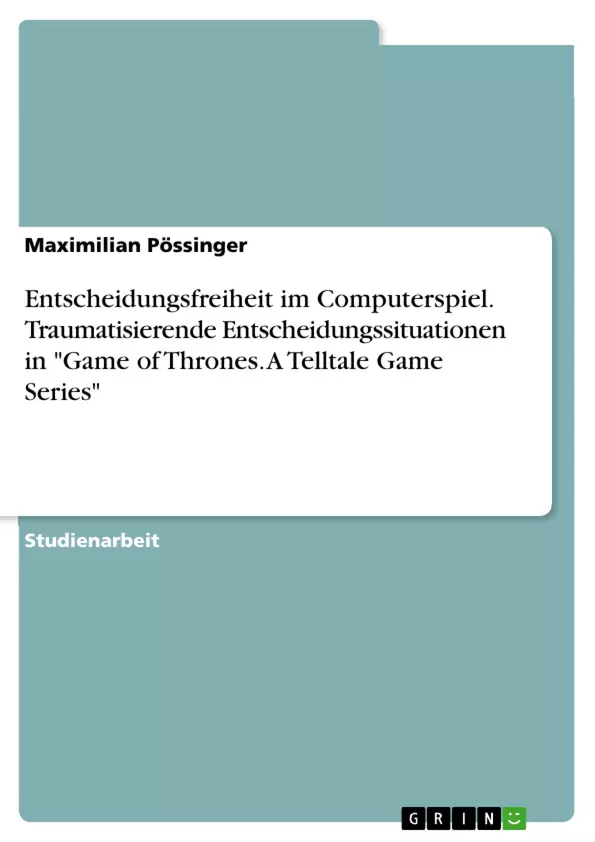Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Entscheidungsfreiheit in Computerspielen am Beispiel des Spiels "Game of Thrones" (GOT) von Telltale Games. Es wird untersucht, ob im Fall von GOT von einer vorgetäuschten beziehungsweise fingierten Entscheidungsfreiheit gesprochen werden kann. Die Frage, mit welchen Methoden dem Spieler eine Entscheidungsfreiheit suggeriert wird, soll dabei im Fokus stehen. Auch mögliche Gründe der Entwickler, dem Spieler keine uneingeschränkte Gestaltungsmacht über die Handlung zu gewähren, werden analysiert.
Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit die Entscheidungssituationen in GOT so konstruiert sind, dass sie auf den Spieler letztlich vor allem frustrierend oder gar traumatisierend wirken, beziehungsweise wirken sollen. Nicht zu vergessen ist nämlich, dass das Spiel die Adaption einer Buch- und TV-Serie ist, und als solche versucht, dem Erzählstil der Vorlage zu entsprechen.
Das Computerspiel als Medium hat im Verhältnis zum klassischen Roman oder Film den Vorteil, dass der Rezipient hier kein rein passiver Konsument ist. Indem er mit der Handlungswelt und ihren Figuren aktiv interagiert, kann der Spieler selbst ein Teil des Geschehens werden und tief in die fiktive Welt eintauchen. Das Interagieren macht die Faszination des Mediums aus und es ist die Eigenschaft, die es am stärksten von anderen Medien abhebt. Oftmals ist der Spielende sogar in der Lage, durch eigene Entscheidungen Einfluss auf die Narration auszuüben.
Besonders stark entfaltet sich die spielerische Gestaltungsmacht in solchen Computerspielen, in denen die Entscheidungssituation als zentrales Element in den Fokus gerückt wird. Dies trifft zum Beispiel auf viele Spiele des Entwicklerstudios Telltale Games zu, die Teil einer Entwicklung von Computerspielen sind, die als "Decision Turn" bezeichnet werden kann. Diese Entwicklung meint unter anderem eine fortschreitende Tendenz vieler Computerspiele, Entscheidungen mehr und mehr in den Vordergrund zu rücken und in ihrer Komplexität und Reichweite aufzuwerten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Entscheidungsfreiheit in Game of Thrones: A Telltale Game Series: Eine reine Illusion?
- 3. „Die Qual der Wahl“ - Traumatisierende Entscheidungssituationen im Geiste der Buch- und TV-Vorlage
- 4. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Entscheidungsfreiheit im Computerspiel "Game of Thrones: A Telltale Game Series". Ziel ist es, die Gestaltung der Entscheidungsmechaniken zu analysieren und zu bewerten, inwieweit dem Spieler tatsächlich Entscheidungsfreiheit gewährt wird oder ob diese nur vorgetäuscht ist. Dabei wird der Fokus auf die Wirkung der Entscheidungssituationen auf den Spieler gelegt, insbesondere im Hinblick auf Frustration oder gar Traumatisierung. Die Arbeit bezieht die Buch- und Fernsehvorlage mit ein und untersucht, wie das Spiel den Erzählstil der Vorlage adaptiert.
- Analyse der Entscheidungsmechaniken in "Game of Thrones: A Telltale Game Series"
- Bewertung der tatsächlichen Entscheidungsfreiheit des Spielers
- Wirkung der Entscheidungssituationen auf den Spieler (Frustration, Traumatisierung)
- Adaption des Erzählstils der Buch- und Fernsehvorlage
- Vergleich mit anderen Telltale Games Titeln
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Entscheidungsfreiheit in Computerspielen ein und hebt die Besonderheit von Telltale Games hervor, die Entscheidungssituationen in den Mittelpunkt ihrer Spiele rücken. Sie stellt die Forschungsfrage nach dem Ausmaß der Entscheidungsfreiheit in "Game of Thrones: A Telltale Game Series" und der Wirkung dieser auf den Spieler. Die Arbeit wird methodisch eingegrenzt und die relevanten Forschungsliteratur genannt, insbesondere Backes' typologische Einführung in Erzählstrukturen im Computerspiel und der Sammelband „I'll remember this“, der sich mit Entscheidungen im Computerspiel auseinandersetzt. Die These des Gamestar-Redakteurs, dass "Game of Thrones" nur vorgetäuschte Entscheidungsfreiheit bietet, wird als Ausgangspunkt der Analyse genannt.
2. Entscheidungsfreiheit in Game of Thrones: A Telltale Game Series: Eine reine Illusion?: Dieses Kapitel untersucht, ob die Entscheidungsfreiheit in "Game of Thrones: A Telltale Game Series" tatsächlich besteht oder nur simuliert wird. Es wird analysiert, wie das Spiel dem Spieler durch verschiedene Mechanismen, wie z.B. Dialogoptionen mit Konsequenzen, das Gefühl von Entscheidungsfreiheit vermittelt. Gleichzeitig werden mögliche Gründe der Entwickler für die Einschränkung der Spielerkontrolle beleuchtet, und die Rolle des Vorwissens aus Buch und TV-Serie für die Interpretation der Spielerfahrung wird erörtert. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, ob die Mechaniken des Spiels zu Frustration oder Traumatisierung führen.
Schlüsselwörter
Entscheidungsfreiheit, Computerspiel, Game of Thrones, Telltale Games, Narrative, Spielerfahrung, Illusion, Traumatisierung, Dialogoptionen, Adaption, Buchvorlage, Fernsehserie, Decision Turn.
Game of Thrones: A Telltale Game Series - Seminararbeit: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert die Entscheidungsfreiheit im Computerspiel "Game of Thrones: A Telltale Game Series". Sie untersucht, ob die angebotene Entscheidungsfreiheit tatsächlich besteht oder nur simuliert ist und welche Auswirkungen die Entscheidungssituationen auf den Spieler haben (Frustration, Traumatisierung).
Welche Aspekte werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit untersucht die Entscheidungsmechaniken des Spiels, bewertet das Ausmaß der tatsächlichen Entscheidungsfreiheit, analysiert die Wirkung der Entscheidungen auf den Spieler, betrachtet die Adaption des Erzählstils aus Buch und TV-Serie und vergleicht das Spiel möglicherweise mit anderen Telltale Games Titeln.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf die Buch- und Fernsehvorlage von "Game of Thrones". Methodisch wird auf relevante Forschungsliteratur zurückgegriffen, insbesondere auf Backes' typologische Einführung in Erzählstrukturen im Computerspiel und den Sammelband „I'll remember this“, der sich mit Entscheidungen im Computerspiel auseinandersetzt. Die These eines Gamestar-Redakteurs über vorgetäuschte Entscheidungsfreiheit dient als Ausgangspunkt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Entscheidungsfreiheit im Spiel, ein Kapitel zu traumatisierenden Entscheidungssituationen im Kontext von Buch und TV-Serie und eine Zusammenfassung. Das Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden gegeben?
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage. Kapitel 2 analysiert die Entscheidungsmechaniken und untersucht, ob die Entscheidungsfreiheit nur simuliert ist. Die Arbeit konzentriert sich auf die Frage, ob die Mechaniken zu Frustration oder Traumatisierung führen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Entscheidungsfreiheit, Computerspiel, Game of Thrones, Telltale Games, Narrative, Spielerfahrung, Illusion, Traumatisierung, Dialogoptionen, Adaption, Buchvorlage, Fernsehserie, Decision Turn.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Gestaltung der Entscheidungsmechaniken in "Game of Thrones: A Telltale Game Series" zu analysieren und zu bewerten, inwieweit dem Spieler tatsächlich Entscheidungsfreiheit gewährt wird oder ob diese nur vorgetäuscht ist. Der Fokus liegt auf der Wirkung der Entscheidungssituationen auf den Spieler.
- Quote paper
- Maximilian Pössinger (Author), 2017, Entscheidungsfreiheit im Computerspiel. Traumatisierende Entscheidungssituationen in "Game of Thrones. A Telltale Game Series", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1005134