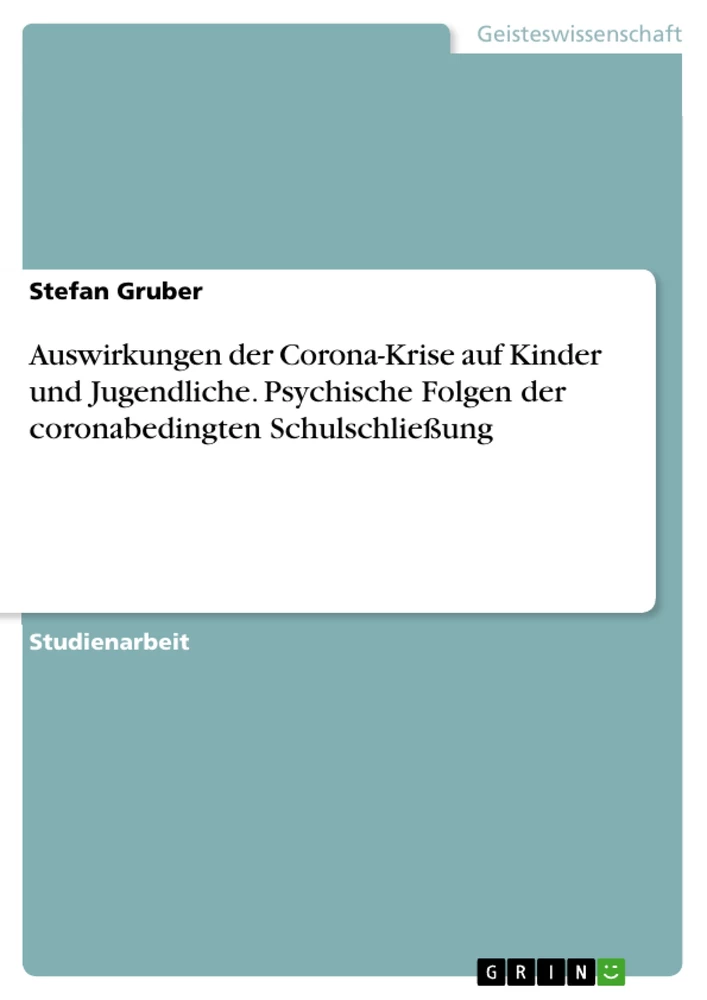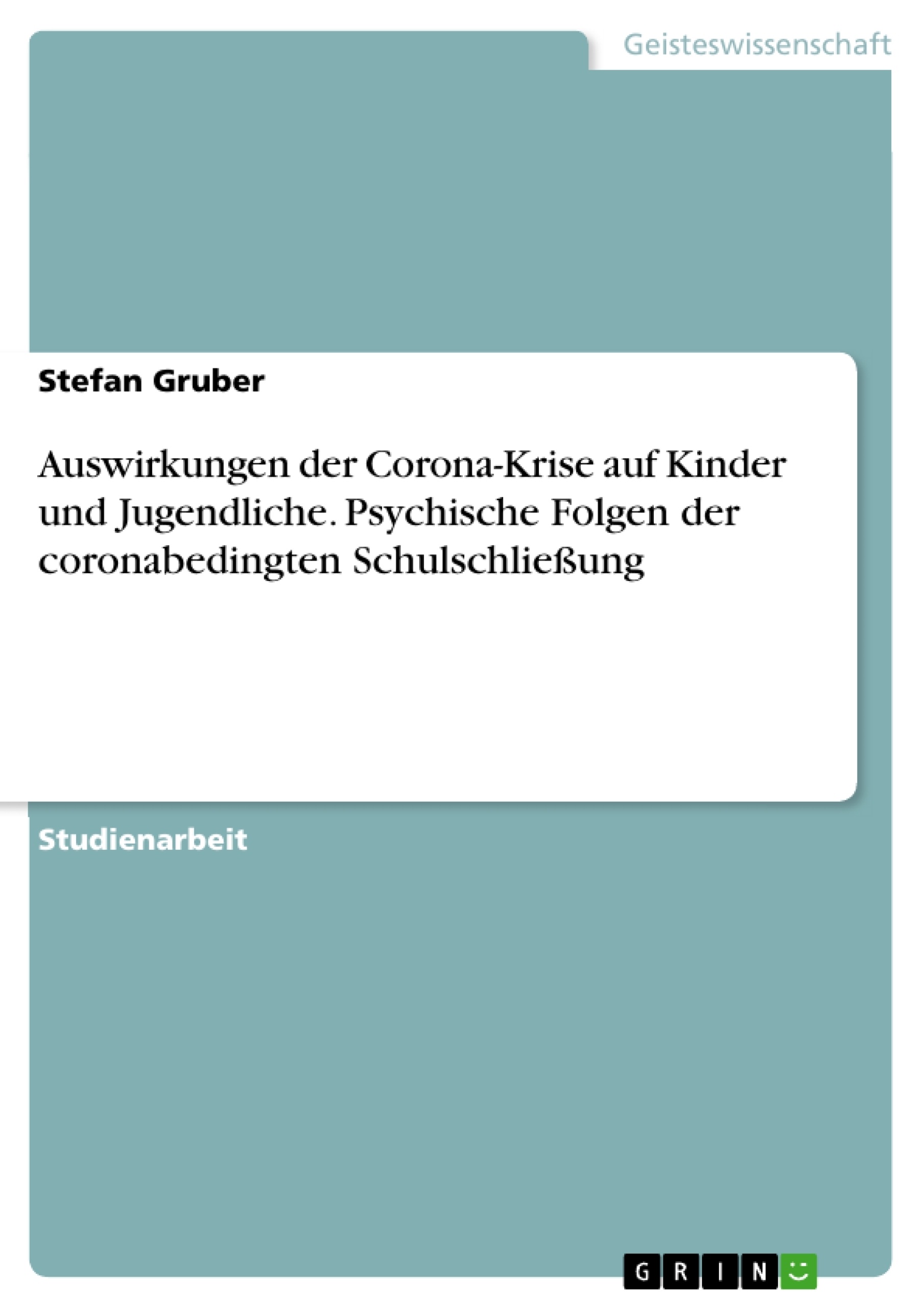Ziel dieser Arbeit ist es, Problemfelder der Corona-Beschränkungen anhand wissenschaftlicher Untersuchungen herauszufiltern. Zudem werden Lösungsvorschläge, wie Politiker, Medien und Eltern mögliche Entwicklungsschäden von Kindern und Jugendlichen abwenden können, erarbeitet. Hierfür werden die einzelnen Phasen der Entwicklung in der Theorie wiedergegeben. Kapitel 2 umfasst die Erklärung der Entwicklungstheorien von Freud, Piagets und Erikson.
Kapitel 3 beinhaltet eine genaue Einsicht in die einzelnen Entwicklungsstufen der Kindheit, als auch eine Übersicht über die einzelnen Erziehungsstile. Das vierte Kapitel umfasst den letzten theoretischen Teil der Arbeit, der sich mit den Veränderungen in der Pubertät auseinandersetzt. In Kapitel 5 wird das aktuelle Problemfeld der Corona-Beschränkungen (mit Schwerpunkt auf den Schulschließungen) betrachtet.
In Kapitel 6 werden Probleme mithilfe wissenschaftlicher Untersuchungen herausgefiltert und Lösungsvorschläge zur Abwendung entwicklungspsychologischer Schäden gebracht. Im nächsten Kapitel wird die Theorie mit praktischen Beispielen der aktuellen Corona-Phase verknüpft. Kapitel 8 stellt ein umfassendes Konzept vor, dass in der aktuellen Pandemie angewendet werden kann, um mögliche Entwicklungsschäden abzuwenden beziehungsweise möglichst gering zu halten.
Der Mensch durchläuft mehrere Entwicklungsphasen in seinem Leben. Von der frühkindlichen bis zur pubertären Entwicklungszeit existieren mehrere Theorien, wie die psychosexuellen Entwicklungsstufen, die psychosozialen Entwicklungsstufen und die kognitive Entwicklungstheorie. Der Fokus dieser Arbeit liegt in der essenziellen Entwicklungszeit von der frühen Kindheit bis zum Jugendalter.
In dieser Phase wird der Grundstein für die Entwicklung eines erwachsenen Menschen gelegt und kann durch äußere Einflüsse wie Eltern und Geschwister sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf das Leben eines Menschen nehmen. Ein derzeitig aktuelles Thema ist die Coronapandemie, die Einfluss auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen hat. Durch Schulschließungen und veränderte soziale Umstände, wie zum Beispiel Ausgangsbeschränkungen, drohen negative Konsequenzen in den wichtigsten Entwicklungsphasen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entwicklungsstufen von Kindern und Jugendlichen
- Psychosexuelle Entwicklungsstufentheorie
- Psychosoziale Entwicklungsstufentheorie
- Kognitive Entwicklungstheorie von Jean Piagets
- Entwicklungsphasen von Kindern
- Entwicklung von Jugendlichen
- Problemfeld: Corona Krise und Auswirkungen auf Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Lösungsvorschlag zur Abwendung etwaiger Entwicklungsbeeinträchtigungen von Kindern und Jugendlichen durch Corona Maßnahmen
- Diskussion: Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in der Corona Phase
- Konzepterstellung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, die Auswirkungen der Corona Pandemie auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu untersuchen. Sie befasst sich mit den verschiedenen Entwicklungstheorien und deren Relevanz in der aktuellen Situation.
- Entwicklungstheorien von Freud, Piaget und Erikson
- Einfluss von Schulschließungen und anderen Corona-bedingten Einschränkungen auf die Entwicklung
- Mögliche Entwicklungsschäden und Lösungsansätze zur Abwendung
- Diskussion und praktische Anwendung der theoretischen Erkenntnisse
- Konzepterstellung für die Anwendung in der aktuellen Pandemie
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 2 beleuchtet die verschiedenen Entwicklungstheorien von Freud, Piaget und Erikson, die das Verständnis der kindlichen und jugendlichen Entwicklung beeinflussen.
- Kapitel 3 geht detailliert auf die einzelnen Entwicklungsstufen der Kindheit ein und bietet einen Überblick über unterschiedliche Erziehungsstile.
- Kapitel 4 widmet sich den Veränderungen in der Pubertät und setzt diese in den Kontext der Entwicklungstheorien.
- Kapitel 5 stellt die Corona-Beschränkungen, insbesondere Schulschließungen, als aktuelles Problemfeld für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen dar.
- Kapitel 6 analysiert die Probleme durch wissenschaftliche Untersuchungen und liefert Lösungsvorschläge, um mögliche Entwicklungsschäden abzuwenden.
- Kapitel 7 verknüpft die Theorie mit konkreten Beispielen aus der aktuellen Corona-Phase.
- Kapitel 8 präsentiert ein umfassendes Konzept, das in der aktuellen Pandemie Anwendung finden kann, um mögliche Entwicklungsschäden zu minimieren.
Schlüsselwörter
Entwicklungspsychologie, Kinder, Jugendliche, Corona Pandemie, Schulschließungen, Entwicklungsstufen, psychosexuelle Entwicklung, psychosoziale Entwicklung, kognitive Entwicklung, Erziehungsstile, Entwicklungsschäden, Lösungsansätze, Konzept, Pandemie.
Häufig gestellte Fragen
Welche psychischen Folgen hatten die Schulschließungen in der Corona-Krise?
Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass Schulschließungen und soziale Isolation zu Ängsten, Stress und einer Beeinträchtigung der gesunden psychischen Entwicklung führen können.
Welche Entwicklungstheorien werden in der Arbeit herangezogen?
Die Arbeit basiert auf den Theorien von Sigmund Freud (psychosexuell), Jean Piaget (kognitiv) und Erik H. Erikson (psychosozial), um die Auswirkungen auf Kinder zu analysieren.
Warum ist die Pubertät in der Pandemie besonders kritisch?
In der Pubertät findet eine essenzielle Ablösung und soziale Orientierung statt. Corona-Beschränkungen behindern diese wichtigen Entwicklungsschritte durch fehlende soziale Kontakte.
Wie können Eltern Entwicklungsschäden bei ihren Kindern abwenden?
Durch bewusste Erziehungsstile, die Förderung alternativer sozialer Kontakte und die Schaffung stabiler Strukturen im Alltag können negative Folgen abgemildert werden.
Gibt es ein Konzept zur Minimierung der Pandemie-Folgen?
Ja, die Arbeit stellt ein umfassendes Konzept vor, das Politik, Medien und Eltern Handlungsvorschläge bietet, um die psychischen Belastungen für Jugendliche zu reduzieren.
- Quote paper
- Stefan Gruber (Author), 2020, Auswirkungen der Corona-Krise auf Kinder und Jugendliche. Psychische Folgen der coronabedingten Schulschließung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1005362