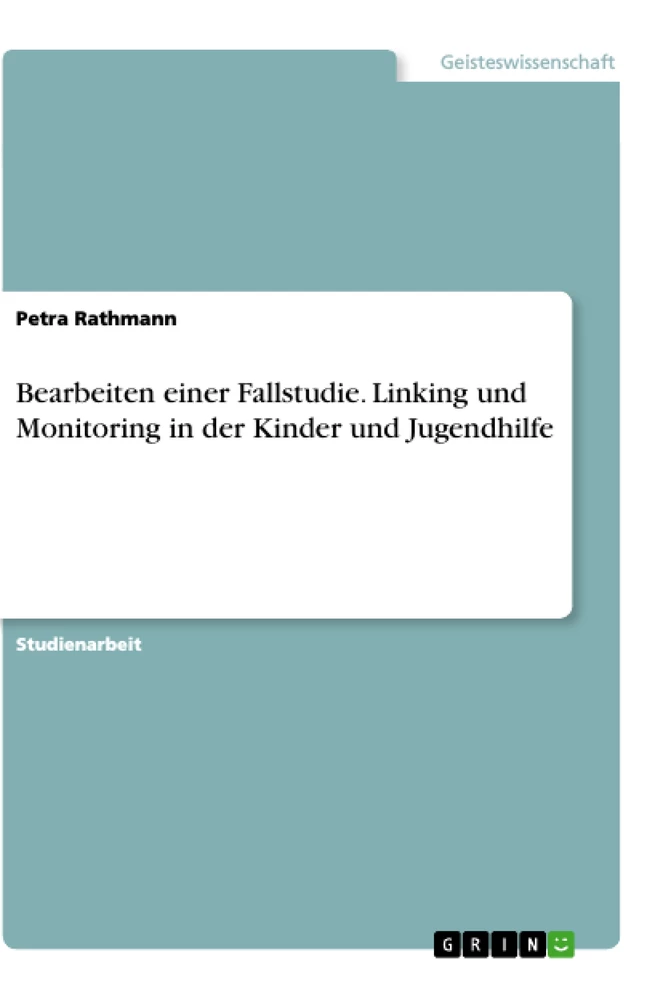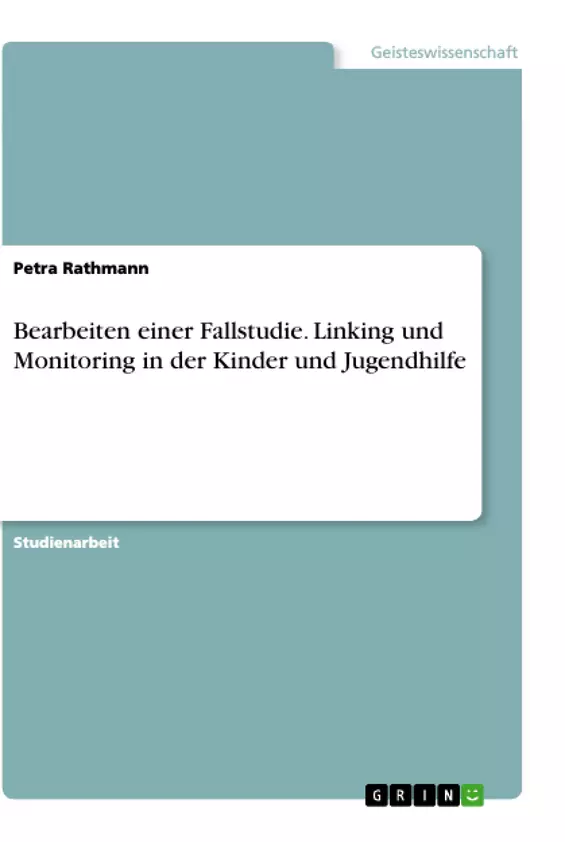Diese Arbeit befasst sich mit der Fallarbeit im Bereich des Familienmanagements und geht gesondert auf das Linking und Monitoring ein. Die Anfänge der Fallarbeit liegen in Amerika in den 1980-er Jahren. Ziel war es Kinder in problematischen Familiensituationen zu helfen. Genannt wurde dieses Verfahren "Child and Adolescent Service System Program (CASSP)". Auf dieser Basis wurde das heutige Fallmanagement in der Kinder- und Jugendhilfe erarbeitet. Festgelegt ist das im Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII), Kinder- und Jugendhilfe vom 26.06.1990. Paragraf 1 SGB VIII Recht auf Erziehung, Elternverantwortung und Jugendhilfe legen fest, dass "jeder junge Mensch ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person hat".
Absatz zwei regelt "das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst Ihnen obliegende Pflicht dieser Erziehung und Förderung. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft". In Absatz drei werden die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe beschrieben. Diese sind die zum einen die Förderung junger Menschen, Eltern bei ihrer Arbeit zu unterstützen, Kinder und Jugendliche zu schützen und positive Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche zu schaffen. Dies ist die gesetzliche Grundlage für das Fallmanagement in der Kinder- und Jugendhilfe. Eine wichtige Voraussetzung ist, dass die Adressatinnen und Adressaten freiwillig am Fallmanagement teilnehmen.
Die Aufgabe der Kindererziehung ist somit zwischen den Eltern, dem Staat, Bund und Ländern sowie den freien und öffentlichen Trägern aufgeteilt. Die freien und öffentlichen Träger übernehmen die oben genannten Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Fallbeschreibung
- 3. Fallmanagement im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe
- 4. Linking
- 4.1. Vorbereitung
- 4.2. Vermittlung
- 4.3. Anpassung
- 4.4. Fallbezogene Vernetzung
- 5. Monitoring
- 5.1. Normaler Fallverlauf
- 5.2. Drohender Abbruch durch den Klienten
- 5.3. Fehlende Umsetzung der vereinbarten Leistungen durch einen Leistungserbringer
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Fallstudie beschreibt den Ablauf des Fallmanagements in der Kinder- und Jugendhilfe anhand eines konkreten Beispiels. Der Fokus liegt auf den Phasen des Linking und Monitorings, um die praktische Umsetzung und Herausforderungen im Umgang mit Multiproblemfamilien zu verdeutlichen.
- Fallmanagement in der Kinder- und Jugendhilfe
- Die Phasen des Linking (Vorbereitung, Vermittlung, Anpassung, Vernetzung)
- Monitoring und Herausforderungen im Prozess
- Ressourcenaktivierung und Netzwerkbildung
- Zusammenarbeit mit verschiedenen Leistungserbringern
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung erläutert die historischen Anfänge der Fallarbeit in Amerika und deren Entwicklung zum heutigen Fallmanagement in der Kinder- und Jugendhilfe gemäß SGB VIII. Sie betont das Recht jedes jungen Menschen auf Förderung und Erziehung sowie die geteilte Verantwortung von Eltern und staatlichen Institutionen. Die Komplexität von Multiproblemfamilien und die Notwendigkeit des Fallmanagements im Dienstleistungs- und Kinderschutzbereich werden hervorgehoben. Die freiwillige Teilnahme der Adressaten am Fallmanagement wird als wichtige Voraussetzung genannt.
2. Fallbeschreibung: Dieses Kapitel präsentiert die Familie Mustermann mit zwei Kindern und den Problemen der Mutter (Depressionen) und des Vaters (Spielsucht) als Fallbeispiel. Die daraus resultierenden Schwierigkeiten wie unregelmäßiger Kindergartenbesuch des Sohnes und Schulschwänzen sowie Ladendiebstahl der Tochter werden detailliert beschrieben. Dieser Fall dient als Grundlage für die anschließende Darstellung der Fallmanagementphasen.
3. Fallmanagement im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Phasen des Fallmanagements (Zugangseröffnung, Assessment, Service- und Hilfeplanphase, Linking, Monitoring, Evaluation) im Kontext des beschriebenen Fallbeispiels. Es wird betont, dass der Prozess zirkulär und nicht starr ist und Anpassungen erfordert. Die Einordnung des Fallbeispiels in den Bereich der Dienstleistungen, nicht des Kinderschutzes, wird begründet.
4. Linking: Der Fokus dieses Kapitels liegt auf der Linking-Phase des Fallmanagements, der kontrollierten Durchführung der im Serviceplan festgelegten Maßnahmen. Es wird die Suche nach und Vermittlung von passenden Angeboten (formell und informell) erläutert, mit dem Ziel, den Klienten zu einem selbstständig gestaltbaren Leben zu verhelfen. Die Unterteilung in Vorbereitung, Vermittlung, Anpassung und fallbezogene Vernetzung wird beschrieben und am Beispiel der Familie Mustermann illustriert. Die Vorbereitungsphase wird ausführlich beschrieben, mit Fokus auf die Beschaffung von Ressourcen und die Aktivierung des vorhandenen sozialen Netzwerkes.
Schlüsselwörter
Fallmanagement, Kinder- und Jugendhilfe, Linking, Monitoring, Multiproblemfamilien, Ressourcenaktivierung, Netzwerkbildung, SGB VIII, Kindeswohlgefährdung, Depression, Spielsucht.
Häufig gestellte Fragen zur Fallstudie: Fallmanagement in der Kinder- und Jugendhilfe
Was ist der Inhalt dieser Fallstudie?
Diese Fallstudie beschreibt detailliert den Ablauf des Fallmanagements in der Kinder- und Jugendhilfe anhand eines konkreten Fallbeispiels (Familie Mustermann). Der Fokus liegt auf den Phasen des Linking (Vorbereitung, Vermittlung, Anpassung, Vernetzung) und des Monitorings. Die Studie umfasst eine Einleitung, eine Fallbeschreibung, eine Erklärung des Fallmanagements im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe, eine detaillierte Betrachtung des Linking und Monitorings, sowie ein Fazit. Zusätzlich werden Zielsetzung, Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter bereitgestellt.
Welche Phasen des Fallmanagements werden besonders behandelt?
Die Fallstudie konzentriert sich insbesondere auf die Phasen des Linking und des Monitorings. Das Linking umfasst die Vorbereitung, die Vermittlung geeigneter Angebote, die Anpassung an die Bedürfnisse der Familie und die Vernetzung mit verschiedenen Akteuren. Das Monitoring befasst sich mit der Überwachung des Fortschritts, dem Umgang mit drohenden Abbrüchen und der Sicherstellung der Umsetzung vereinbarter Leistungen.
Welches Fallbeispiel wird verwendet?
Die Studie verwendet das Fallbeispiel der Familie Mustermann, einer Multiproblemfamilie mit zwei Kindern, deren Mutter an Depressionen und deren Vater an Spielsucht leidet. Die daraus resultierenden Probleme (unregelmäßiger Kindergartenbesuch, Schulschwänzen, Ladendiebstahl) werden detailliert dargestellt.
Welche Herausforderungen werden im Kontext des Fallmanagements angesprochen?
Die Fallstudie beleuchtet die Herausforderungen im Umgang mit Multiproblemfamilien, die Zusammenarbeit mit verschiedenen Leistungserbringern und die Notwendigkeit der Ressourcenaktivierung und Netzwerkbildung. Zudem wird der Umgang mit potenziellen Abbrüchen durch den Klienten und die fehlende Umsetzung vereinbarter Leistungen durch Leistungserbringer thematisiert.
Welche gesetzlichen Grundlagen sind relevant?
Die Studie bezieht sich auf das SGB VIII (Sozialgesetzbuch VIII) und die damit verbundenen gesetzlichen Regelungen zur Förderung und Erziehung junger Menschen.
Was sind die Schlüsselwörter der Fallstudie?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Fallmanagement, Kinder- und Jugendhilfe, Linking, Monitoring, Multiproblemfamilien, Ressourcenaktivierung, Netzwerkbildung, SGB VIII, Kindeswohlgefährdung, Depression, Spielsucht.
Wie ist der Aufbau der Fallstudie?
Die Fallstudie gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Fallbeschreibung, Fallmanagement in der Kinder- und Jugendhilfe, Linking (mit Unterkapiteln zu Vorbereitung, Vermittlung, Anpassung und Vernetzung), Monitoring (mit Unterkapiteln zu normalem Verlauf, drohendem Abbruch und fehlender Umsetzung), und Fazit.
Was ist das Fazit der Fallstudie?
(Das Fazit ist in der Vorlage nicht explizit dargestellt, die Antwort müsste aus dem vollständigen Text der Fallstudie entnommen werden.)
- Citar trabajo
- Petra Rathmann (Autor), 2020, Bearbeiten einer Fallstudie. Linking und Monitoring in der Kinder und Jugendhilfe, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1005493