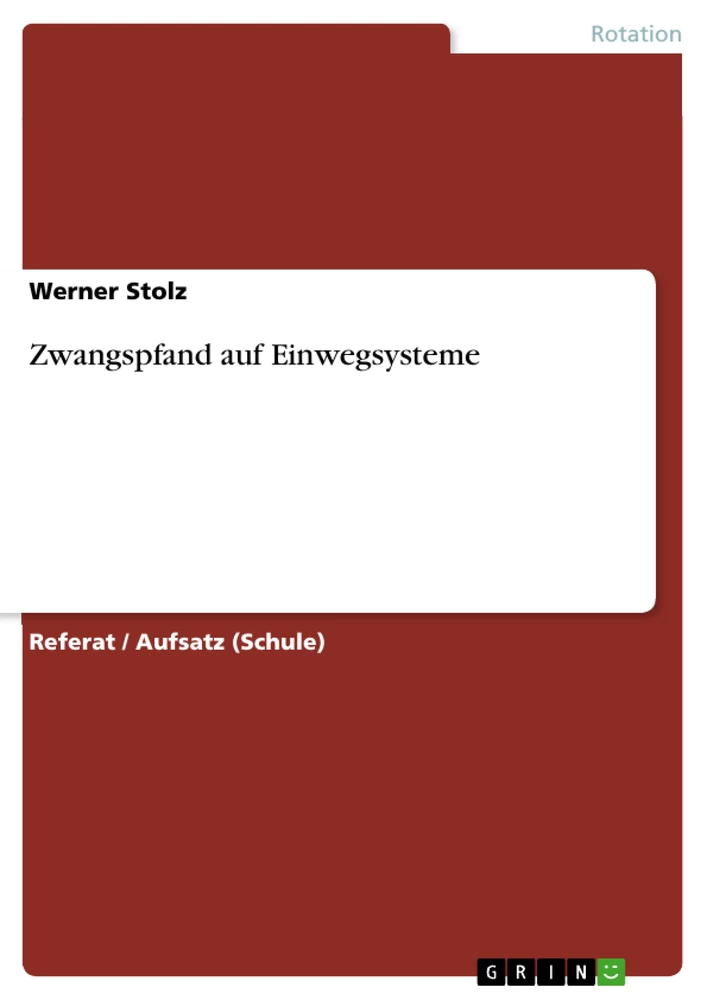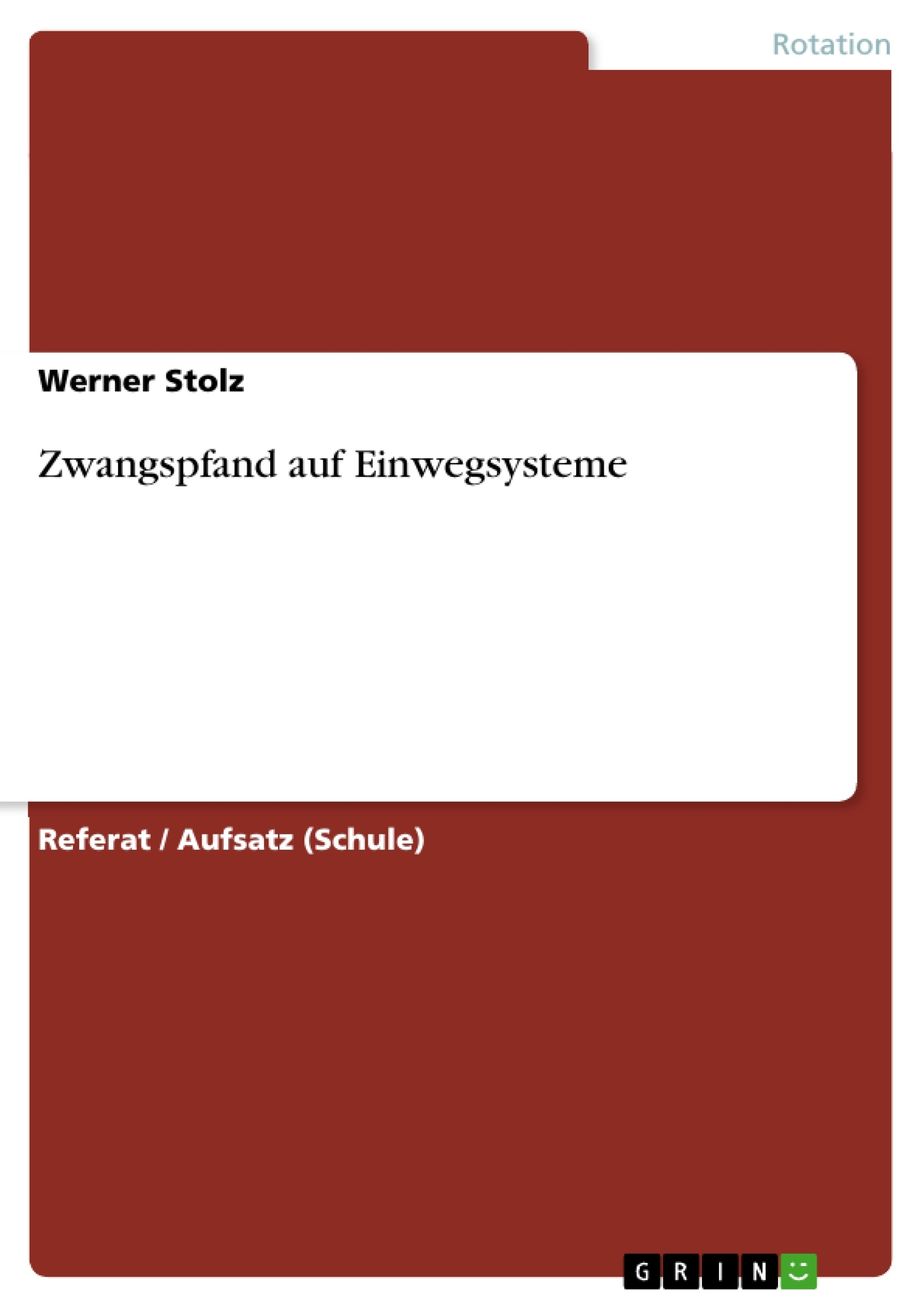Zwangspfand auf Einwegsysteme - Meilenstein oder Störfaktor in der Abfall - Kreis- laufwirtschaft?
Ökonomische, ökologische und soziale Folgen des Sanktionsinstrumentes
1. Noch bis Ende der 60-er Jahre war in Deutschland das Abfallbeseitigungsrecht ledig- lich Gegenstand kommunaler Müllabfuhr-Gebührensatzungen. Dann regelten erste Landesgesetze auch eine umweltverträgliche Deponierung. Inzwischen wandelt sich das Abfallrecht immer mehr zu einem Recht der ökologischen Abfallwirtschaft. Dabei geraten mitunter marktwirtschaftliche Strukturprinzipien und starre staatliche Eingriffsinstrumente in Zielkonflikte. Dies gilt exemplarisch für die aktuelle Diskussion, ob die Einführung eines Zwangspfandes auf Einweg-Getränkeverpackungen mit den Grundsätzen einer sachgerechten Abfall-Kreislaufwirtschaft vereinbar ist.
2. So sollen Abfälle in Umsetzung des Kreislaufwirtschaftsgedankens möglichst schon auf der Produktions- und Verbraucherebene vermieden, nicht vermeidbare Abfälle durch Getrennthaltung einer möglichst umfassenden stofflichen Verwertung zugeführt und nicht weiter zu behandelnde Abfälle umweltverträglich abgelagert werden. Aber nicht nur die entsorgungspflichtigen Körperschaften sind gesetzlich gehalten, das Vermeidungs- und Verwertungsgebot in praktisches Handeln umzusetzen. Hinzu kommt die kooperativ einbezogene Eigenverantwortlichkeit von Produzenten und Konsumenten. Dies gilt insbesondere im Bereich der Verkaufsverpackungen. Hier haben Hersteller und Händler gemeinsam ein sog. „duales Entsorgungssystem“ - ne- ben der weiterhin bestehenden öffentlichen Abfallentsorgung - eingerichtet. Die Dua- les System Deutschland AG (DSD) organisiert hierbei die haushaltsnahe Sammlung von getrennt gesammelten Verkaufsverpackungen in gelben Säcken/Tonnen sowie die Sortierung und stoffliche Verwertung nach Materialgruppen. Die anfallenden Kosten werden von den privaten Garantiegebern über Lizenzen finanziert. Konkret haben die Bundesbürger im Jahre 1996 rund 5,5 Millionen Tonnen Verpackungen mit dem grü- nen Punkt auf diese Weise entsorgt. Aus dem Sammelaufkommen wurden 5,32 Milli- onen Tonnen Wertstoffe aussortiert und einer Wiederverwertung zugeführt. Verpackungsrecycling findet in einem klar definierten rechtlichen Rahmen statt, der durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz, die deutsche Verpackungsordnung und die Europäische Verpackungsrichtlinie vorgegeben wird.
2.1. Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz vom 7. Oktober 19961
Durch konsequente Anwendung des Verursacherprinzips im Sinne der Produktverantwortung und Ausweitung des Prinzips der Kreislaufwirtschaft will das Gesetz zur Abfallverringerung bzw. umweltgerechten Verwertung oder Beseitigung beitragen.
2.2. Europäische Verpackungsrichtlinie vom 20. Dezember 19942
Ziele dieser inzwischen in nationales Recht umgesetzten Richtlinie sind neben der Harmonisierung der Rechtslage in den EU-Mitgliedstaaten die Erhöhung von Verwertungsquoten der Verpackungsabfälle. Entsprechende nationale Regelungen dürfen aber gemäß EWG-Vertrag die Garantie des freien Warenverkehrs innerhalb der Gemeinschaft nicht verbieten bzw. behindern.
2.3. Novelle der Verpackungsverordnung vom 28. August 19983
Die Novelle der Verpackungsordnung war ebenso wie ihre Ursprungsfassung vom 12. Juni 1991 im parlamentarischen Beratungsverfahren sehr umstritten. Seitdem müssen im Sinne der Kreislaufwirtschaft nicht nur Transportverpackungen, sondern auch alle Verkaufsverpackungen einer stofflichen Wiederverwertung zugeführt werden. Durch die strengen Rücknahmeverpflichtungen, die im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben durch das von der Privatwirtschaft aufgebaute „Duale System“ (DSD) ausgeführt werden, konnten nicht nur die Wiederverwertungsquoten enorm erhöht, sondern auch das Ziel der Abfallvermeidung vorangetrieben werden.
Kontroverse Diskussionen entzündeten sich u.a. an der gesetzlichen Vorgabe einer Mehrwegquote. Fällt der Mehrweganteil danach bundesweit bei Bier, Wein und Erfrischungsgetränken unter 72 Prozent (bei pasteurisierter Konsummilch unter 17 Prozent), so greifen als angedrohte Sanktionen generelle Pfandpflichten von 50 Pfennig für alle Einweggetränkeverpackungen. Die Mehrwegquote wird jährlich vom Bundesumweltministerium überprüft und im Bundesanzeiger bekannt gegeben.
3. Konzeptionelle Grundlage der Verpackungsordnung im Jahr 1991 waren bestimmte
Prämissen des Gesetzgebers wie der generelle ökologische Vorteil von Mehrwegsystemen über Einwegsystemen, so dass unabhängig von technologischen Produktionsfortschritten, hohen Verwertungsraten, optimalem Recycling usw. der Marktanteil von Einweg sanktionsbewehrt auf maximal 28 Prozent fixiert wurde.4
3.1. Nach Erhebungen der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung (GVM) hat sich der Anteil von Mehrwegverpackungen bei Getränken seit 1991 prozentual wie folgt entwickelt5:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Damit ist die nach der Verpackungsverordnung vorgegebene Mehrwegquote von 72 Prozent (Spalte: alle Getränke) in 1997 und 1998 nicht erreicht worden. Insoweit droht bei unverän- derter Gesetzeslage ab der zweiten Hälfte des Jahres 2001 die Einführung einer Pfandpflicht für jene Getränkeverpackungen, deren Mehrweganteil die Werte von 1991 unterschreiten. Entscheidend dafür ist die überprüfte und festgestellte Mehrwegquote des Jahres 1999, die Ende des Jahres vorliegen soll. Nach den Erhebungen von 1998 würde dies derzeit insbeson- dere für die Bereiche Bier, Mineralwasser und Wein gelten. Legt man hingegen die absoluten Zahlen zugrunde, stieg im Vergleichszeitraum das Mehrwegvolumen um ca. 3 Mrd. Liter an und der Verpackungsverbrauch sank insgesamt von 7,6 Mio. Tonnen (1991) auf 6,3 Mio.
Tonnen im Jahr 1997.6 Durch die Fortschritte bei der Verminderung der Verpackungsgewich- te und durch das Recycling ist der Abfall aus Einwegverpackungen für Getränke in den let- zen 25 Jahren von 12,5 kg pro Bürger / Jahr 1970 auf 6,4 Kg 1995 gesunken und durch die verstärkte Wertstoffsammlung um 55 % vermindert worden7. Demgegenüber ist die durch weggeworfene Mehrwegflaschen verursachte Abfallmenge mit ca. 320.000 Tonnen um knapp 50 % größer als der gesamte Abfall aus Einweg-Getränkeverpackungen.
3.2. Im politischen Raum, in der Wirtschaft und in den Verbänden hat die sinkende Mehrwegquote und die damit drohende Einführung eines Pflichtpfandes auf Einwegsysteme zu heftigen Kontroversen geführt. Nach einem Beschluss der Umweltministerkonferenz am 25.10.2000 in Berlin soll künftig ein Zwangs- pfand sogar auf alle Einweggetränkeverpackungen aus Glas, Kunststoff und Metall, unabhängig von Quoten, Füllmengen und Getränkeart, erhoben wer- den. Während SPD, GRÜNE und einige Umweltverbände grundsätzlich Sym- pathie für die Sanktion hegen, raten CDU, F.D.P., der Bundesverband der deutschen Industrie sowie die Handelsverbände davon strikt ab8.
3.2.1. Zu verweisen ist zunächst auf die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser neuen Sanktion. Sie löst für die Errichtung der notwendigen Rücknahme- systeme nach Schätzungen des Handels einen Investitionsbedarf von ca. 4 Mrd. DM aus. Die Verbraucher müssen an der Kasse das Pfand bezahlen, die Kosten der Rücknahme über höhere Getränkepreise finanzieren sowie mehr Aufwand für die Entsorgung leisten. Auch wird das Duale System er- heblich unterlaufen, Lizenzerhöhungen werden die Folge sein und das bis- her vorgehaltene flächendeckende Glascontainernetz ist wohl nicht mehr aufrecht zu erhalten.
3.2.2. Auch aus einem relativ neuen Instrument des Umweltmanagements, den sog. „Ökobilanzen“, ergeben sich keine eindeutigen Öko-Sieger zwischen der „Schönen“ (Mehrweg) und dem „Biest“ (Einweg). Vielmehr lassen sich gerade aus neueren Studien keine Rechtfertigung für die bislang normierten Maßnahmen zur Bevorzugung einer Verpackungsart ableiten.9 Dabei wird besonders deutlich, dass der Ressourcenverbrauch beim Mehrwegsystem mit steigender Distributionsentfernung wächst. Zudem liegen die analysier- ten Verpackungssysteme in fast allen Wirkungskategorien sehr dicht bei- einander. Die Differenzen sind durchweg marginal und nicht signifikant
(aktuell: Glas-Mehrweg / Getränkekarton; bereits 1995: Frischmilch- Schlauchbeutel)10. Die Verringerung der Mehrwegquote um 1 % hätte in der Ökobilanz beim Abfallaufkommen etwa die gleiche Relevanz wie die Einsparung einer Tüte Zucker pro Jahr und Kopf oder bei der Energieein- sparung, wenn der Verbraucher pro Jahr ca. 4 km weniger Auto fahren würde.11 Es drängt sich deshalb der Eindruck auf, dass viele ideologische Befürworter einer schnellen Umsetzung der Zwangspfandregeln „eher Flö- he rasieren wollen“12 als nachhaltige Entwicklungen im Umweltbereich anstreben wollen.
3.2.3. Auch das oft vorgebrachte Argument, ein Zwangspfand werde die „wilde Vermüllung der Landschaft durch weggeworfene Dosen schlagartig been- den“ (so Bundesumweltminister Jürgen Trittin), ist auf dem Hintergrund einer bundesweiten empirischen Studie des Rheinisch-Westfälischen Tech- nischen Überwachungsvereins im Auftrag der Bonner Arbeitsgemeinschaft Verpackung und Umwelt stark zu relativieren. Danach machen Verpa- ckungsabfälle nur weniger als die Hälfte des optisch wahrnehmbaren Ge- samtmülls aus. Spitzenreiter des „Litterings“ (Fachbegriff für das achtlose Wegwerfen von Abfällen ins Gebüsch) sind Plastikfolien (24 %), gefolgt von Kartons und Zigarettenschachteln (17 %) sowie von Kunststoffverpackungen wie Joghurt-Becher. Die „Symbol-Dose“ rangiert mit gut 7 % erst an vierter Stelle. Aus diesem Grund halten die Forscher auch nichts von einem Pfand auf Getränkedosen13.
3.3. Problematisch ist die geplante Pfandpflicht auch im Hinblick auf die Verein- barkeit mit EG-Recht. Bislang sieht die EU-Kommission bereits in der bestehenden 72 %-Quote ein unzulässiges Handelshemmnis und hat bereits ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesregierung eingeleitet. Nunmehr will die EU-Kommission zunächst vor Einleitung weiterer Schritte eine etwaige Novelle der Verpackungsverordnung abwarten14.
3.4. Ökologisch wenig nachvollziehbar und geradezu willkürlich ist auch die ge- setzliche Konsequenz der Verpackungsverordnung, ab Sommer 2001 etwa Pfand für Bier-, aber nicht für Bierdosen einführen zu müssen. Oder für Einweg-Weinflaschen, aber nicht für Schnapsbehälter.
4. Unbestritten ist weithin, dass die erreichte Verbesserung und Optimierung der Einwegver- packungen, die sehr beachtlichen Erfolge des Dualen Systems in punkto „Stofflicher Verwer- tung / Recycling“ und die Europarekorde der Verbraucher sowohl in der Benutzung von Mehrwegverpackungen als auch bei der getrennten Erfassung sowie Entsorgung von Einweg allesamt vorbildliche Eckpfeiler einer funktionierenden Abfall-Kreislaufwirtschaft darstellen. Eine zukunftsfähige Verpackungspolitik sollte folglich auf dirigistische staatliche Eingriffe wie den Zwangspfand und starre Mehrwegquoten verzichten und in Kooperation mit allen Akteuren neue Wege gehen.
[...]
1 BGBl. I S.2705
2 94/62/EG;Abl.L 365/10 v.31.12.1994
3 BGBl. I S.2379, zuletzt geändert durch VO v. 28.8.2000, BGBl I S.1344
4 vgl. hierzu etwa BDI / Abteilung Umweltpolitik: Sieben Argumente zur Diskussion um die Verpackungspolitik im Getränkebereich vom 31.3.2000, S. 7
5 GVM 11/1999; FKN Report, 11. Jahrgang, Ausgabe 1/2000
6 Deutsche Bank Research: “Branchenentwicklung“ -Internet: http://www.deutsche-bank.de
7 FKN Report 2/97, S.2
8 NW Landtag intern 19 v. 14.11.2000,S. 2; Handelsjournal Nr.11 v. 11.11.2000,S.3;
9 Umweltbundesamt-Hintergrundpapier, August 2000: „Ökobilanz Getränkeverpackungen für alkoholfreie Getränke und Wein“
10 Interview mit Prof. Paul W. Gilgen, Leiter der Abteilung Ökologie am EMPA-Institut St. Gallen (FKN-Report 1/1999)
11 „Ökobilanzen“,S.3 in: www.getraenkekarton.de/oekobilanz.htm; BDI, a.a.O. ,S. 4
12 Gilgen, a.a.O.
13 Tim Bartels, Online-Archiv der Berliner Zeitung v. 14.7.1999: “Achtlos ins Gebüsch geworfen“
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text "Zwangspfand auf Einwegsysteme - Meilenstein oder Störfaktor in der Abfall - Kreis- laufwirtschaft?"?
Der Text behandelt die Thematik der Einführung eines Zwangspfandes auf Einweg-Getränkeverpackungen in Deutschland und analysiert, ob diese Maßnahme mit den Grundsätzen einer sachgerechten Abfall-Kreislaufwirtschaft vereinbar ist. Dabei werden ökonomische, ökologische und soziale Folgen des Zwangspfandes betrachtet.
Was sind die Hauptziele der deutschen und europäischen Abfallgesetzgebung?
Die Ziele sind Abfallvermeidung, die getrennte Sammlung und stoffliche Verwertung von Abfällen sowie die umweltverträgliche Ablagerung von nicht weiter behandelbaren Abfällen. Dabei wird auf die Eigenverantwortlichkeit von Produzenten und Konsumenten gesetzt, insbesondere im Bereich der Verkaufsverpackungen.
Was ist das "Duale System Deutschland" (DSD) und wie funktioniert es?
Das DSD ist ein von Herstellern und Händlern gemeinsam eingerichtetes Entsorgungssystem für Verkaufsverpackungen. Es organisiert die haushaltsnahe Sammlung (gelbe Säcke/Tonnen), Sortierung und stoffliche Verwertung von Verpackungen. Die Kosten werden über Lizenzen finanziert.
Was besagt das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz vom 7. Oktober 1996?
Dieses Gesetz zielt auf die Abfallverringerung bzw. umweltgerechte Verwertung oder Beseitigung durch konsequente Anwendung des Verursacherprinzips und Ausweitung des Prinzips der Kreislaufwirtschaft.
Welche Ziele verfolgt die Europäische Verpackungsrichtlinie vom 20. Dezember 1994?
Die Richtlinie zielt auf die Harmonisierung der Rechtslage in den EU-Mitgliedstaaten und die Erhöhung der Verwertungsquoten der Verpackungsabfälle. Nationale Regelungen dürfen jedoch den freien Warenverkehr innerhalb der Gemeinschaft nicht behindern.
Was beinhaltet die Novelle der Verpackungsverordnung vom 28. August 1998?
Die Novelle verpflichtet zur stofflichen Wiederverwertung nicht nur von Transportverpackungen, sondern auch aller Verkaufsverpackungen. Durch strenge Rücknahmeverpflichtungen sollen Wiederverwertungsquoten erhöht und das Ziel der Abfallvermeidung vorangetrieben werden.
Welche Sanktionen drohen, wenn die Mehrwegquote unterschritten wird?
Wenn der Mehrweganteil bei Bier, Wein und Erfrischungsgetränken bundesweit unter 72 Prozent fällt, droht eine generelle Pfandpflicht von 50 Pfennig für alle Einweggetränkeverpackungen.
Wie hat sich der Anteil von Mehrwegverpackungen bei Getränken seit 1991 entwickelt?
Der Text enthält eine Tabelle (in der Leseprobe nicht enthalten), die die prozentuale Entwicklung des Mehrweganteils bei Getränken seit 1991 darstellt. Generell ist die Mehrwegquote gesunken, wodurch die Einführung der Pfandpflicht droht.
Welche Kritikpunkte gibt es an der geplanten Pfandpflicht auf Einwegsysteme?
Kritikpunkte sind u.a. die hohen Investitionskosten für die Errichtung der Rücknahmesysteme, die Belastung der Verbraucher durch Pfand und höhere Getränkepreise, die Unterlaufung des Dualen Systems sowie Zweifel an der ökologischen Sinnhaftigkeit.
Was sagen Ökobilanzen zum Vergleich von Mehrweg- und Einwegsystemen?
Ökobilanzen zeigen keine eindeutigen ökologischen Vorteile von Mehrwegsystemen gegenüber Einwegsystemen. Der Ressourcenverbrauch beim Mehrwegsystem kann mit steigender Distributionsentfernung sogar wachsen. Die Unterschiede in den analysierten Wirkungskategorien sind oft marginal.
Wie wird die "wilde Vermüllung der Landschaft" durch Verpackungsabfälle eingeschätzt?
Eine Studie des Rheinisch-Westfälischen Technischen Überwachungsvereins zeigt, dass Verpackungsabfälle nur weniger als die Hälfte des optisch wahrnehmbaren Gesamtmülls ausmachen. Plastikfolien und Kartons/Zigarettenschachteln sind häufiger anzutreffen als Getränkedosen.
Ist die geplante Pfandpflicht mit EG-Recht vereinbar?
Die EU-Kommission sieht bereits in der bestehenden 72 %-Quote ein unzulässiges Handelshemmnis und hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesregierung eingeleitet.
Welche Beispiele für ökologisch wenig nachvollziehbare Konsequenzen der Verpackungsverordnung werden genannt?
Es wird kritisiert, dass ab Sommer 2001 Pfand für Bier-, aber nicht für Bierdosen eingeführt werden soll. Oder für Einweg-Weinflaschen, aber nicht für Schnapsbehälter.
Welches Fazit wird im Hinblick auf eine zukunftsfähige Verpackungspolitik gezogen?
Eine zukunftsfähige Verpackungspolitik sollte auf dirigistische staatliche Eingriffe wie den Zwangspfand und starre Mehrwegquoten verzichten und in Kooperation mit allen Akteuren neue Wege gehen.
- Quote paper
- Werner Stolz (Author), 2001, Zwangspfand auf Einwegsysteme, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100597