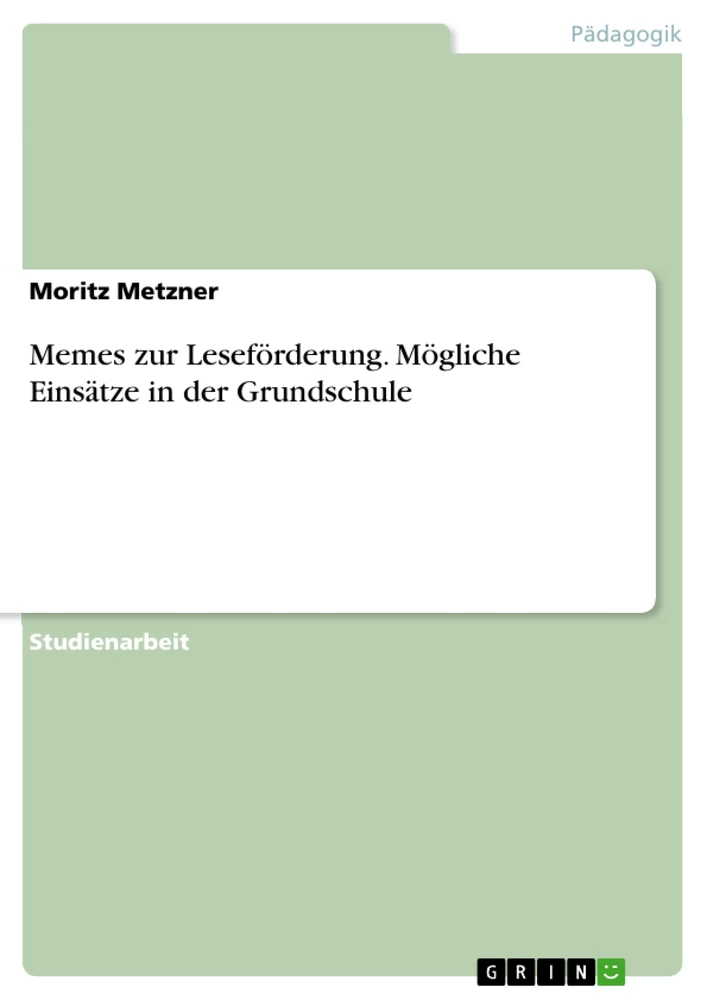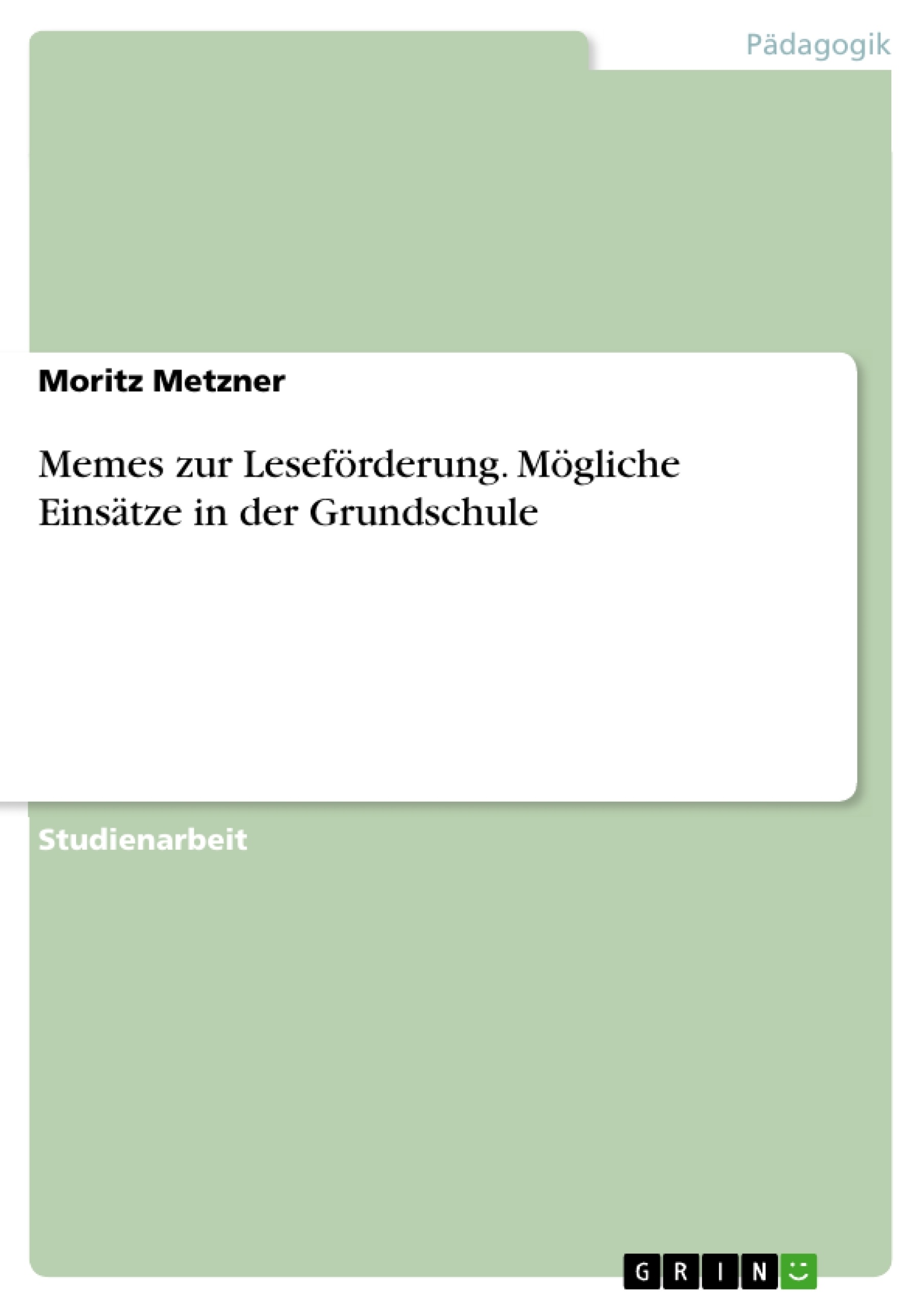In dieser Arbeit wird das Thema behandelt, wie Memes in der Leseförderung eingebaut werden können. Memes nehmen vor allem bei der jetzigen Generation einen großen Stellenwert in ihrem Leben ein, weshalb der Einbezug in die schulische Leseförderung lohnenswert ist. Die Arbeit bietet einen Überblick über Memes und deren Aufbau, sowie Möglichkeiten beim Einbau in den Unterricht.
Es soll überprüft werden, ob sich Memes als Leseförderung einsetzen lassen. Dafür werden in Kapitel 2 Memes aus theoretischer Sicht betrachtet. Es wird vom Autor exemplarisch ein eigenes Meme erstellt, um die Bedeutung eines Memes besser zu verstehen. In Kapitel 3 geht es um die Lesekompetenz. Dabei wird sich auf die Definition von Rosebrock und auf die der PISA Studie bezogen. Kapitel 4 beschäftigt sich mit Faktoren, die als Leseförderung positiv eingesetzt werden können. In Kapitel 5 geht es letztendlich um die Frage, ob Memes als Leseförderung eingesetzt werden können. Dabei wird ein eigens erstelltes Meme nach den vorherigen Kapiteln auf positive wie negative Faktoren für die Leseförderung analysiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Memes
- 2.1 Biologische Meme Definition
- 2.2 Internetphänomen Mem
- 2.3 Bild Makros
- 3 Lesen
- 3.1 Lesekompetenz nach Rosebrock
- 3.2 Lesekompetenz nach PISA
- 4 Leseförderung
- 5 Verbindung von Memes und Leseförderung
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Eignung von Memes als Instrument der Leseförderung. Die Arbeit analysiert den Zusammenhang zwischen dem Phänomen Internet-Meme, Lesekompetenz und deren Förderung im Kontext der PISA-Studien. Ziel ist es, die Potenziale und Herausforderungen des Einsatzes von Memes zur Verbesserung der Lesekompetenz von Schülern zu beleuchten.
- Definition und theoretische Einordnung von Memes
- Analyse der Lesekompetenz im Hinblick auf die PISA-Studien
- Faktoren, die die Leseförderung positiv beeinflussen
- Potenzial von Memes als Mittel zur Leseförderung
- Analyse eines selbst erstellten Memes im Hinblick auf seine Eignung als Förderinstrument
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und führt in die Problematik der Lesekompetenz in Deutschland ein, unter Bezugnahme auf die Ergebnisse der PISA-Studien. Der schlechte Abschneiden Deutschlands in den PISA-Studien bezüglich Lesekompetenz wird als Ausgangspunkt für die Untersuchung der Möglichkeiten zur Leseförderung genannt. Die Arbeit stellt die Forschungsfrage, ob Memes als humorvoller und lebensweltbezogener Ansatz zur Verbesserung der Lesekompetenz dienen können. Die Struktur der Arbeit und die einzelnen Kapitel werden kurz vorgestellt.
2 Memes: Dieses Kapitel erörtert den Begriff "Meme" aus theoretischer Perspektive. Es beginnt mit der Definition des biologischen Memes nach Dawkins, verbindet dies mit dem Konzept der kulturellen Weitergabe und Nachahmung. Der Begriff des "Memes" als Internetphänomen wird eingeführt und anhand von Beispielen (Bildmakros) erläutert. Die Analyse des "How i look when"-Memes dient als Beispiel, um die Struktur und Wirkungsweise von Memes zu veranschaulichen und ihren Aufbau zu verdeutlichen. Das Kapitel legt die Grundlage für die spätere Diskussion über die Anwendung von Memes in der Leseförderung.
3 Lesen: In diesem Kapitel wird der Begriff der Lesekompetenz aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Die Definitionen von Rosebrock und die der PISA-Studie werden verglichen und kontrastiert. Es werden die verschiedenen Aspekte der Lesekompetenz erörtert, die für die spätere Analyse des Potenzials von Memes als Förderinstrument relevant sind. Die verschiedenen Facetten der Lesekompetenz werden hier detailliert beschrieben und die Messmethoden der PISA-Studie kurz erläutert.
4 Leseförderung: Kapitel 4 befasst sich mit Faktoren, die eine effektive Leseförderung unterstützen. Hier werden verschiedene Methoden und Ansätze zur Förderung der Lesekompetenz vorgestellt und diskutiert. Die Bedeutung von Motivation, Spaß am Lesen und der Einbindung der Lebenswelt der Schüler wird hervorgehoben. Dieses Kapitel dient dazu, einen Rahmen für die spätere Bewertung des Potenzials von Memes als Förderinstrument zu schaffen. Es werden verschiedene erfolgreiche Strategien und Methoden der Leseförderung erläutert.
5 Verbindung von Memes und Leseförderung: Das zentrale Kapitel 5 untersucht die Frage, ob Memes als Mittel der Leseförderung eingesetzt werden können. Hier wird ein selbst erstelltes Meme anhand der vorherigen Kapitel analysiert, um positive und negative Faktoren für die Leseförderung zu identifizieren und zu bewerten. Die Analyse des selbst erstellten Memes dient als Fallstudie, um die praktische Anwendbarkeit des Konzepts zu demonstrieren. Die Kapitel analysieren den Einsatz von Memes im Unterricht kritisch und realistisch.
Schlüsselwörter
Memes, Leseförderung, Lesekompetenz, PISA-Studie, Internetphänomen, Bildmakros, digitale Medien, humoristische Lernmethoden, Schülermotivation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Memes und Leseförderung
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit untersucht die Eignung von Internet-Memes als Instrument zur Leseförderung. Sie analysiert den Zusammenhang zwischen Memes, Lesekompetenz und deren Förderung im Kontext der PISA-Studien. Das Hauptziel ist die Beleuchtung der Potenziale und Herausforderungen beim Einsatz von Memes zur Verbesserung der Lesekompetenz von Schülern.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und theoretische Einordnung von Memes (inklusive biologischer Meme und Internet-Memes), die Analyse der Lesekompetenz basierend auf den PISA-Studien, Faktoren, die die Leseförderung positiv beeinflussen, das Potenzial von Memes als Fördermittel und eine Fallstudie mit einem selbst erstellten Meme.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zu Memes (inkl. Definition und Beispielen wie Bildmakros), ein Kapitel zum Thema Lesen (mit Fokus auf Lesekompetenz nach Rosebrock und PISA), ein Kapitel zur Leseförderung, ein zentrales Kapitel zur Verbindung von Memes und Leseförderung (mit Analyse eines selbst erstellten Memes) und ein Fazit.
Was wird im Kapitel über Memes erläutert?
Das Kapitel über Memes beginnt mit der Definition des biologischen Memes nach Dawkins, erweitert dies auf kulturelle Weitergabe und Nachahmung und führt den Begriff des Internet-Memes ein. Es werden Beispiele wie Bildmakros analysiert, um Struktur und Wirkungsweise von Memes zu veranschaulichen.
Wie wird Lesekompetenz in der Hausarbeit definiert?
Die Hausarbeit beleuchtet Lesekompetenz aus verschiedenen Perspektiven, indem sie die Definitionen von Rosebrock und die der PISA-Studie vergleicht und kontrastiert. Die verschiedenen Aspekte der Lesekompetenz, relevant für die Analyse des Potenzials von Memes, werden detailliert beschrieben.
Welche Faktoren der Leseförderung werden betrachtet?
Kapitel 4 befasst sich mit Faktoren, die effektive Leseförderung unterstützen, wie Motivation, Spaß am Lesen und die Einbindung der Lebenswelt der Schüler. Verschiedene Methoden und Ansätze zur Leseförderung werden vorgestellt und diskutiert.
Wie wird das Potenzial von Memes für die Leseförderung untersucht?
Das zentrale Kapitel 5 analysiert ein selbst erstelltes Meme, um positive und negative Faktoren für die Leseförderung zu identifizieren. Diese Fallstudie dient dazu, die praktische Anwendbarkeit von Memes als Förderinstrument zu demonstrieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Memes, Leseförderung, Lesekompetenz, PISA-Studie, Internetphänomen, Bildmakros, digitale Medien, humoristische Lernmethoden, Schülermotivation.
Welche Forschungsfrage wird in der Arbeit behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage ist, ob Memes als humorvoller und lebensweltbezogener Ansatz zur Verbesserung der Lesekompetenz dienen können.
Wo finde ich die Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Die Zusammenfassung der einzelnen Kapitel (Einleitung, Memes, Lesen, Leseförderung, Verbindung von Memes und Leseförderung) ist im Abschnitt "Zusammenfassung der Kapitel" der Hausarbeit enthalten.
- Quote paper
- Moritz Metzner (Author), 2020, Memes zur Leseförderung. Mögliche Einsätze in der Grundschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1006044