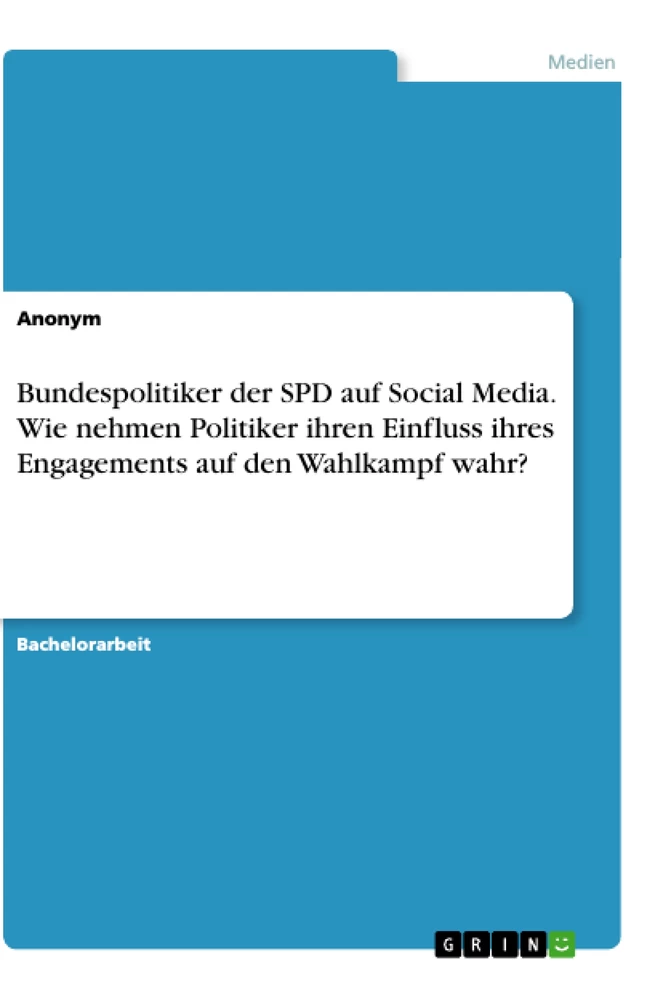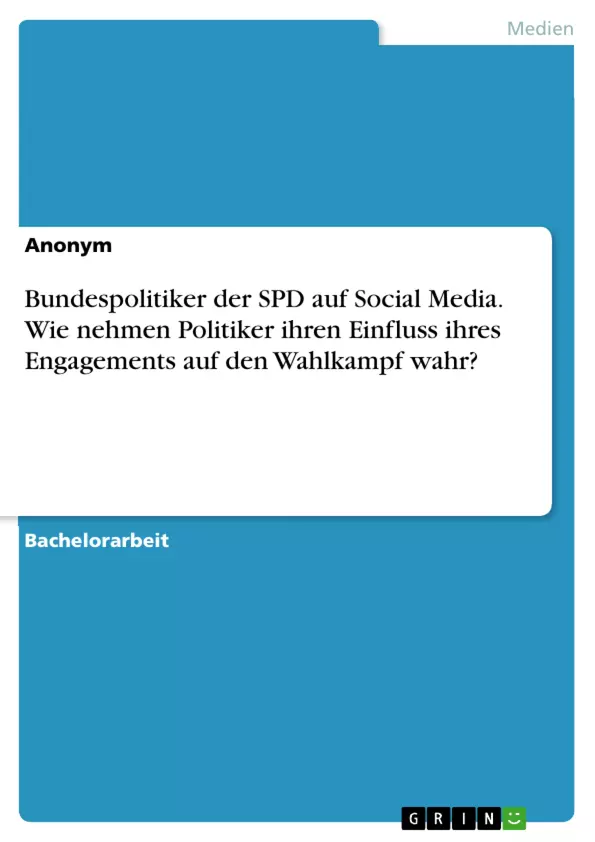Diese Arbeit befasst sich mit der Selbstdarstellung von Bundespolitikern/-innen im Bereich der sozialen Netzwerke. Ergänzend dazu wird auch die Selbstwahrnehmung der Politiker/-innen auf den Wahlkampf durch eigenes social Media Engagement beleuchtet, um so ein möglichst vollständiges Bild zu gewinnen.
Dabei wurden in Form von Interviews die Daten erhoben und anschließend nach der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse von Philipp Mayring ausgewertet. All das unter der besonderen Berücksichtigung der Theorie des kommunikativen Handelns für das soziale Leben der modernen Gesellschaft nach Jürgen Habermas.
So unterliegt die folgende Arbeit einer qualitativ- empirischen Forschung. Es wurde eine individuell- subjektive Wahrnehmung der befragten Personen erfasst und so eine innerparteiliche Sicht auf die Thematik ermittelt, die repräsentative Ergebnisse für Forschung und Wissenschaft erzielt hat. Dies zeigt das die politische Kommunikation im ständigen Wandel steht.
Dass die Digitalisierung und die Sozialen Medien die politische Kommunikation und die daraus resultierenden Strukturen des Wahlkampfes zunehmend prägen und verändern, ist unabdingbar.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Forschungsstand
- 3 Theoretischer Hintergrund
- 3.1 Politikwissenschaftliche Kontextualisierung
- 3.2 Kontextualisierung Social Media in der Politik
- 3.3 Kontextualisierung Wahlkampf im Internet
- 3.4 Theorie des Kommunikativen Handelns nach Jürgen Habermas
- 4 Methoden und Forschungsvorgehen
- 5 Auswertung
- 5.1 Darstellung der Ergebnisse
- 5.2 Interpretation der Ergebnisse
- 5.3 Diskussion der Ergebnisse im theoretischen Bezugsrahmen
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Selbstdarstellung von Bundestagsabgeordneten der SPD in sozialen Medien und deren Wahrnehmung des Einflusses dieser Aktivitäten auf den Wahlkampf. Die Arbeit verfolgt das Ziel, ein innerparteiliches Bild der Social-Media-Strategien und -Wahrnehmungen zu gewinnen und diese mit theoretischen Ansätzen, insbesondere der Theorie des kommunikativen Handelns nach Jürgen Habermas, abzugleichen.
- Selbstdarstellung von SPD-Bundestagsabgeordneten in sozialen Medien
- Wahrnehmung des Einflusses von Social Media auf den Wahlkampf
- Vergleich der Selbstwahrnehmung mit theoretischen Modellen
- Innerparteiliche Strategien und Meinungen zum Thema Social Media im Wahlkampf
- Analyse der Kommunikation im Kontext der Digitalisierung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung skizziert die zunehmende Bedeutung sozialer Medien in der politischen Kommunikation und im Wahlkampf, ausgehend vom Beispiel Barack Obamas erfolgreicher Social-Media-Kampagne 2008. Sie stellt die Forschungsfrage nach der Wahrnehmung des Einflusses von Social-Media-Engagement auf den Wahlkampf durch SPD-Bundespolitiker und die Relevanz des Themas im Kontext der aktuellen politischen Lage und des Einflusses von Online-Influencern heraus.
2 Forschungsstand: Dieses Kapitel beleuchtet den aktuellen Forschungsstand zu Social Media und Online-Wahlkampf, zeigt die Lücke in der Forschung zu der spezifischen Fragestellung auf und benennt relevante Studien und Theorien. Es wird herausgestellt, dass die subjektive Wahrnehmung und Selbstdarstellung von SPD-Politikern im Kontext des Social-Media-Engagements bislang kaum empirisch erforscht wurde.
3 Theoretischer Hintergrund: Der theoretische Hintergrund liefert den politikwissenschaftlichen und kommunikationswissenschaftlichen Kontext. Er erläutert die Funktionsweise des Deutschen Bundestages und der Parteien, die Rolle der SPD als Volkspartei und die Bedeutung von Kommunikation für den politischen Erfolg. Es folgt eine Kontextualisierung von Social Media in der Politik, einschließlich relevanter Modelle und Definitionen, die Nutzung des Internets im Wahlkampf und schließlich eine detaillierte Darstellung der Theorie des kommunikativen Handelns nach Jürgen Habermas, die als Grundlage für die Datenanalyse dient.
4 Methoden und Forschungsvorgehen: Dieses Kapitel beschreibt die qualitative Forschungsmethode, die qualitative Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring, und das Vorgehen. Es werden die Gütekriterien qualitativer Forschung erläutert und die Auswahl der Interviewpartner (vier Bundestagsabgeordnete der SPD) begründet. Der Ablauf der Datenerhebung (leitfadengestützte Interviews) und -auswertung wird detailliert dargestellt.
5 Auswertung: Die Auswertung präsentiert die Ergebnisse der Interviews, gegliedert in Kategorien. Die Interviewpartner werden kurz vorgestellt, und deren Aussagen zu verschiedenen Aspekten des Themas werden kategorisiert und dargestellt. Die Interpretation der Ergebnisse erfolgt unter Bezugnahme auf die Theorie des kommunikativen Handelns und weitere relevante Theorien.
Schlüsselwörter
SPD, Social Media, Wahlkampf, Online-Kommunikation, Politische Kommunikation, Qualitative Inhaltsanalyse, Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, Selbstdarstellung, Selbstwahrnehmung, qualitative Forschung, Experteninterviews.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Selbstdarstellung von SPD-Bundestagsabgeordneten in sozialen Medien
Was ist das Thema der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Selbstdarstellung von Bundestagsabgeordneten der SPD in sozialen Medien und deren Wahrnehmung des Einflusses dieser Aktivitäten auf den Wahlkampf. Es geht darum, ein innerparteiliches Bild der Social-Media-Strategien und -Wahrnehmungen zu gewinnen und diese mit theoretischen Ansätzen, insbesondere der Theorie des kommunikativen Handelns nach Jürgen Habermas, abzugleichen.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die subjektive Wahrnehmung und Selbstdarstellung von SPD-Politikern im Kontext ihres Social-Media-Engagements. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Einfluss von Social Media auf den Wahlkampf aus der Perspektive der befragten Abgeordneten. Die Arbeit analysiert auch innerparteiliche Strategien und Meinungen zum Thema Social Media im Wahlkampf.
Welche Methode wurde angewendet?
Es wurde eine qualitative Forschungsmethode verwendet, genauer eine qualitative Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring. Die Daten wurden durch leitfadengestützte Interviews mit vier Bundestagsabgeordneten der SPD erhoben.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf politikwissenschaftliche und kommunikationswissenschaftliche Theorien. Ein zentraler Bezugspunkt ist die Theorie des kommunikativen Handelns nach Jürgen Habermas, die als Grundlage für die Datenanalyse dient. Die Arbeit berücksichtigt auch die Rolle der SPD als Volkspartei und die Bedeutung von Kommunikation für den politischen Erfolg.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Auswertung präsentiert die Ergebnisse der Interviews, gegliedert in Kategorien. Die Aussagen der Interviewpartner zu verschiedenen Aspekten des Themas werden kategorisiert und dargestellt und im Kontext der Theorie des kommunikativen Handelns interpretiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Forschungsstand, Theoretischer Hintergrund, Methoden und Forschungsvorgehen, Auswertung und Fazit. Der theoretische Hintergrund beinhaltet u.a. die Kontextualisierung von Social Media in der Politik und im Wahlkampf.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: SPD, Social Media, Wahlkampf, Online-Kommunikation, Politische Kommunikation, Qualitative Inhaltsanalyse, Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, Selbstdarstellung, Selbstwahrnehmung, qualitative Forschung, Experteninterviews.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein innerparteiliches Bild der Social-Media-Strategien und -Wahrnehmungen von SPD-Bundestagsabgeordneten zu gewinnen und diese mit theoretischen Ansätzen abzugleichen. Es soll ein Verständnis dafür geschaffen werden, wie SPD-Politiker Social Media im Wahlkampf wahrnehmen und einsetzen.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2019, Bundespolitiker der SPD auf Social Media. Wie nehmen Politiker ihren Einfluss ihres Engagements auf den Wahlkampf wahr?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1006267