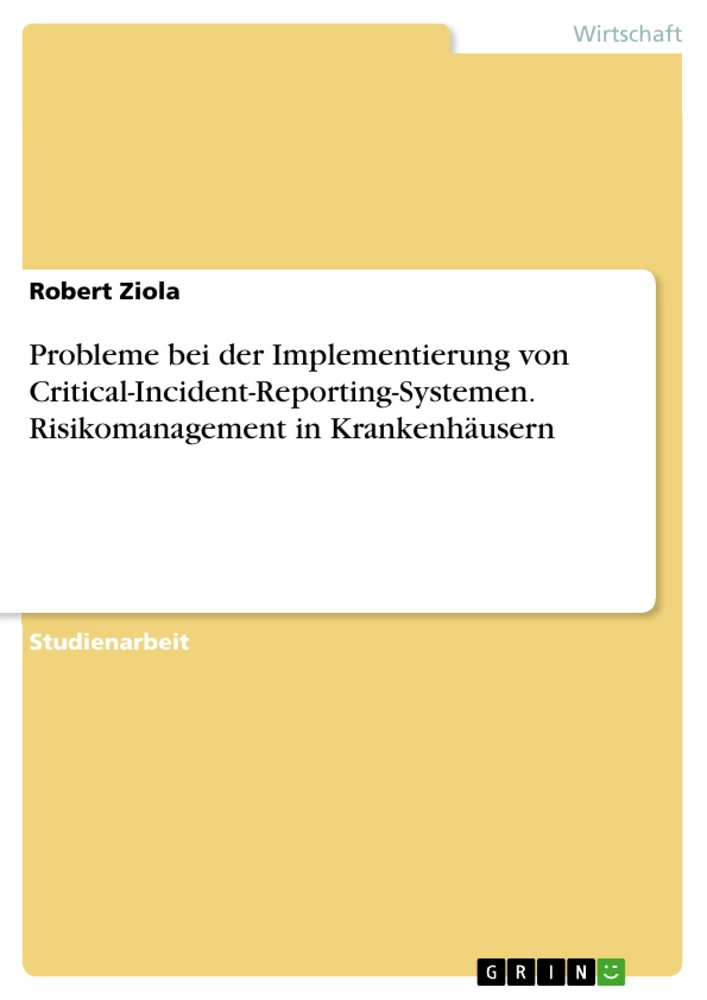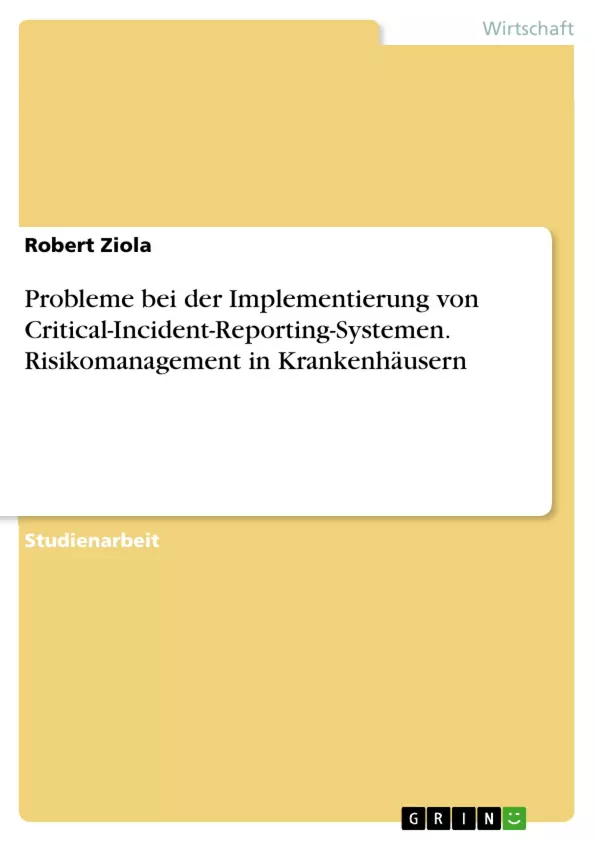Der Erfolg eines Critical-Incident-Reporting-System (CIRS) hängt fundamental von der Akzeptanz der Mitarbeiter ab. Nicht immer gelingt es, die Mitarbeiter während der Implementierungsphase vom System zu überzeugen. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Problemen und Widerständen, die bei der Einrichtung eines CIRS auftreten können.
Patientensicherheit spielt eine immer wichtigere Rolle. Zahlreiche Forscher beschäftigen sich mit der Reduzierung von vermeidbaren Behandlungsfehlern und dem damit verbundenen Risikomanagement. Ein in diesem Bereich viel diskutiertes Instrument stellt das CIRS als Fehlermeldesystem dar. Die Einrichtung eines CIRS ist nachweislich dazu geeignet, die Patientensicherheit zu erhöhen. Dennoch befindet sich die Forschung auf diesem Gebiet noch nicht am Ende. In der Literatur wird die Ansicht vertreten, dass CIRS oftmals nicht zu ihrem vollen Potential genutzt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Worte
- Einordnung von Critical-Incident-Reporting-Systemen (CIRS)
- Aufbau und Ziel der Arbeit
- Funktionsweise und Vorteile von CIRS
- Methodik
- Implementierungsprobleme
- Identifizierung
- Klassifizierung
- Akzeptanzprobleme
- Motivationale Probleme
- Formale Probleme
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit den Problemen bei der Implementierung von Critical-Incident-Reporting-Systemen (CIRS) in medizinischen Einrichtungen. Die Arbeit analysiert die Funktionsweise und Vorteile von CIRS und untersucht die Herausforderungen, die bei der Einführung dieser Systeme auftreten. Ziel ist es, die wichtigsten Aussagen der einschlägigen Literatur zusammenzuführen und für die Praxis übersichtlicher zu machen.
- Funktion und Vorteile von CIRS
- Hürden bei der Implementierung von CIRS
- Klassifizierung der Implementierungsprobleme
- Akzeptanz und Beteiligung von Mitarbeitern bei CIRS
- Zusammenführung der Ergebnisse aus der Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Critical-Incident-Reporting-Systeme (CIRS) ein und beleuchtet deren Bedeutung im Kontext des Risikomanagements in medizinischen Einrichtungen. Es werden die rechtlichen Vorgaben und die aktuelle Bedeutung des Themas Patientensicherheit in Deutschland aufgezeigt.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Funktionsweise von CIRS und beschreibt die Vorteile, die sich sowohl für die Patienten als auch für das behandelnde Personal ergeben.
Im dritten Kapitel wird die Methodik des Literature Reviews erläutert, welche für die Analyse der Implementierungsprobleme von CIRS verwendet wird.
Das vierte Kapitel befasst sich mit den Problemen, die bei der Implementierung von CIRS auftreten können. Es werden verschiedene Aspekte der Klassifizierung dieser Probleme diskutiert, darunter Akzeptanzprobleme, motivationale Probleme und formale Probleme.
Schlüsselwörter
Critical-Incident-Reporting-Systeme (CIRS), Patientensicherheit, Risikomanagement, Implementierungsprobleme, Akzeptanz, Motivation, formale Probleme, Fehlermeldung, Krankenhaus, Medizin, Literaturreview.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Critical-Incident-Reporting-System (CIRS)?
CIRS ist ein anonymes Fehlermeldesystem in medizinischen Einrichtungen, das dazu dient, Beinahe-Fehler zu erfassen und daraus zu lernen, um die Patientensicherheit zu erhöhen.
Was sind die größten Hürden bei der Implementierung von CIRS?
Die größten Probleme sind mangelnde Akzeptanz der Mitarbeiter, Angst vor Sanktionen (trotz Anonymität) und der zeitliche Aufwand für die Meldungen.
Wie kann die Motivation der Mitarbeiter gesteigert werden?
Durch eine offene Fehlerkultur, sichtbare Verbesserungen aufgrund von Meldungen und die Zusicherung absoluter Anonymität und Straffreiheit.
Welche formalen Probleme können bei CIRS auftreten?
Dazu gehören komplizierte Meldeformulare, unklare Verantwortlichkeiten bei der Auswertung oder technische Mängel in der Software.
Warum ist Patientensicherheit ein zentrales Thema im Risikomanagement?
Vermeidbare Behandlungsfehler verursachen nicht nur menschliches Leid, sondern auch hohe Kosten und rechtliche Risiken für Krankenhäuser.
- Quote paper
- Robert Ziola (Author), 2018, Probleme bei der Implementierung von Critical-Incident-Reporting-Systemen. Risikomanagement in Krankenhäusern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1006550