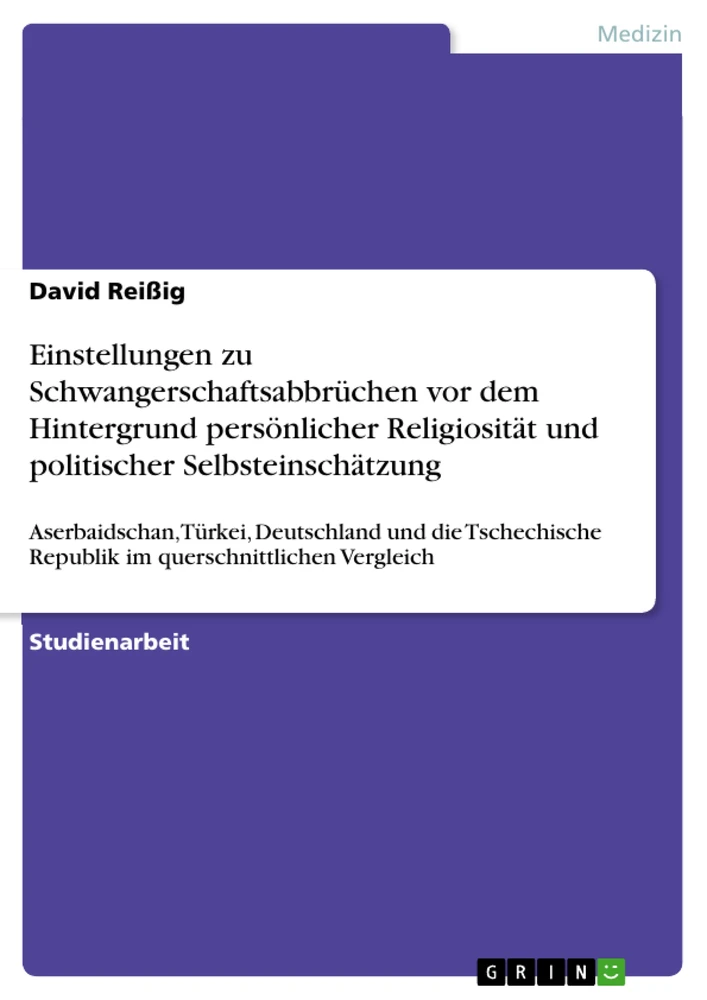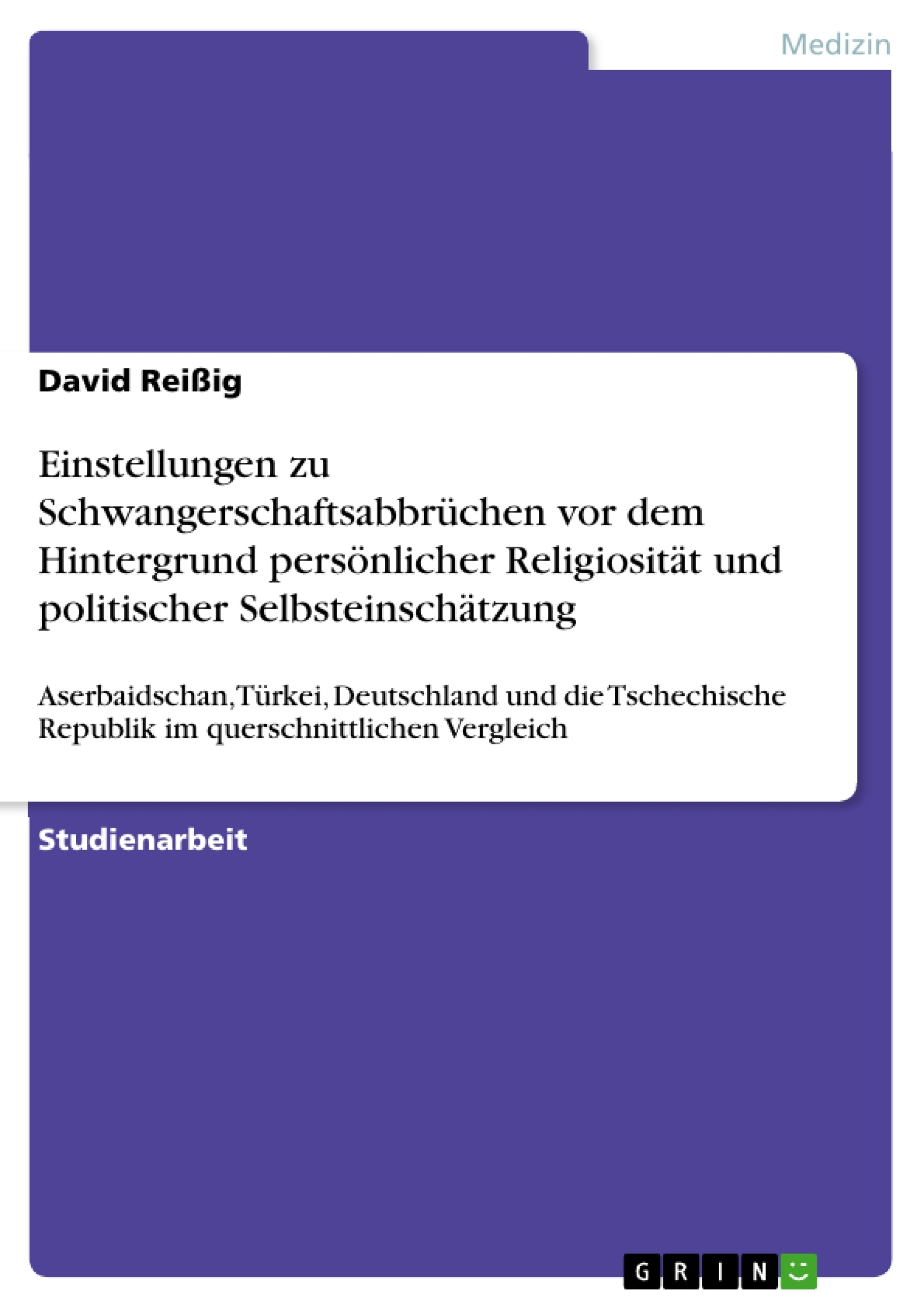Um sich der Thematik auf internationaler Ebene zu nähern, werden im Rahmen der folgenden Arbeit persönliche Einstellungen zu Schwangerschaftsabbrüchen sowie politische und religiöse Selbsteinschätzung betrachtet und im Ländervergleich analysiert. Politische und religiöse Rahmenbedingungen haben Einfluss auf Verfügbarkeit, Gründe und Akzeptanz von Schwangerschaftsabbrüchen. Dabei haben die jeweils vorherrschenden Gegebenheiten starke Effekte auf die Gesundheitsrisiken und -chancen betroffener Menschen. Ungewollte Schwangerschaften, als Grund für Schwangerschaftsabbrüche, stehen mit gesundheitlichen und sozialen Benachteiligungen für die betroffenen Frauen und deren Familien in Verbindung.
Der Schwangerschaftsabbruch, auch Interruptio oder umgangssprachlich Abtreibung genannt, ist ein komplexes soziales Phänomen, auf das viele gesellschaftliche Bereiche Einfluss nehmen. Die Häufigkeit und Vielfalt der Debatten sowie der daran beteiligten Akteure ist ein Indiz für die besondere Kontroversität des medizinischen Eingriffs. Damit berührt die Problematik, weit über medizintechnische Spezifikation und gesundheitliche Folgen hinaus, tiefgreifende Fragen zu Vorstellungen gesellschaftlichen Zusammenlebens, wenn es beispielsweise um Selbstbestimmungsrecht, oder den zeitlichen Startpunkt menschlichen Lebens im Kontext ethische Grundsatzdebatten geht.
Aktuell wird in Deutschland das Pro und Kontra der Abschaffung oder Veränderung des Paragraphs 219a des Strafgesetzbuches auf parlamentarischer und öffentlicher Ebene thematisiert und in diesem Kontext das Recht auf den Zugriff zu medizinischen Informationen, sowie Persönlichkeitsrechte von Frauen verhandelt. International betrachtet stellt Deutschland bezogen auf die Intensität des Diskurses keine Ausnahme dar. So führt in Irland ein aktuelles Referendum zum Thema zur rechtlichen Neubetrachtung von Schwangerschaftsabbrüchen. Auch Begriffspaare wie Pro-Life und Pro-Choice sind weit über ihren US-amerikanischen Ursprung hinaus geläufige Kategorien für die Positionierung im Diskurs und finden große populärkulturelle Beachtung. Öffentliche Meinungsunterschiede laufen dabei oft entlang politischer und religiöser Überzeugungen, da diese sowohl Einfluss auf, als auch Ausdruck von lebensweltlichen Vorstellungen sind und politische Diskurse sowie legislative Entscheidungen beeinflussen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Hintergrund und Forschungsstand im internationalen Kontext
- Einflussfaktoren auf Einstellungen zum Schwangerschaftsabbruch
- Religiosität in Bezug auf Einstellungen zum Schwangerschaftsabbruch
- Politische Einstellungen und Meinungen zum Schwangerschaftsabbruch
- Länderauswahl
- Methodisches Vorgehen
- Zum European Values Study 2008 Datensatz
- Beschreibung der Variablen
- Statistische Modellierung
- Ergebnisse
- Deskriptive Ergebnisdaten
- Induktive Ergebnisdaten
- Diskussion und Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, die Einstellungen zu Schwangerschaftsabbrüchen im internationalen Vergleich zu analysieren, wobei der Fokus auf den Einfluss persönlicher Religiosität und politischer Selbsteinschätzung liegt. Das Forschungsinteresse liegt in der Untersuchung der Beziehung zwischen diesen Einflussfaktoren und der Akzeptanz von Schwangerschaftsabbrüchen in verschiedenen Ländern.
- Der Einfluss von Religiosität auf Einstellungen zu Schwangerschaftsabbrüchen
- Der Einfluss von politischen Einstellungen auf Einstellungen zu Schwangerschaftsabbrüchen
- Die Rolle von Gesetzeslage und Rahmenbedingungen in Bezug auf Schwangerschaftsabbrüche
- Der Vergleich von Einstellungen zu Schwangerschaftsabbrüchen in verschiedenen Ländern
- Die Untersuchung der Beziehung zwischen persönlichen Einstellungen und öffentlicher Meinung zum Thema Schwangerschaftsabbruch
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Kapitel präsentiert den Schwangerschaftsabbruch als ein komplexes soziales Phänomen, das kontroverse gesellschaftliche Debatten auslöst. Es wird auf die Bedeutung des Themas im Kontext von Selbstbestimmungsrecht und ethischen Grundprinzipien hingewiesen. Die aktuelle Debatte in Deutschland um den Paragraf 219a des Strafgesetzbuches sowie die Situation in Irland, wo ein Referendum zur rechtlichen Neuregelung von Schwangerschaftsabbrüchen stattfindet, werden als Beispiele für die internationale Relevanz des Themas genannt. Die Arbeit untersucht den Einfluss von Religiosität und politischen Einstellungen auf Einstellungen zu Schwangerschaftsabbrüchen, wobei Aserbaidschan, Türkei, Deutschland und die Tschechische Republik im Vergleich stehen.
- Theoretischer Hintergrund und Forschungsstand im internationalen Kontext: Dieses Kapitel beleuchtet den Einfluss von Religiosität und politischen Einstellungen auf Einstellungen zu Schwangerschaftsabbrüchen. Es wird auf die Relevanz der jeweiligen Rahmenbedingungen für die Verfügbarkeit, Gründe und Akzeptanz von Schwangerschaftsabbrüchen hingewiesen, sowie auf die Folgen von restriktiven Gesetzgebungen für die Gesundheit der Betroffenen. Die Arbeit betont die Bedeutung von ungeplanten Schwangerschaften als Ursache für Schwangerschaftsabbrüche und deren Auswirkungen auf Frauen und Familien.
- Methodisches Vorgehen: Das Kapitel erläutert das methodische Vorgehen der Arbeit, welches auf dem European Values Study 2008 Datensatz basiert. Es wird die Auswahl der Variablen und die statistische Modellierung beschrieben, die zur Analyse der Daten genutzt werden.
- Ergebnisse: Dieses Kapitel stellt die deskriptiven und induktiven Ergebnisse der Analyse vor, ohne jedoch konkrete Zahlen oder detaillierte Schlussfolgerungen zu präsentieren.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch, wobei der Fokus auf den Einfluss von Religiosität und politischen Einstellungen auf die Akzeptanz von Schwangerschaftsabbrüchen liegt. Weitere wichtige Schlagwörter sind: Internationaler Vergleich, Einstellungen, öffentliche Meinung, Gesetzeslage, Gesundheitsrisiken, Selbstbestimmungsrecht, ethische Grundprinzipien.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst Religiosität die Einstellung zur Abtreibung?
Persönliche Religiosität gilt oft als starker Prädiktor für eine geringere Akzeptanz von Schwangerschaftsabbrüchen, was im Ländervergleich analysiert wird.
Was ist der Unterschied zwischen Pro-Life und Pro-Choice?
Es sind Kategorien zur Positionierung im Diskurs: Pro-Life betont den Schutz des ungeborenen Lebens, Pro-Choice das Selbstbestimmungsrecht der Frau.
Welche Rolle spielt die politische Selbsteinschätzung?
Politische Überzeugungen prägen oft die legislative Einstellung und die Akzeptanz von medizinischen Eingriffen wie der Interruptio.
Welche Länder werden in der Studie verglichen?
Die Analyse vergleicht Einstellungen in Aserbaidschan, der Türkei, Deutschland und der Tschechischen Republik.
Was wird am Paragraf 219a StGB in Deutschland kritisiert?
Thematisiert werden das Recht auf Zugang zu medizinischen Informationen und die Persönlichkeitsrechte von Frauen.
- Quote paper
- David Reißig (Author), 2019, Einstellungen zu Schwangerschaftsabbrüchen vor dem Hintergrund persönlicher Religiosität und politischer Selbsteinschätzung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1006593