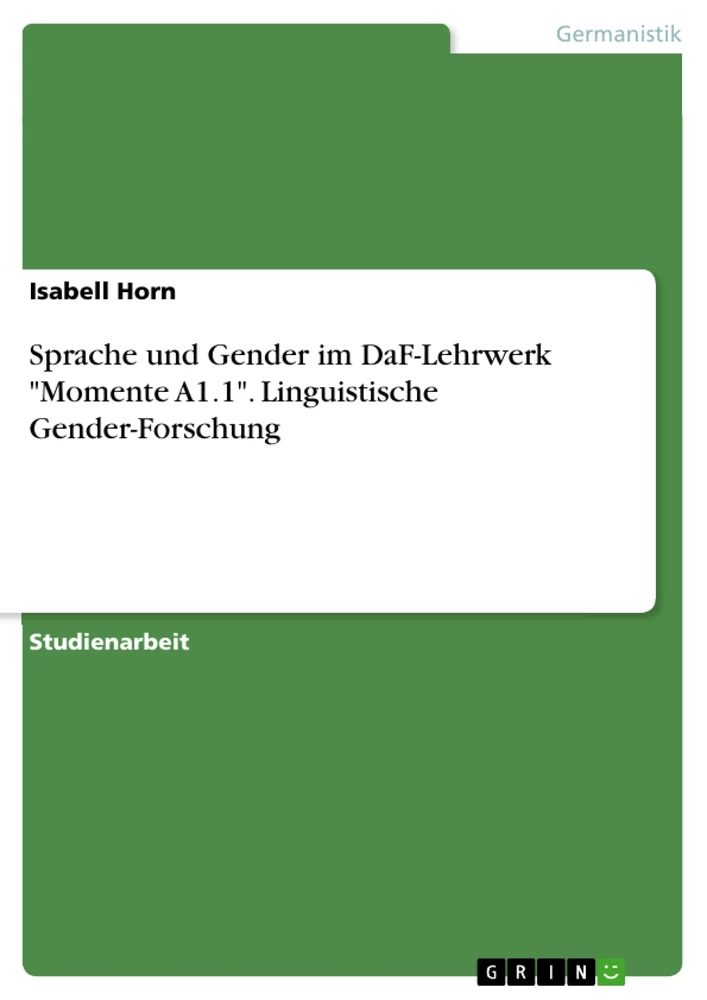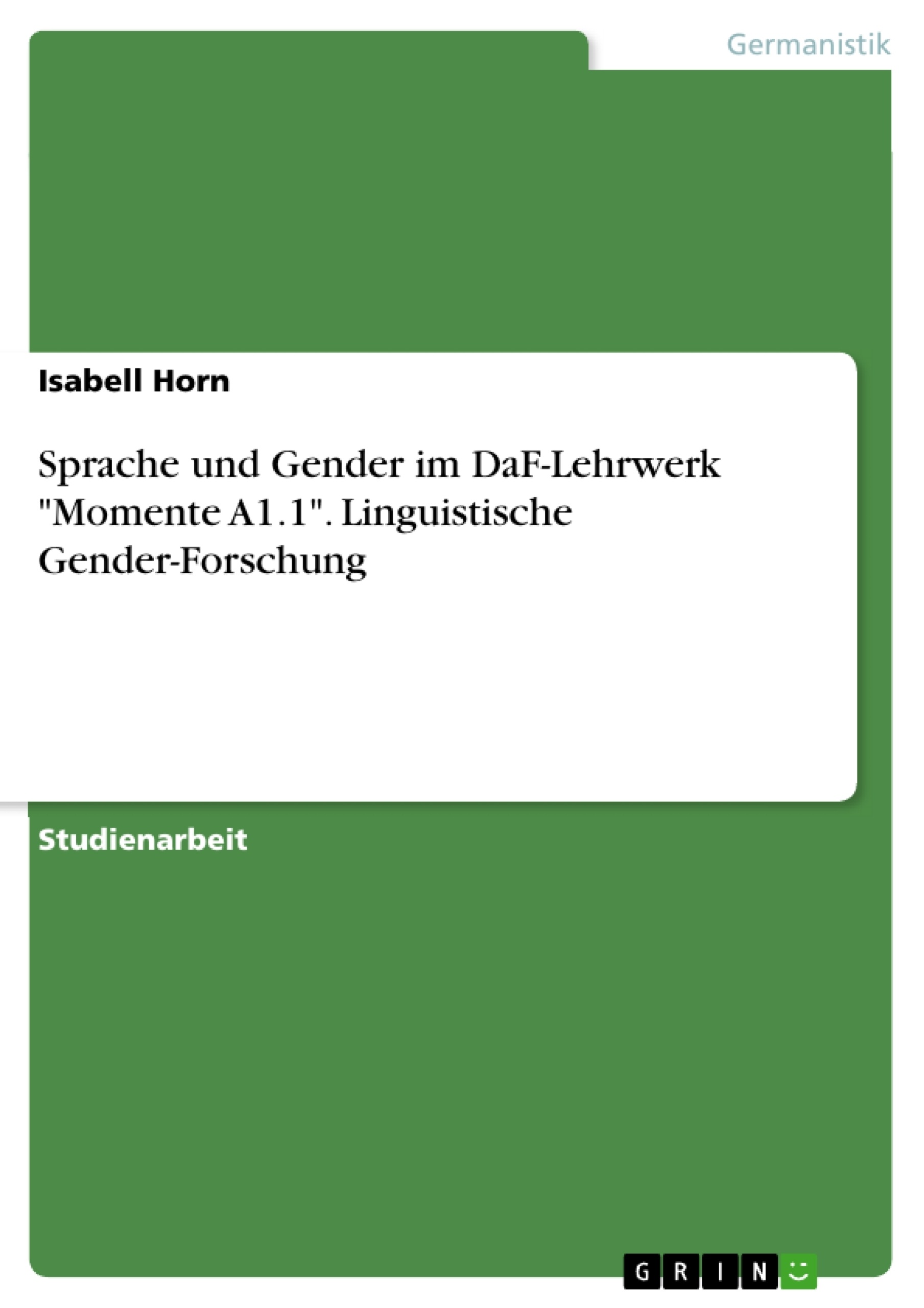Diese Arbeit untersucht das DaF-Lehrwerk "Momente A1.1" hinsichtlich der Gestaltung von Sprache und Gender. Es wird untersucht, wie häufig und auf welche Weise weibliche und männliche Personen dargestellt werden. Hierfür werden sowohl der Text als auch Abbildungen miteinbezogen. Anschließend werden die Berufe untersucht und überprüft, welche und auch wie viele Berufe beiden Geschlechtern zur Verfügung stehen. Ebenso werden geschlechterspezifisches Verhalten und Interessensgebiete näher durchleuchtet.
Auf sprachlicher Ebene werden Anrede und Personenbezeichnungen untersucht und überprüft, ob die Verwendung des generischen Maskulinums mithilfe von gendergerechten Bezeichnungen wie Beidnennung oder neutralen Bezeichnungen wesentlich reduziert oder sogar komplett ersetzt wurde. Da das Lehrwerk erst im Jahr 2020 erschien und es somit aktuell ist, liegt der Gedanke nahe, dass auf eine ausgewogene Darstellung von weiblichen und männlichen Personen geachtet wurde und auch auf sprachlicher Ebene mit der Verwendung von gendergerechter Sprache zu rechnen ist.
Zusammen mit den Lehrenden bildet das Lehrwerk das wichtigste Leitmedium im DaF-Unterricht. Renate Freudenberg-Findeisen erklärt es zur entscheidenden Quelle für fremdsprachlichen und fremdkulturellen Input. Denn Lehrwerke vermitteln weitaus mehr als nur Sprachkenntnisse: Neben Grammatik, kommunikativen Fähigkeiten und Wortschatz dienen sie in erster Linie als Basis, um die grundlegenden Normen und Werte, die für ein gesellschaftliches Miteinander in Deutschland hilfreich und zugleich erforderlich sind, kennenzulernen.
Dabei steht insbesondere die Vermittlung der Alltagskultur im Vordergrund, damit sich Neuankömmlinge zurechtfinden können und keine Tabus verletzen. Oft ist das Lehrbuch sogar einer der ersten Berührungspunkte mit der Sprache und vermittelt einen ersten Eindruck über die kulturellen Aspekte eines Landes, das für die Lernenden zunächst nicht vertraut ist. Das Erlernen einer neuen Sprache ist daher unweigerlich mit der Kultur verbunden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Hintergrund
- Ausgewählte Aspekte aus der linguistischen Gender-Forschung
- Grammatik und gendergerechte Sprache. Textuelle Repräsentation von Geschlechtern
- Zur Gendergerechtigkeit im Klassenraum
- Ausgewählte Aspekte aus der linguistischen Gender-Forschung
- Forschungsstand zu Analysen von DaF-Lehrwerken
- Analyse der DaF-Lehrbuchs Momente A1.1 (2020)
- Häufigkeit von weiblichen und männlichen Personen in Abbildungen und im Text
- Berufe
- Geschlechterspezifisches Verhalten und Interessensgebiete
- Sprache: Anrede und Personenbezeichnungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Darstellung von Sprache und Gender im DaF-Lehrwerk „Momente A1.1“. Ziel ist es, die Repräsentation von Geschlechtern in diesem Lehrwerk zu analysieren und aufzuzeigen, inwieweit es gendergerechte Sprache und eine geschlechterssensible Didaktik fördert. Hierfür werden ausgewählte Aspekte der linguistischen Gender-Forschung herangezogen und die Ergebnisse anhand des Lehrwerkes diskutiert.
- Gendergerechte Sprache und Repräsentation von Geschlechtern in Lehrwerken
- Geschlechterrollen und Stereotypen im DaF-Unterricht
- Die Bedeutung von Lehrwerken für die Sozialisation und Entwicklung von Lernenden
- Die Rolle von LehrerInnen bei der Förderung von gendergerechtem Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Sprache und Gender im DaF-Unterricht ein und beleuchtet die Bedeutung von Lehrwerken als Vermittlungsmedium. Sie verdeutlicht die Relevanz des Themas im Kontext der Sozialisation und Entwicklung von Lernenden. Kapitel 2 stellt den theoretischen Hintergrund der Arbeit dar. Es werden ausgewählte Aspekte der linguistischen Gender-Forschung beleuchtet, die für die Analyse des Lehrwerks relevant sind. Zudem wird die Bedeutung von Gendergerechtigkeit im Klassenraum diskutiert. Kapitel 3 bietet einen Überblick über den Forschungsstand zu Analysen von DaF-Lehrwerken. Es werden wichtige Studien und Forschungsansätze vorgestellt, die sich mit der Repräsentation von Sprache und Gender in Lehrwerken beschäftigen. Kapitel 4 analysiert das DaF-Lehrbuch „Momente A1.1“. Es wird die Häufigkeit von weiblichen und männlichen Personen in Abbildungen und im Text untersucht, sowie die Darstellung von Berufen, geschlechterspezifischen Verhaltensweisen und Interessengebieten. Zudem wird die Sprache des Lehrwerks hinsichtlich Anrede und Personenbezeichnungen analysiert.
Schlüsselwörter
DaF-Lehrwerk, Gender, Sprache, Repräsentation von Geschlechtern, Gendergerechte Sprache, Stereotypen, Sozialisation, Lehrerausbildung, Lehrbuchforschung, Analyse, Momente A1.1
Häufig gestellte Fragen
Was wurde im DaF-Lehrwerk „Momente A1.1“ untersucht?
Das Lehrwerk wurde auf die Darstellung von Gender und Sprache untersucht, insbesondere auf die Häufigkeit von Frauen und Männern in Text und Bild sowie die Verwendung gendergerechter Sprache.
Wird im Lehrwerk noch das generische Maskulinum verwendet?
Die Analyse prüft, ob das generische Maskulinum durch Beidnennungen oder neutrale Bezeichnungen ersetzt wurde, um eine inklusivere Sprache zu fördern.
Wie werden Berufe und Interessen im Buch dargestellt?
Es wird untersucht, ob Berufe und Interessensgebiete klischeefrei auf beide Geschlechter verteilt sind oder ob traditionelle Rollenstereotype reproduziert werden.
Warum sind Lehrwerke für die kulturelle Vermittlung so wichtig?
Lehrwerke vermitteln nicht nur Grammatik, sondern auch Normen und Werte der deutschen Gesellschaft. Sie sind oft der erste Berührungspunkt mit der Alltagskultur für Lernende.
Welche Rolle spielen Lehrende bei der Gendergerechtigkeit?
Zusammen mit dem Lehrwerk bilden Lehrende das wichtigste Leitmedium. Sie können eine geschlechtersensible Didaktik fördern und Stereotype im Unterricht kritisch hinterfragen.
- Quote paper
- Isabell Horn (Author), 2021, Sprache und Gender im DaF-Lehrwerk "Momente A1.1". Linguistische Gender-Forschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1006596