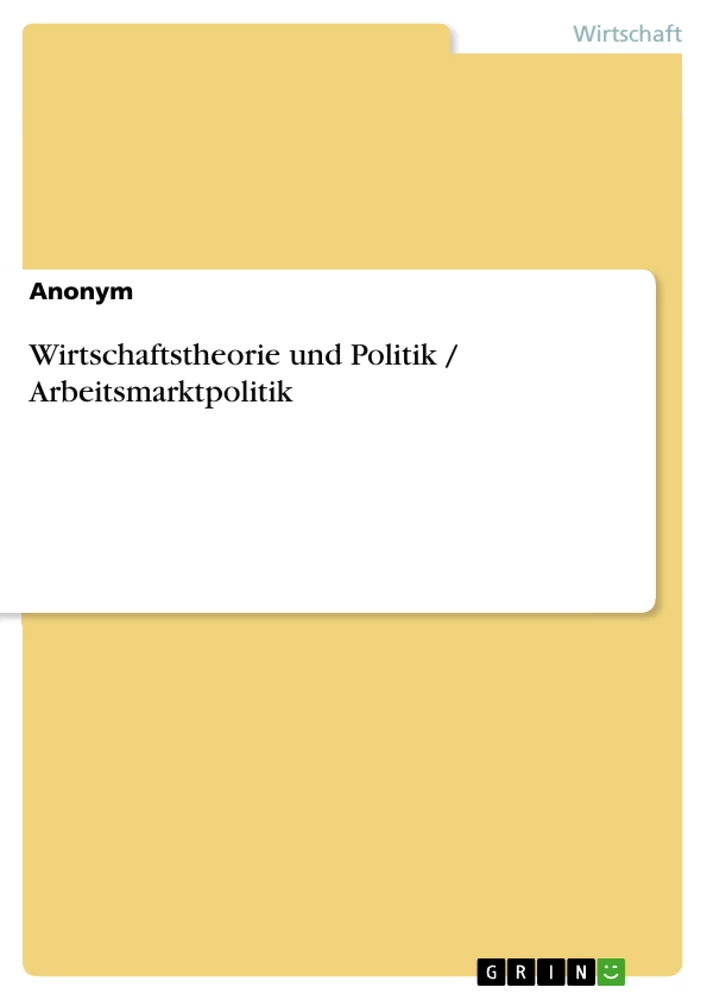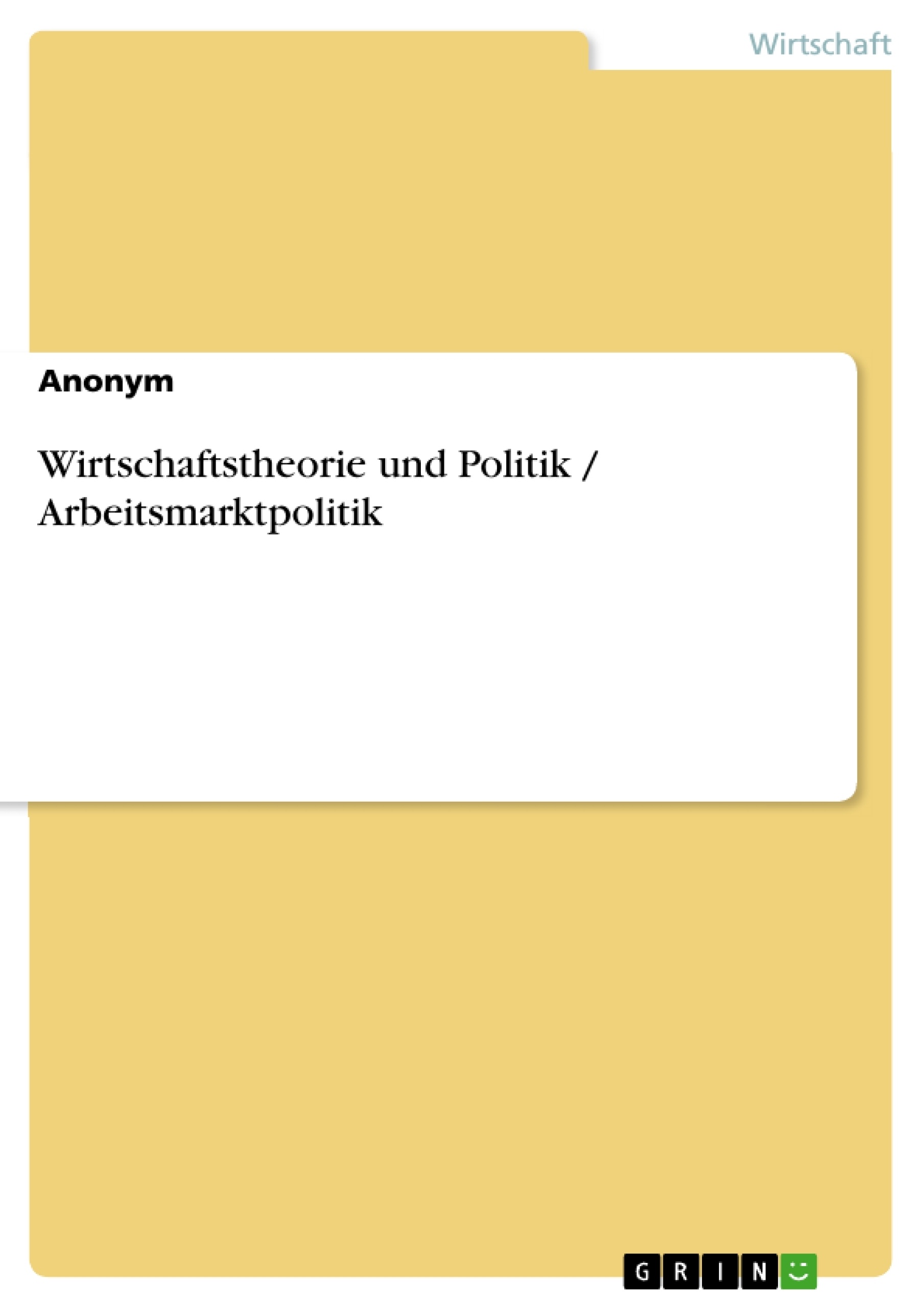Inhaltsverzeichnis
1. Problemstellung
2. Hauptteil
2.1 Arbeitsmarktpolitische Indikatoren
2.1.1 Arbeitslosenquote
2.1.2 Zahl der offenen Stellen
2.1.3 Struktur der Arbeitslosigkeit ( Problemgruppen )
2.1.4 Arbeitsvolumen ( geleistete Arbeitsstunden )
2.1.5 Geleistete Überstunden
2.1.6 Jobturnover
2.2 Beschäftigungspolitische Indikatoren
2.2.1 Konjunkturindikatoren
2.2.2 Inlandsprodukt
2.2.3 Zahl der Auftragsbestände
2.3.4 Geschäftsklima
2.3 Ursachen der Arbeitslosigkeit
2.3.1 Friktionelle Arbeitslosigkeit
2.3.2 Strukturelle Arbeitslosigkeit
2.3.3 Demografische Entwicklungen
2.3.4 Mangel an Schlüsselqualifikationen
2.3.5 Konjunkturelle Arbeitslosigkeit ( Nachfragerückgang )
2.3.6 technischer Fortschritt
2.3.7 Kapitalmangel
2.4 Ziele der Arbeits- und Beschäftigungspolitik
2.4.1 Freiheit, Sicherheit, Gerechtigkeit
2.5 Träger der Politik
2.5.1 Staatliche Träger
2.5.2 Private Träger
2.5.3 Internationale Träger
2.6 Instrumente
2.6.1 Der Arbeitsmarktpolitik
2.6.2 Der Beschäftigungspolitik
2.6.3 Ordnungspolitische Instrumente
2.6.4 Sonstige Instrumente
2.7 Vorschläge der OECD zur Bekämpfung der Alosigkeit
3. Schlußbetrachtung
1. Problemstellung
Volkswirtschaften unterliegen einem ständigen Strukturwandel. Es gibt Branchen, die Strukturkrisen unterworfen waren ( Textil- und Lederindustrie, Schiffbau ), oder deren Anpassung an Weltmarktentwicklungen durch staatliche Subventionierung verzögert wurde (Kohle, Landwirtschaft ). Es ist unmittelbar einsichtig, dass damit nicht nur Beschäftigungsschwankungen, sondern auch veränderte Anforderungen an die Beschäftigung und die Qualifikationsstruktur der Erwerbstätigen einhergehen.
So liegt die Arbeitslosenquote in Deutschland bei ca. 10,1% was ungefähr 4 Millionen Arbeitslose ausmacht, wobei man von weiteren 2 Millionen versteckten Arbeitslosen ausgehen muß. Das paradoxe daran ist, dass in Deutschland über eine Million Arbeitsplätze schon heute zu besetzen wären. Hier sieht man die Probleme der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik, zu denen ich jetzt eine Stellungnahme in Form eines Aufsatzes mit 11 Unterpunkten geben möchte.
2. Hauptteil
2.1 Arbeitsmarktpolitische Indikatoren
Arbeitsmarktpolitische Indikatoren sind Anzeiger, die den augenblicklichen Stand am Arbeitsmarkt darstellen sollen. Dabei sind diese mit einer gewissen Distanz zu betrachten, da sie sich mit einem raschen Tempo und bei verschiedenen Gegebenheiten ändern.
2.1.1 Arbeitslosenquote
Die Arbeitslosenquote wird regelmäßig von der Bundesanstalt für Arbeit ermittelt und steht im Zentrum der Analyse des Arbeitsmarktes mit seiner strukturellen, zeitlichen sowie regionalen Entwicklung. Der Anteil der Erwerbslosen an der Zahl der Erwerbspersonen wird als Arbeitslosenquote bezeichnet. Dabei muß man beachten, dass diese Quote nie den wirklichen Stand der Arbeitslosigkeit anzeigt, denn es gibt verschieden Kriterien, nach denen diese Quote ermittelt wird. Als Arbeitslos in Sinne der Statistik ist der Arbeit -suchende, der nicht in einem Beschäftigungsverhältnis steht und der Arbeitsvermittlung zur Verfügung steht, weil er sich persönlich beim Arbeitsamt gemeldet hat. Außerdem dürfen diese Personen das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und nicht schwer erkrankt sein.
Nicht jeder der Arbeitslos ist, läßt sich auch als Arbeitslos registrieren. Diese Zahl bezeichnet man als die "Stille Reserve".
2.1.2 Zahl der offenen Stellen
Die Zahl der offenen Stellen basiert auf Suchmeldungen, die die Unternehmen an die Arbeitsverwaltung geben. Sie wird jedoch niedriger sein als die tatsächlichen vorhandenen freien Stellen, weil die Unternehmen nicht jeden freien Arbeitsplatz melden, sondern auch andere Kanäle für Stellenausschreibungen ( Inserate, interne Stellenausschreibung) nutzen.
2.1.3 Struktur der Arbeitslosigkeit ( Problemgruppen )
Von besonderer Bedeutung für den Einsatz arbeitsmarktpolitischer Instrumente ist die genaue Analyse de Struktur der Arbeitslosigkeit. Damit lassen sich besondere "Problemgruppen" wie Jugendliche, Behinderte oder ältere Arbeitnehmer identifizieren.
2.1.4 Arbeitsvolumen
Unter dem Arbeitsvolumen kann man die Gesamtheit aller in einer Volkswirtschaft in einer Periode geleisteten Arbeitsstunden verstehen. Dies wäre eine zutreffendere Meßgröße für die Beschäftigung als die Zahl der Erwerbstätigen. Hier besteht das Problem, dass die Arbeitgeber lieber Überstunden anordnen als neue Mitarbeiter einstellen.
2.1.5 Geleistete Überstunden
Aus diesem Problem läßt sich der nächste Indikator, die geleisteten Überstunden, ableiten. Damit sind die über die tarifliche oder betriebsübliche Arbeitszeit hinaus geleisteten Arbeitsstunden gemeint.
2.1.6 Jobturnover
Unter dem Jobturnover als Bruttogröße wird die Summe aus Bruttostellengewinnen ( Einstellung ) und Bruttostellenverlustes ( Entlassung, Konkurs ) verstanden. Das bedeutet also einen ständigen Ab- und Zugang der Beschäftigten.
2.2 Beschäftigungspolitische Indikatoren
Der Unterschied zwischen den arbeitsmarktpolitischen und den beschäftigungspolitischen Indikatoren liegt darin, dass der Staat unmittelbar in die Beschäftigungspolitik eingreifen kann, wenn es zum Beispiel zu Konjunkturschwächen kommt.
2.2.1 Konjunkturindikatoren
Die einzelnen Phasen des Konjunkturzyklus´ lassen sich durch die Veränderungen einer Vielzahl ökonomischer Größen beschreiben. Läßt sich zum Beispiel erkennen, dass eine Rezession vor der Tür steht könnte der Staat durch Subventionen diese Konjunktur-schwäche überbrücken und die Unternehmen würden ihre Arbeiter behalten.
2.2.2 Inlandsprodukt
Das Inlandsprodukt mißt den Konjunkturverlauf und läßt ohne zeitliche Verzögerung erkennen wann es zu einem Rückgang der Beschäftigung kommen könnte. Somit ist das Inlandsprodukt ein Präsensindikator.
2.2.3 Zahl der Auftragsbestände
Die Zahl der Auftragsbestände ist ein typischer Frühindikator. Diese Zahl hat die Aufgabe, die Auftragsbestände für die nächsten Perioden ( z.B. Monate ) anzuzeigen. Damit ist zu ersehen, wie die Auftragslage eines Unternehmens ist und ob Arbeitskräfte benötigt werden oder eine Entlassung droht.
2.2.4 Geschäftsklima
Dieser Indikator hat in der Geschichte eine beträchtliche Größe gespielt. So wurde z.B. die Krise des Bergbaus vorhergesagt und der Staat kannte früh anfangen diese Branche zu subventionieren und abzubauen.
2.3 Ursachen und Arten der Arbeitslosigkeit
Auf dem Arbeitsmarkt kommt es nur selten zu einem Ausgleich von Nachfrage und Angebot von Arbeitsleistungen. Dies führt meistens zur Arbeitslosigkeit, nur in den seltensten Ausnahmen zu einer Überbeschäftigung. Dafür gibt es verschieden Gründe und verschiedene Arten der Arbeitslosigkeit.
2.3.1 Friktionelle Arbeitslosigkeit
Diese Art der Arbeitslosigkeit liegt an der fehlenden Markttransparenz. Das heißt, dass es zwar freie Stellen gibt, es aber an geeigneten Bewerbern fehlt.
2.3.2 Strukturelle Arbeitslosigkeit
Von struktureller Arbeitslosigkeit spricht man, wenn wegen fehlender Mobilität und Flexibilität der Arbeitnehmer und Unternehmer nicht bereit oder in der Lage sind, den Standort bzw. die Arbeitsstätte, den Beruf oder die Branche zu wechseln.
2.3.3 Demografische Entwicklungen
Das Arbeitsangebot hängt insbesondere von den demografischen Entwicklungen ab. Haben wir einen Babyboom, so wird es in der Zeit wenn diese Babies das Arbeitsalter erreicht haben, zu einen Mangel an Arbeitsplätzen kommen. Andersherum kann es so kommen, dass es zu wenig Nachwuchs in der Gesellschaft gibt und die Volkswirtschaft veraltet. Dies ist momentan in Deutschland der Fall. Man rechnet damit, dass es im Jahr 2010 zu wenige Arbeitsuchende geben wird.
2.3.4 Mangel an Schlüsselqualifikationen
Ist das Bildungssystem nicht in der Lage, für die Wirtschaft geeignete Bewerber auszubilden, so wird es zu einem Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Beschäftigtenmarkt kommen. Dies ist ein aktuelles Thema in Deutschland ( Stich-wort: Greencard ).
2.3.5 Konjunkturelle Arbeitslosigkeit
Bei schwacher Konjunktur wird es, wie es die Geschichte zeigt, einen Rückgang der Nachfrage nach Gütern kommen. Das heißt die Lager werden ausgelastet und Arbeitnehmer werden wegen zu geringer Auslastung entlassen.
2.3.6 Technischer Fortschritt
Denken wir einmal zurück in die Zeit als es noch keinen Fließband gab. Die Arbeit wurde von den Menschen Mühevoll per Hand erledigt. Mit dem Fließband kam die Arbeitslosigkeit, weil die Maschinen die Menschen ersetzten.
2.3.7 Kapitalmangel
Eine weitere Ursache für die Arbeitslosigkeit ist der Kapitalmangel. Dieses tritt ein, wenn ein Unternehmer durchs Sparen und durch Investitionen keine neuen Arbeitskräfte einstellen kann.
2.4 Ziel der Arbeits- und Beschäftigungspolitik
2.4.1 Freiheit, Sicherheit, Gerechtigkeit
Das Ziel überhaupt der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik ist die Vollbeschäftigung.
Gibt es wenige Arbeitslose in einer Volkswirtschaft, so ist Innerer Frieden fast garantiert, denn die Sozialversicherungsbeiträge werden sinken. Außerdem ist Arbeit ein wichtiger Faktor der Selbstverwirklichung. Ein hoher Beschäftigungsgrad entspricht einer hohen Güterversorgung.
2.5 Träger der Politik
Es bedarf einen stillen Beobachter, der diese Politik überwacht und steuert.
2.5.1 Staatliche Träger
Die staatlichen Träger dieser Politik sind die Arbeitsämter der Bundesanstalt für Arbeit.
Diese ist im Bund, in den Ländern und Gemeinden vertreten.
2.5.2 Private Träger
Die privaten Träger sind die Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, die durch Manteltarifverträge und sonstiges versuchen, die Arbeitsbedingungen für beide Seiten zu verbessern. Dabei gibt es noch das "Bündnis für Arbeit" , das die Koordination zwischen den privaten und den staatlichen Trägern ermöglichen soll.
2.5.3 Internationale Träger
Die Europäische Kommission und die ILO ( Internationale Arbeitsorganisation ) sind die Internationalen Träger der Politik. Hier konzentriert sich die Kommission um das Euroland und die ILO um die restliche Welt um die Grundgesetze in die Arbeitswelt zu verankern.
2.6 Die Instrumente
2.6.1 Der Arbeitsmarktpolitik
Hier kann man zwischen passiven und aktiven Instrumenten unterscheiden.
Die aktiven Instrumente sind Maßnahmen für den Arbeitsmarktausgleich wie die Arbeitsvermittlung, Berufsberatung und Umschulungen, für die Arbeitsbedingungen wie die Arbeitszeitregelungen oder den Kündigungs- , Mutter- und Arbeitsschutz und für den Arbeitsplatz- und Arbeitskräfteangebot wie ABM, Kurzarbeitergeld und der Bildung.
Die passiven Instrumente sind die Zahlungen von Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe.
2.6.2 Der Beschäftigungspolitik
Die Instrumente der Beschäftigungspolitik beziehen sich auf das Angebot und die Nachfrage nach Arbeit. So kann der Staat z.B. durch Einkäufe die Nachfrage erhöhen und durch Zuschüsse für eine Neueinstellung die Unternehmer dazu locken, Arbeitnehmer aus den Problemgruppen einzustellen.
2.6.3 Ordnungspolitische Instrumente
Ordnungspolitisch von Bedeutung sind die Maßnahmen zur Gestaltung der Arbeitsbedingungen durch entsprechende Gesetzlage wie z.B. den Arbeitszeitschutz.
2.6.4 Sonstige Instrumente
Zu den sonstigen Instrumenten gehört zum Beispiel die Arbeitnehmerüberlassung. Gemeint damit ist die Leiharbeit, die seit kurzem in Deutschland immer mehr Anhänger findet. Wird ein Arbeiter ausgeliehen, soll der Unternehmer die Chance haben, diesen Leiharbeiter einstellen zu können.
2.7 Vorschläge der OECD zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
OECD ist das Kürzel für die Organization for Economic Cooperation and Development. Diese Organisation hat im Jahre 1994 einen beträchtlichen Katalog unterbreitet, aus dem aktuelle Vorschläge zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit zu erlesen sind.
Diese Vorschläge betreffen meistens die Indikatoren und Instrumente der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik auf die ich im zweiten Teil dieses Aufsatzes eingegangen bin, deswegen werde ich diese nicht weiter berücksichtigen.
3. Schlußbetrachtung
Es liegt auf der Hand, dass das Problem der Arbeitslosigkeit bekämpft werden muß.
Seit dem Beginn der Globalisierung ist dies nicht nur in Deutschland notwendig.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptthemen dieses Dokuments über Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik?
Dieses Dokument behandelt umfassend die Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik in Deutschland. Es erörtert Indikatoren, Ursachen, Ziele, Akteure und Instrumente der Politik. Es werden auch Vorschläge der OECD zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit erörtert.
Welche arbeitsmarktpolitischen Indikatoren werden in diesem Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt die Arbeitslosenquote, die Zahl der offenen Stellen, die Struktur der Arbeitslosigkeit (Problemgruppen), das Arbeitsvolumen (geleistete Arbeitsstunden), geleistete Überstunden und den Jobturnover.
Welche beschäftigungspolitischen Indikatoren werden in diesem Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt Konjunkturindikatoren, das Inlandsprodukt, die Zahl der Auftragsbestände und das Geschäftsklima.
Welche Ursachen für Arbeitslosigkeit werden in diesem Dokument erörtert?
Das Dokument erörtert friktionelle Arbeitslosigkeit, strukturelle Arbeitslosigkeit, demografische Entwicklungen, Mangel an Schlüsselqualifikationen, konjunkturelle Arbeitslosigkeit (Nachfragerückgang), technischen Fortschritt und Kapitalmangel.
Welche Ziele verfolgt die Arbeits- und Beschäftigungspolitik laut diesem Dokument?
Das Dokument nennt als Ziel die Vollbeschäftigung, die Freiheit, Sicherheit und Gerechtigkeit gewährleisten soll.
Welche Träger der Arbeits- und Beschäftigungspolitik werden in diesem Dokument genannt?
Das Dokument nennt staatliche Träger (Arbeitsämter der Bundesanstalt für Arbeit), private Träger (Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände) und internationale Träger (Europäische Kommission und ILO).
Welche Instrumente der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik werden in diesem Dokument beschrieben?
Das Dokument unterscheidet zwischen passiven und aktiven Instrumenten der Arbeitsmarktpolitik (Arbeitsvermittlung, Umschulungen, Arbeitszeitregelungen, Kündigungsschutz, Arbeitslosengeld, etc.) und beschreibt Instrumente der Beschäftigungspolitik, die auf Angebot und Nachfrage nach Arbeit abzielen (Subventionen, Zuschüsse für Neueinstellungen).
Was sind ordnungspolitische Instrumente im Kontext der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik?
Ordnungspolitische Instrumente umfassen Maßnahmen zur Gestaltung der Arbeitsbedingungen durch entsprechende Gesetzgebung, wie beispielsweise den Arbeitszeitschutz.
Was ist mit "sonstige Instrumente" gemeint?
Hier ist die Arbeitnehmerüberlassung gemeint. Hierbei soll der Unternehmer die Chance haben, diesen Leiharbeiter einstellen zu können.
Welche Vorschläge der OECD zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit werden kurz erwähnt?
Das Dokument erwähnt, dass die OECD 1994 einen Katalog von Vorschlägen unterbreitet hat, die hauptsächlich die Indikatoren und Instrumente der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik betreffen, welche bereits im Aufsatz behandelt wurden.
Was ist die Schlussfolgerung des Dokuments?
Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist unerlässlich für den sozialen Frieden und die soziale Gerechtigkeit, insbesondere im Kontext der Globalisierung. Der Aufsatz will die Wichtigkeit dieses Problems für eine funktionierende Volkswirtschaft hervorheben.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2001, Wirtschaftstheorie und Politik / Arbeitsmarktpolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100716