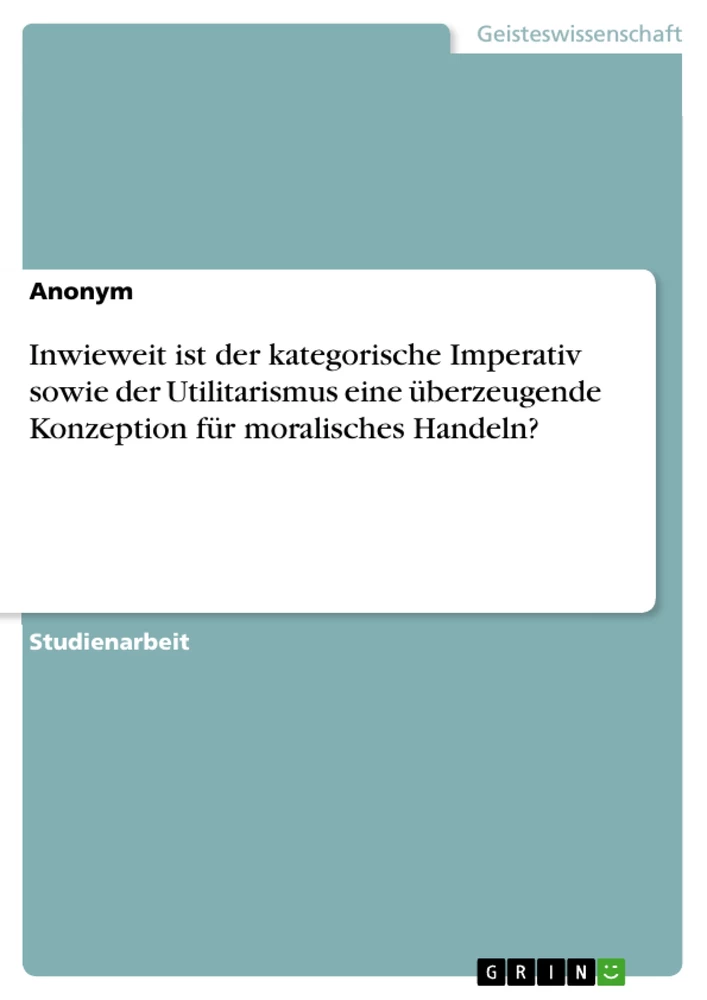Doch woran sollte der moralischen Wert einer Handlung allumfassend gemessen werden? Welche Kriterien sollten erfüllbare Voraussetzung für eine überzeugende Moralkonzeption abgeben? Diese Hausarbeit bezieht sich auf zu beachtende und möglichst elementare Faktoren bei der Handlungswahl, eine Abwägung und kritische Auseinandersetzung dieser wesentlichen Bezugspunkte anhand der zwei genannten und philosophisch bekannten Moralkonzeptionen. Hierbei sollen sowohl die Strukturen beider Grundformeln erläutert und infrage gestellt werden. Dabei erfolgt unter anderem eine Stützung auf die bedeutenden Werke von Immanuel Kant und John Stuart Mill. Weniger zentral soll die Unterteilung einer Handlung in Bezug auf die Neigungen als Motiv des Handelnden werden. Eine Handlung aus persönlichen Vorzügen und somit aus Neigung, kann ebenso der moralisch richtigen Entscheidung entsprechen oder dieser widersprechen. Dennoch erscheint der eigene Vorteil als bloßes Motiv der Handlung nicht moralisch einwandfrei zu sein, von außen schwer zu beurteilen und demnach hat dies keinen zentralen Platz in einer tragfähigen Moralkonzeption.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Vorstellung beider Moralkonzeptionen
- 2.1 Der Kategorische Imperativ
- 2.2 Der Utilitarismus
- 3 Diskussion: Stärken und Schwächen der Positionen
- 4 Abwägung der Moralkonzeptionen
- 5 Fazit: Die Lösung bei moralischen Entscheidungen?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Überzeugungskraft des kategorischen Imperativs und des Utilitarismus als Konzeptionen für moralisches Handeln. Sie analysiert die Stärken und Schwächen beider Ansätze und wägt deren Anwendbarkeit in der Praxis ab. Die Arbeit zielt darauf ab, ein besseres Verständnis für die Herausforderungen bei der Bestimmung moralisch richtiger Handlungen zu entwickeln.
- Der kategorische Imperativ nach Immanuel Kant
- Der Utilitarismus nach Jeremy Bentham und John Stuart Mill
- Stärken und Schwächen beider Moralkonzeptionen
- Anwendbarkeit der Konzeptionen im Alltag
- Kriterien für eine überzeugende Moralkonzeption
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der moralischen Herausforderungen und der Suche nach einer überzeugenden Moralkonzeption ein. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Überzeugungskraft des kategorischen Imperativs und des Utilitarismus und skizziert den Aufbau der Arbeit. Die Einleitung betont die Bedeutung der Berücksichtigung elementarer Faktoren bei der Handlungswahl und die kritische Auseinandersetzung mit den beiden ausgewählten Moralkonzeptionen.
2 Vorstellung beider Moralkonzeptionen: Dieses Kapitel präsentiert den kategorischen Imperativ Kants und den Utilitarismus von Bentham und Mill. Es erklärt die Grundprinzipien beider Konzepte und legt den Fokus auf die jeweiligen Handlungsregeln und deren Anwendung. Der Abschnitt beleuchtet die unterschiedlichen Ansätze beider Philosophen, moralisch richtige Handlungen zu bestimmen. Die Ausführungen konzentrieren sich auf die Kernaspekte der beiden Moralkonzeptionen und bieten eine solide Grundlage für die spätere kritische Auseinandersetzung.
3 Diskussion: Stärken und Schwächen der Positionen: Dieser Teil analysiert die Stärken und Schwächen des kategorischen Imperativs und des Utilitarismus. Es werden Argumente für und gegen die Anwendbarkeit und Überzeugungskraft beider Konzeptionen im Kontext moralischer Entscheidungen diskutiert. Dieser Abschnitt evaluiert die jeweiligen Vor- und Nachteile der Konzepte und untersucht deren Limitationen in der Praxis.
4 Abwägung der Moralkonzeptionen: Dieses Kapitel vergleicht und kontrastiert den kategorischen Imperativ und den Utilitarismus, um ihre jeweilige Eignung als Grundlage für moralisches Handeln zu bewerten. Es erfolgt eine gewichtete Abwägung der stärksten und schwächsten Punkte beider Ansätze im Hinblick auf ihre praktische Anwendbarkeit. Der Fokus liegt auf der Identifizierung der jeweils vorteilhaftesten Aspekte beider Konzeptionen und der Herausarbeitung ihrer Grenzen.
Schlüsselwörter
Kategorischer Imperativ, Utilitarismus, Moralphilosophie, moralisches Handeln, Immanuel Kant, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Handlungsethik, Maxime, Universalisierbarkeit, Nutzenmaximierung, Pflicht, Neigung.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Kategorischer Imperativ vs. Utilitarismus
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit vergleicht und kontrastiert den kategorischen Imperativ (Kant) und den Utilitarismus (Bentham und Mill) als Konzeptionen für moralisches Handeln. Sie analysiert die Stärken und Schwächen beider Ansätze und bewertet deren praktische Anwendbarkeit. Die Arbeit umfasst eine Einleitung, die Vorstellung beider Moralkonzeptionen, eine Diskussion ihrer Stärken und Schwächen, einen Abwägungsteil und ein Fazit.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die zentralen Themen sind der kategorische Imperativ nach Kant, der Utilitarismus nach Bentham und Mill, die Stärken und Schwächen beider Moralkonzeptionen, deren Anwendbarkeit im Alltag und Kriterien für eine überzeugende Moralkonzeption. Die Arbeit untersucht, welcher Ansatz überzeugender für moralische Entscheidungen ist.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einleitung, 2. Vorstellung beider Moralkonzeptionen (mit Unterkapiteln zum kategorischen Imperativ und Utilitarismus), 3. Diskussion der Stärken und Schwächen, 4. Abwägung der Moralkonzeptionen und 5. Fazit. Jedes Kapitel fasst seine Inhalte prägnant zusammen.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Überzeugungskraft des kategorischen Imperativs und des Utilitarismus. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und betont die Bedeutung der Berücksichtigung elementarer Faktoren bei der Handlungswahl und die kritische Auseinandersetzung mit den beiden Moralkonzeptionen.
Wie werden der kategorische Imperativ und der Utilitarismus vorgestellt?
Kapitel 2 erläutert die Grundprinzipien, Handlungsregeln und Anwendung beider Konzepte. Es beleuchtet die unterschiedlichen Ansätze zur Bestimmung moralisch richtiger Handlungen und konzentriert sich auf die Kernaspekte beider Moralkonzeptionen.
Wie werden die Stärken und Schwächen der Moralkonzeptionen diskutiert?
Kapitel 3 analysiert die Vor- und Nachteile sowie die Limitationen des kategorischen Imperativs und des Utilitarismus in Bezug auf ihre Anwendbarkeit und Überzeugungskraft bei moralischen Entscheidungen.
Wie werden der kategorische Imperativ und der Utilitarismus verglichen?
Kapitel 4 vergleicht und kontrastiert beide Konzeptionen, um ihre Eignung als Grundlage für moralisches Handeln zu bewerten. Es erfolgt eine Abwägung der Stärken und Schwächen im Hinblick auf die praktische Anwendbarkeit.
Welche Schlussfolgerung zieht die Hausarbeit?
Das Fazit (Kapitel 5) fasst die Ergebnisse zusammen und bietet eine Antwort auf die Forschungsfrage nach der Lösung bei moralischen Entscheidungen im Kontext des kategorischen Imperativs und des Utilitarismus.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Hausarbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Kategorischer Imperativ, Utilitarismus, Moralphilosophie, moralisches Handeln, Immanuel Kant, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Handlungsethik, Maxime, Universalisierbarkeit, Nutzenmaximierung, Pflicht, Neigung.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2020, Inwieweit ist der kategorische Imperativ sowie der Utilitarismus eine überzeugende Konzeption für moralisches Handeln?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1007192