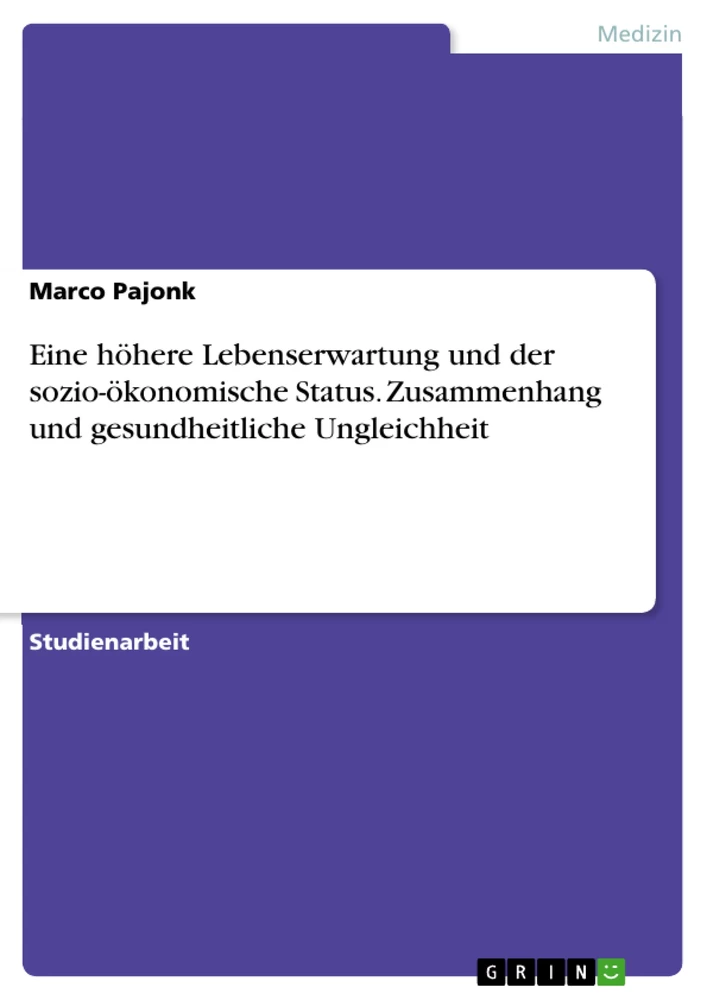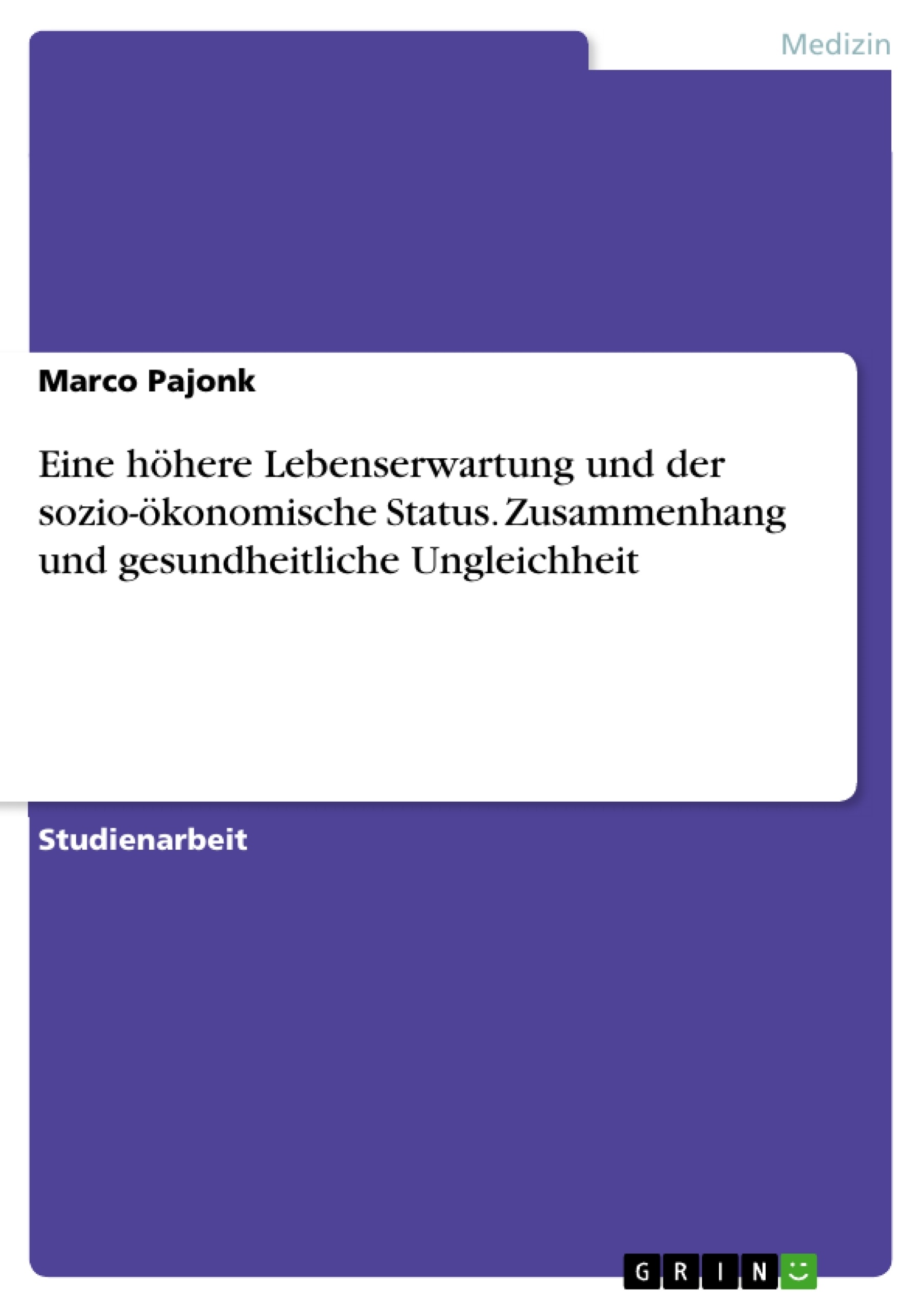Diese Arbeit handelt von der Lebenserwartung und dem gesundheitlichem Status auf nationaler Ebene und der Kausalität zwischen Lebenserwartung, gesundheitlichem Status, und sozialer und ökonomischen Lage.
Immer wieder wird uns vor Augen geführt, wie beinflussbar die Lebenserwartung, wie abhängig der gesundheitliche Status von der sozialen als auch von der ökonomischen Lage des Einzelnen wie auch der Gesellschaft ist. Auffällig dabei erscheint, dass es nicht allein von einem erhöhten Einkommen wie oft propagiert wird abhängig ist, wie hoch die Lebenserwartung und die Gesundheit dadurch sein wird.
Denn auch ein hohes Einkommen, bestimmt nicht die gesundheitliche Lage und damit gleichzeitig ein hohes Alter des Einzelnen oder der Gesellschaft. Vielmehr lassen sich Aspekte wie Lebensstile und Belastungsfaktoren im jeweiligen Lebenslauf/verlauf ausmachen, die sich in Gesundheitlichen Unterschieden (health inequality) und gesundheitlichen Ungleichheiten (health inequity) widerspiegeln.
Als Gesundheitliche Unterschiede (health inequality) lassen sich allgemein die Unterschiede im Gesundheitszustand (Morbidität und Mortalität) nach Merkmalen der sozialen Differenzierung (u.a. Alter, Geschlecht, Region) bezeichnen. Gesundheitliche Ungleichheit (health inequity) stellt eine wertende und normative Komponente dar welcher als ungerecht empfundener gesundheitlicher Unterschied bezeichnet wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Methodisches Vorgehen
- 2.1 Suchmethode - Schneeballprinzip – Methode
- 2.2 Suche 1 - Suche in Bibliothekssystem Universität Hamburg
- 2.3 Suche 2 - Suchbegriff – Lebenserwartung
- 2.4 Suche 3 - Suchbegriff – Gesundheitlicher Status
- 2.5 Suche 4 - Suchbegriff - soziale und Ökonomische Lage
- 3. Ergebnisse
- 3.1 Lebenserwartung und gesundheitlicher Status auf nationaler Ebene
- 3.2 Höhere Lebenserwartung und besserer gesundheitlicher Status durch bessere soziale und Ökonomische Lage
- 3.2.1 Lebenserwartung
- 3.2.2 soziale und Ökonomische Lage
- 3.2.3 Kausalität zwischen Lebenserwartung, gesundheitlichen Status, soziale und Ökonomische Lage
- 4. Diskussion
- 4.1 Diskussion der Ergebnisse
- 4.2 Reflektion des eigenen Vorgehens
- 4.3 Fazit
- 5. Literaturverzeichnis
- 6. Abbildungen
- 7. Anlageverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen sozioökonomischer Lage, gesundheitlichem Status und Lebenserwartung. Ziel ist es, die Auswirkungen sozialer und ökonomischer Faktoren auf die Gesundheit zu analysieren. Die Methodik umfasst eine Literaturrecherche, um bestehende Erkenntnisse zu diesem Thema zu beleuchten.
- Einfluss sozioökonomischer Faktoren auf die Lebenserwartung
- Zusammenhang zwischen sozialer Lage und gesundheitlichem Status
- Analyse der Kausalität zwischen den drei Variablen
- Methodische Reflexion der durchgeführten Literaturrecherche
- Auswertung relevanter Daten auf nationaler Ebene
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der gesundheitlichen Ungleichheit und des Zusammenhangs zwischen sozioökonomischer Lage, Lebenserwartung und gesundheitlichem Status ein. Sie beschreibt die Relevanz des Themas und skizziert den Aufbau der Arbeit.
2. Methodisches Vorgehen: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die angewandte Methode der Literaturrecherche. Es erläutert das Schneeballprinzip als Suchstrategie und detailliert die Suchvorgänge in verschiedenen Datenbanken, unter Verwendung spezifischer Suchbegriffe wie "Lebenserwartung", "Gesundheitlicher Status" und "soziale und ökonomische Lage". Die verschiedenen Suchstrategien werden präzise dargestellt und begründet.
3. Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Literaturrecherche. Es beginnt mit einer Darstellung der Lebenserwartung und des gesundheitlichen Status auf nationaler Ebene. Der Hauptteil befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen höherer Lebenserwartung, besserem gesundheitlichen Status und besserer sozioökonomischer Lage. Die Ergebnisse werden in Bezug auf Lebenserwartung, soziale und ökonomische Lage sowie die Kausalität zwischen diesen drei Faktoren analysiert und präsentiert.
Schlüsselwörter
Gesundheitliche Ungleichheit, Lebenserwartung, sozioökonomische Lage, gesundheitlicher Status, Literaturrecherche, Kausalität, nationale Ebene, Methodologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Zusammenhang zwischen sozioökonomischer Lage, gesundheitlichem Status und Lebenserwartung
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen sozioökonomischer Lage, gesundheitlichem Status und Lebenserwartung. Das Ziel ist die Analyse der Auswirkungen sozialer und ökonomischer Faktoren auf die Gesundheit.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Methodik basiert auf einer Literaturrecherche, die das Schneeballprinzip als Suchstrategie nutzt. Die Suche erfolgte in verschiedenen Datenbanken (z.B. Bibliothekssystem Universität Hamburg) mit spezifischen Suchbegriffen wie "Lebenserwartung", "Gesundheitlicher Status" und "soziale und ökonomische Lage". Die Suchstrategien werden detailliert beschrieben und begründet.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse präsentieren zunächst die Lebenserwartung und den gesundheitlichen Status auf nationaler Ebene. Der Schwerpunkt liegt auf dem Zusammenhang zwischen höherer Lebenserwartung, besserem gesundheitlichen Status und besserer sozioökonomischer Lage. Die Analyse umfasst die drei Faktoren Lebenserwartung, soziale und ökonomische Lage und die Kausalität zwischen ihnen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Methodisches Vorgehen, Ergebnisse, Diskussion (inkl. Ergebnisdiskussion, Reflexion des Vorgehens und Fazit), Literaturverzeichnis, Abbildungen und Anlageverzeichnis.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Gesundheitliche Ungleichheit, Lebenserwartung, sozioökonomische Lage, gesundheitlicher Status, Literaturrecherche, Kausalität, nationale Ebene, Methodologie.
Wie ist der Aufbau der Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema einführt und den Aufbau skizziert. Es folgt ein Kapitel zum methodischen Vorgehen, welches die Literaturrecherche detailliert beschreibt. Die Ergebnisse werden im dritten Kapitel präsentiert, bevor die Diskussion die Ergebnisse reflektiert und ein Fazit zieht. Abschließend folgen Literaturverzeichnis, Abbildungen und Anlagenverzeichnis.
Welche Aspekte der sozioökonomischen Lage werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht den Einfluss sozioökonomischer Faktoren auf die Lebenserwartung und den gesundheitlichen Status. Der genaue Umfang der betrachteten Faktoren wird im Text detailliert beschrieben, aber die Zusammenfassung konzentriert sich auf den allgemeinen Einfluss dieser Faktoren.
Wie wird die Kausalität zwischen den Variablen untersucht?
Die Arbeit analysiert die Kausalität zwischen Lebenserwartung, gesundheitlichem Status und sozioökonomischer Lage. Die genaue Methode der Kausalitätsanalyse wird im Text detailliert erläutert.
Auf welcher Ebene werden die Daten ausgewertet?
Die Auswertung relevanter Daten erfolgt auf nationaler Ebene.
- Citar trabajo
- Marco Pajonk (Autor), 2021, Eine höhere Lebenserwartung und der sozio-ökonomische Status. Zusammenhang und gesundheitliche Ungleichheit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1007266