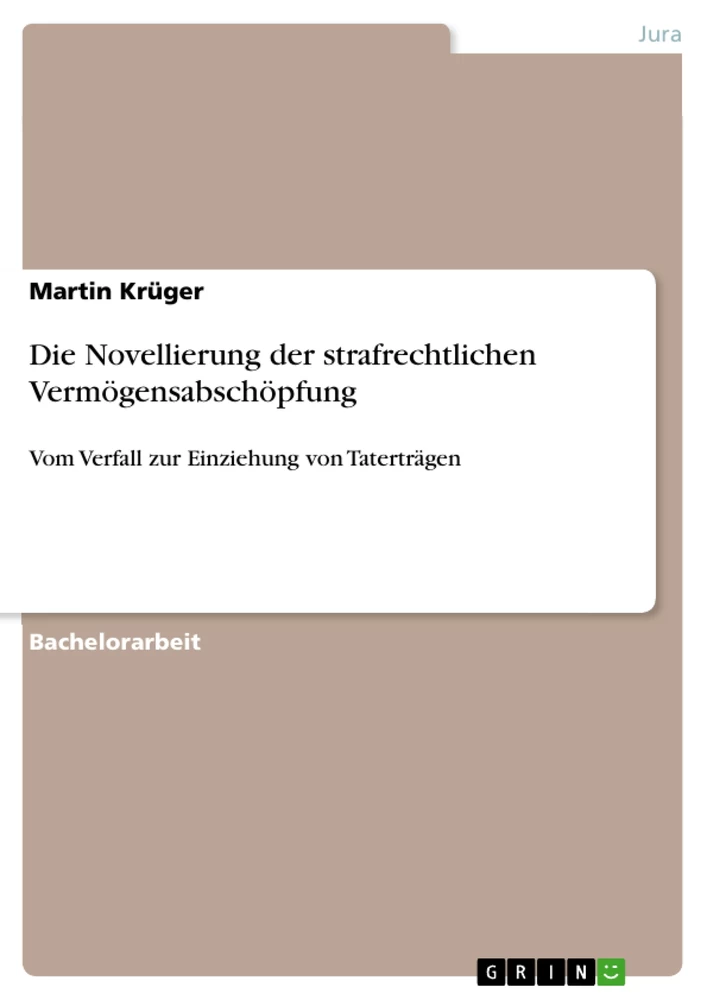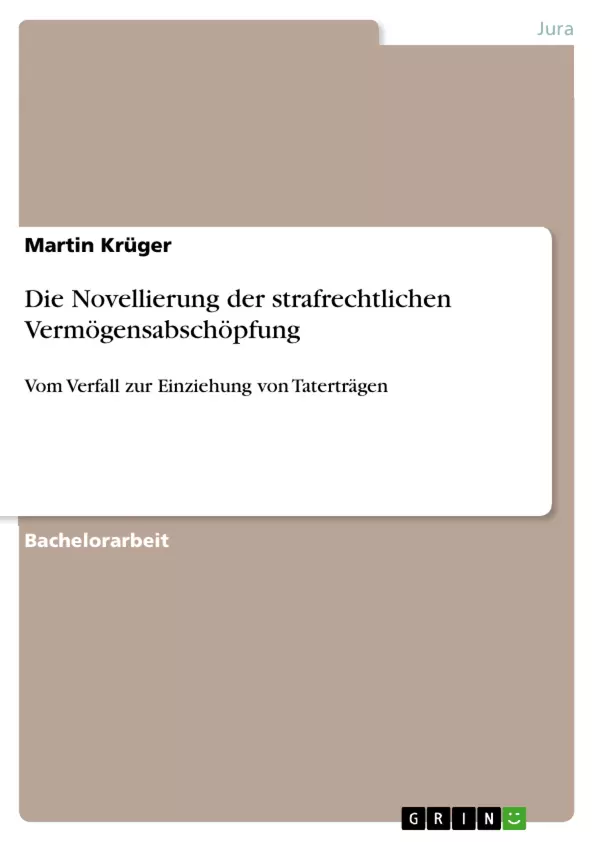In der folgenden Bearbeitung wird sich der Thematik durch Analyse und Bewertung der gesetzlichen Grundlagen und deren Änderungen der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung hinsichtlich der Einziehung von Taterträgen (ehemals Verfall) unter unmittelbarer Berücksichtigung der juristischen Methodik, der Rechtsprechung und der fachspezifischen Kommentarliteratur angenommen.
Dazu werden zunächst zentrale Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung dargestellt. Anschließend wird die in Verbindung mit vermögensabschöpfenden Maßnahmen stehende Grundrechtsrelevanz näher beleuchtet. Dem schließt sich eine schwerpunkt- und problembezogene Darstellung der bis zum 30.06.2017 geltenden Gesetzeslage an, um letztlich die novellierte Gesetzeslage mit ihren wesentlichen Änderungen und kritischer Hinterfragung und Problemdarstellung aufzuzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmungen
- Grundrechtsbetroffenheit
- Eigentumsgarantie nach Art. 14 GG
- Allgemeine Verhaltensfreiheit nach Art. 2 Abs. 1 GG
- Gesetzeslage bis zum 30.06.2017
- Inhalt der Gesetzeslage
- Täterbezogener Verfall
- Vertreterklausel und Verfall bei Dritteigentum
- Wertersatzverfall
- Erweiterter Verfall
- Ausschluss des Verfalls aufgrund Rechte Dritter
- Sicherung des Verfalls
- Rückgewinnungshilfe
- Selbstständige Anordnung
- Problemstellungen der Gesetzeslage
- Inhalt der Gesetzeslage
- Novellierte Gesetzeslage seit dem 01.07.2017
- Inhalt der Reform
- Materielles Recht
- Einziehung von Taterträgen nach § 73 StGB
- Einziehung von Taterträgen bei anderen
- Einziehung des Wertes von Taterträgen
- Bestimmung des Wertes des „Erlangten“
- Erweiterte Einziehung
- Selbstständige Einziehung
- Ausschluss der Einziehung
- Prozessuales Recht
- Vorläufige Sicherungsmaßnahmen
- Entschädigung des Verletzten
- Materielles Recht
- Kritik an der aktuellen Gesetzeslage
- Inhalt der Reform
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Novellierung der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung. Das Ziel ist es, die Reform des Verfallsrechts, die zum 01.07.2017 in Kraft trat, zu analysieren und zu bewerten.
- Entwicklung der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung
- Grundrechtsbetroffenheit durch die Vermögensabschöpfung
- Vergleich des alten und neuen Verfallsrechts
- Kritikpunkte an der aktuellen Gesetzeslage
- Zukünftige Herausforderungen der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Thematik der Bachelorarbeit vor und erläutert die Relevanz des Themas. Außerdem wird die Struktur der Arbeit kurz dargestellt.
- Begriffsbestimmungen: In diesem Kapitel werden wichtige Begriffe aus dem Bereich der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung definiert. Dazu gehören beispielsweise „Verfall“, „Einziehung“ und „Taterträge“.
- Grundrechtsbetroffenheit: Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung auf Grundrechte. Insbesondere werden die Eigentumsgarantie nach Art. 14 GG und die allgemeine Verhaltensfreiheit nach Art. 2 Abs. 1 GG betrachtet.
- Gesetzeslage bis zum 30.06.2017: Das Kapitel beschreibt die strafrechtliche Vermögensabschöpfung vor der Reform zum 01.07.2017. Es werden die verschiedenen Formen des Verfalls sowie die damit verbundenen Problemfelder dargestellt.
- Novellierte Gesetzeslage seit dem 01.07.2017: Dieses Kapitel beleuchtet die Reform des Verfallsrechts und beschreibt die wesentlichen Änderungen im materiellen und prozessualen Recht. Die Neuerungen werden kritisch hinterfragt und bewertet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit widmet sich der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung und befasst sich mit den zentralen Themen der Einziehung von Taterträgen, der Grundrechtsbetroffenheit, der Reform des Verfallsrechts sowie den aktuellen Herausforderungen in diesem Bereich. Dabei werden sowohl die theoretischen Grundlagen der Vermögensabschöpfung als auch die praktische Anwendung der rechtlichen Regelungen beleuchtet.
Häufig gestellte Fragen
Was änderte sich durch die Reform der Vermögensabschöpfung zum 01.07.2017?
Die Reform ersetzte den Begriff „Verfall“ durch „Einziehung“ und vereinfachte die Abschöpfung von Taterträgen, um sicherzustellen, dass sich Straftaten nicht lohnen.
Welche Grundrechte sind durch die Vermögensabschöpfung betroffen?
Primär betroffen sind die Eigentumsgarantie (Art. 14 GG) und die allgemeine Verhaltensfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG), da der Staat in das Privatvermögen eingreift.
Was bedeutet „Einziehung des Wertes von Taterträgen“?
Wenn der ursprüngliche Gegenstand (z. B. ein gestohlenes Auto) nicht mehr vorhanden ist, kann das Gericht die Einziehung eines Geldbetrages anordnen, der dem Wert des Erlangten entspricht.
Was ist die „selbstständige Einziehung“?
Sie erlaubt die Einziehung von Vermögenswerten auch dann, wenn keine bestimmte Person wegen der Tat verurteilt werden kann (z. B. wegen Verjährung oder Tod des Täters).
Wie wird der Schutz der Opfer (Verletzten) durch die Reform verbessert?
Das neue Recht sieht vor, dass die Justiz das Vermögen sichert und die Entschädigung der Verletzten im Rahmen des Strafverfahrens erleichtert wird.
- Quote paper
- Martin Krüger (Author), 2018, Die Novellierung der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1007530