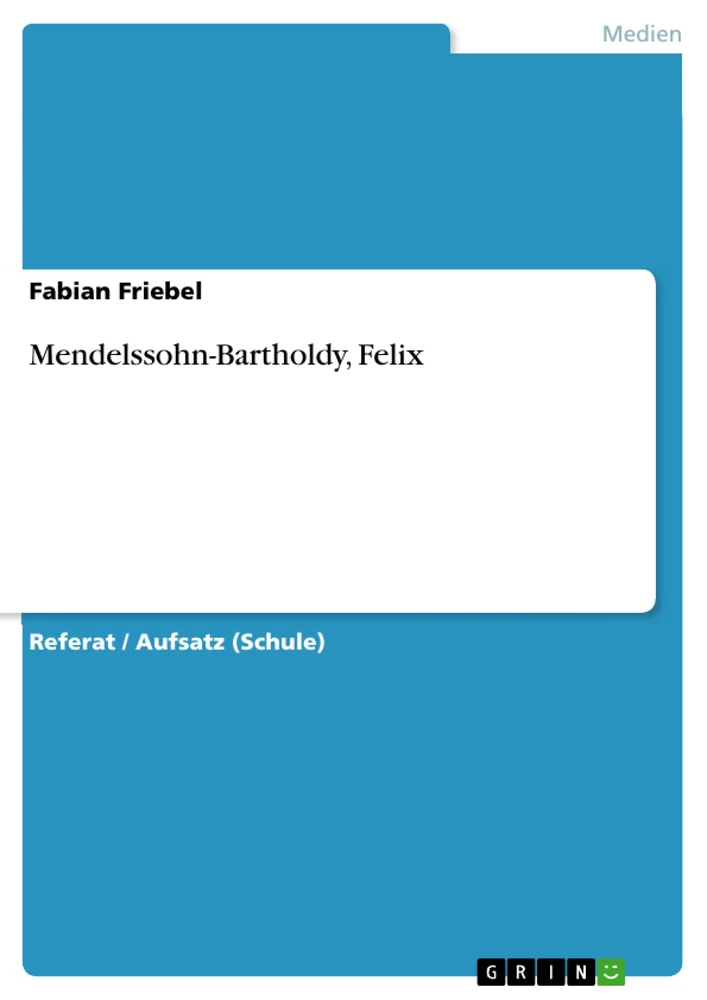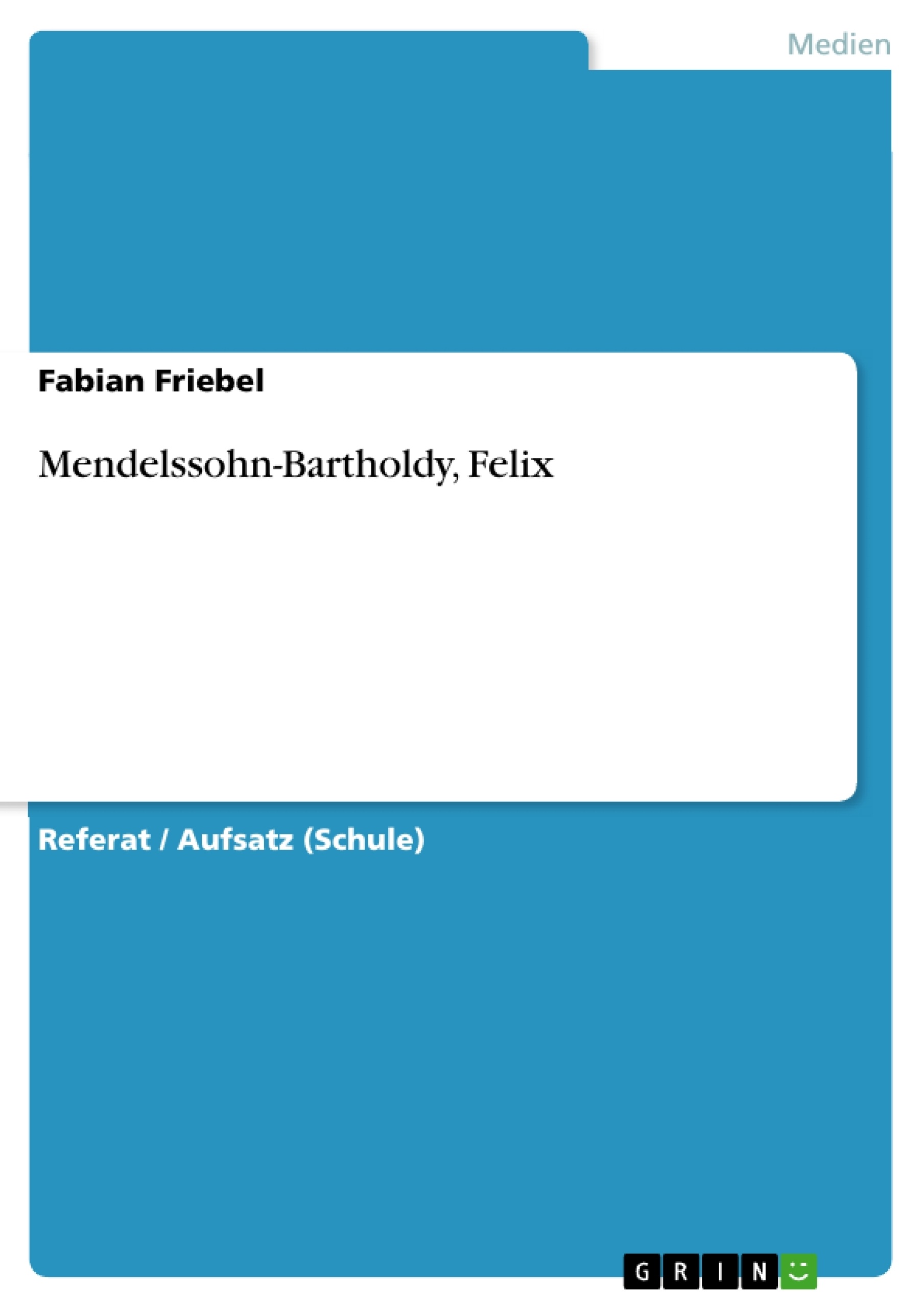( Jacob Ludwig ) Felix Mendelssohn Bartholdy
Biographie:
- geb. 3.2.1809 in Hamburg; gest. 4.11.1847 in Leipzig
- deutscher Komponist und Dirigent; Sohn eines Bankiers Abraham M.
- große Bedeutung bei Erziehung: rasch erworbener Wohlstand aufgeklärte Gesinnung des Vaters
- Unterricht in allgem. Fächern durch Privatlehrer K. W. Heyse
- 1814 frühe musikal. Begabung zunächst durch Mutter im Klavierspiel gefördert
- 1815 Privatunterricht für Felix und seine Schwester Fanny
- 1816 mehrmonatiger Aufenthalt in Paris
- 1816 Klavierunterricht bei Ludwig Berger, Violine bei W. Henning und Eduart Rietz
- Unterricht in Sprachen bei dem Vater des Dichters Paul Heyse; in der Zeichenkunst durch Maler Rösel
- 1818 öffentliche Aufführungen als Pianist ( z.B. bei „ Sonntagsmusiken “im Elternhaus )
- 1819 Musiktheorie bei Carl Friedrich Zelter
- 1820 Eintritt in die Berliner Singakademie
- ab 1820 erste Kompositionen; lernt Weber, Goethe und Hummel kennen
- Förderung seiner Bildung auf Reisen:
- 1821 Reise nach Weimar zu J. W. von Goethe
- 1822 Familienreise in die Schweiz
- 1825 Geschäftsreise mit dem Vater nach Paris > Bekanntschaft mit Luigi Cherubini => von 1812 - 1825: 4 Singspiele, 13 Streichersinfonien, 3 Doppelkonzerte, 2 Solokonzerte, Kammermusik, Klaviermusik
- 1826 Immatrikulierung an der Berliner Universität
> Vorlesungen von Hegel (Ästhetik, Philosophie) und von Gans (Geschichte der Freiheitsbewegung und Französische Revolution)
- 1826 Ouvertüre zum „ Sommernachtstraum “
- 1827 Begegnung mit Justus Thibaut in Heidelberg > Hinweise auf die Musik zu früheren Epochen
- Wiedererweckung der großen Chorwerke Bachs und Händels
> 11. März 1829 vollständige Wiederaufführung von Bachs Matthäuspassion in der Berliner Singakademie > Beginn der modernen Bach - Rezeption
- 1829 Reise nach England (London, Liederspiel: „Die Heimkehr aus der Fremde“) und Schottland (Schottische Sinfonie und Hebriden - Ouvertüre)
- 3jährige Bildungsreise z.B. nach:
1830 Weimar ( erneuter Besuch bei Goethe ) > München > Wien > Venedig > Florenz > Rom
1831 Neapel > Rom > Florenz > Mailand > in die Schweiz > München > Paris
1832 Weiterreise nach London (April ) > Heimkehr nach Berlin ( Juni )
- 1830/31 Italienreise (Italienische Sinfonie) / Kapellmeister im Gewandhaus in Leipzig
- 1832/33 ? nach dem Tode Zelters Kandidierung für das Amt des Dirigenten der Berliner Singakademie > Niederlage
- 1833 Leitung des 1. Niederrheinischen Musikfestes in Düsseldorf
> 1833/34 städtischer Musikdirektor am Düsseldorfer Theater/1834 „Paulus“
> 1835/36, 1839, 1846 Leiter der Musikfeste mit Wiederaufführung Händelscher Oratorien
- 1835 Leitung der Leipziger Gewandhauskonzerte
- erster Dirigent mit Taktstock; Einführung einer modernen Orchesterdisziplin
- 1836 Ernennung zum Dr. phil. h. c. durch Leipziger Universität
- 1837 Hochzeit mit Cecile Jeanrenaud (5 Kinder), permanente Konzertreisen
- 1841 Umzug nach Berlin (komp. am Hofe) Versuch Friedrich Wilhelms IV. M. ständig an Berlin zu binden
- 1842 siebte Reise nach England > Empfang bei Königin Victoria
- Gründung des Leipziger Konservatoriums ( Eröffnung am 3. April 1843 ) aufgrund der lokkeren Bindung zu Berlin
- 1843 (Sommer) Reorganisierung des Domchores in Berlin > Scheiterung
- 1844 (Frühjahr) abermalige Englandreise
- 1845 (Herbst) Wiederübernahme der Leitung der Gewandhauskonzerte in Leipzig
> Loslösung von Berlin endgültig
- 1846 UA Oratorium „Elias“ in Birmingham > 1 Jahr später Neufassung in Frankfurt/Main
- nach der Nachricht vom Ableben seiner Schwester Fanny + infolge eines Gehirnschlages Beschleunigung seines Endes
- Beisetzung auf dem Dreifaltigkeitsfriedhof in Berlin
- geachteter Dirigent, Orchesterleiter, Organisator und Komponist
- bedeutender Vertreter der deutschen Romantik, mit klassizistischen Zügen
Werke:
Orchestermusik:
- 13 Sinfonien 1820/25
- 3 Konzertouvertüren > „ Die Hebriden “ 1832
- Konzerte ( V., O., K. )
Kammermusik:
- 3 Klaviertrios
- Klavierquartette, - sextette
- Streichquartette, -quintette
- Sonaten
Klaviermusik:
- Sonaten
- Variationswerke > „ Lieder ohne Worte “ 1833/45
Orgelmusik:
- 3 Präludien und Fugen 1837
- 6 Sonaten
Musikbühnenwerke:
- Singspiele > „ Die Hochzeit des Camacho “ 1824/25 1826 ?
Liederspiel „ Die Heimkehr aus der Fremde “ 1829
Schauspielmusik zu:
- „ Antigone “ ( Sophokles ) 1841
- Shakespeares Komödie „ Ein Sommernachtstraum “ 1825
Vokalmusik:
- 2 Kantaten > „ Die erste Walpurgisnacht “ ( Goethe ) 1842
Festgesang „ An die Künstler “ ( Schiller ) 1846
- Oratorien > „ Paulus “ 1836 (für Düsseldorf )
„ Elias “ 1846 ( für Birmingham )
- Psalmvertonungen, Chorlieder
Zeit und Stil anhand eines Werkes:
Romantik: deutsch R. 1800 - 1870
- in Dichtung, Musik, bildender Kunst
- Prägung: Empfindsamkeit, Vorgängen der Fr. Revolution, Gegenbewegung zu Rationa-
-lismus und Klassik, Ausdruck von Empfindungen
in einer begriffslosen Metasprache magische und geheimnisvolle Wiedergabe des innersten Wesens der Welt inform von autonomer Kunst
- Kennzeichen: wenig Neuansätze > Verfeinerung Differenzierung der vorhandenen Mittel
Auflösung der klaren Satzstrukturen der Wiener Klassik
Verfeinerung der Harmonik bis zur totalen Durchsetzung mit Chromatik neue Mischklänge in Instrumentation und Klangfarbe
- 4 Stilphasen: Früh-, Hoch-, Spät-, Nachromantik
- Fülle verschiedener Erscheinungen:
musikdramatische Gesamtkunstwerke
symphonische Dichtungen
Klassizismus
arabesker Klavierstil
Betonung kleiner und überdimensionaler Formen
Rückgriff auf das Volkslied
Virtuosentum der Instrumentalisten
Entstehung nat. Schulen in Nord- und Osteuropa
Musikwissenschaft, Musikkritik
kommerzialisierte bürgerliche Konzertwesen
eigenständige Unterhaltungsmusik
Klassizismus:
jeder Stil zum Zeitpunkt seiner reifsten Ausprägung
Richtungen, die sich an dem Vorbild der klassischen Antike orientieren und deren Ideale der klaren Strenge und Ruhe wieder einführen wollen
- hohe Wertschätzung durch seine Zeitgenossen infolge seines Personalstiles
>Formung durch: vorausschauende, auf den Ideen der Aufklärung aufbauende Erziehung in Anlehnung an klassische Vorbilder
- Beschäftigung / Studium anderer Künstler: Mozart, Beethoven, Franz Schubert, Carl Maria von Weber, Bach
Stil:
- Stil: eigenständig entwickelt
Kennzeichen: kleingliedrige Motive
gesteigerte Chromatik
- thematische Bindung an: lyrischen Liedcharackter
Nachzeichnung von Naturerlebnissen
literarische Vorbilder und Übersetzungen der Zeit
die der Romantik zugehörige Sphäre der Feen, Hexen, Kobolde den ethischen Kern
der protestantischen Glaubenslehre
- meisterliche Synthese zw. Klass. Satzstil und romant. Ausdruck:
in seiner schlanken Instrumentierung und geschmeidigen Molodik im 19. Jh. unerreicht
Werk: Sommernachtstraum Komödie
-Griechenland vom 23. Zum 24. Juni
- Palast des Herzogs Theseus in Athen: Vater mit seiner Tochter Hermia + 2 Männern
Hermia + Demetrius ( Adliger ) > liebt aber Lysander ( Dichter )
2 Tage Zeit zur Entscheidung: bis zur Hochzeit des Herzogs
> wollen fliehen
Helena ( Freundin von Hermia ) erfährt davon und folgt mit Demetrius in den Wald
- Handwerkerhütte: Handwerker Bühnenstück für Hochzeit des Herzogs > Probe im Wald
- Wald: Reich des Elfenkönigs Oberon und Königin Titania > Streit um indischen Knaben
Oberon > List: Puck ( Kobold ) sol mit dem Saft der purpurnen Zauberblume die
Augen der Königin betreufeln > verliebt sich in den ersten den sie sieht
( Handwerker mit Eselskopf > Dank Pucks )
Puck betreufelt nicht nur die Augen der Königin > Verwirrungen und Täuschungen
Oberon beendet das Treiben: Hermia + Lysander
Helena + Demetrius
- gem. Hochzeit aller 3 Paare in Athen > Aufführung des Stückes der Handwerker
„ König Pyramus und Thisbe “
Rückkehr der Elfen mit Oberon und Titania > Segnung des Hauses der Neuvermählten
Musik
während des ersten Aktes schweigt Musik ( im Palast von Herzog Theseus + Handwerkerhütte ) Einleitung: 4 Holzbläserakkorde ( kicherndes scherzo )> Tor in eine geheimnisvolle Traumwelt
- Reich der Feen: leichtfüßiger Elfenmarsch > Streicher: pianissimo das derb - polternte Treiben der Rüpel wachrufen der Elementargeister
- schwereloses duftiges Lied mit dem die Elfen Titania in den Schlaf singen
- Intermezzo Hermias rastlos kreisende Bewegtheit < verzweifelte Suche nach Lysander
Horn im Nocturne singt von der Seligkeit einer Waldnacht
- festlich pompöser Hochzeitsmarsch > Einleitung des Schlußaktes: Theseus feiert seine Vermählung mit Hippolyta
> ihnen zu Ehren führen Handwerker ihr einfältiges Spiel von König Pyramus und Thisbe auf
> nach Selbstmord des Pyarmus tragikkomische Untermalung im c-mol Trauermarsch Bergamaske der Rüpeltanz, greift auf das Rüpelthema der Ouvertüre zurück
- Herzog macht dem seltsamen Treiben ein Ende
Kontrast durch szenischen Wirbel des Bühnenstücks
Vorhang/Beginn nur 7 ( nicht 8 ) Takte > Inkongruenz und Asymetrie
heller Klang führt in plagaler Kadenz in leuchtendem E-Dur in die Höhe
Ablösung der Bläser durch Streicher > programmatischer Kontrast der Weite und Nähe umfaßt
eigentliches Hauptthema in mol verfaßt
Protest gegen klassische Themenarbeit
rotierende Motivketten erscheinen statisch und verleugnen jede Evolution
Ausfall eines Basses; Streichersatz emanzipiert
Entrücktheit des Klanges
präludierende Tendenz des ganzen Satzes > romantisches Phänomen ( p. = Phantasie ) 1842 weitere Sätze zur Ouvertüre
Robert Schumann: „ Das ist ein Necken und Scherzen in den Instrumenten, als spielten sie die Elfen selbst. “
ergolgreichstes Orchesterwerk M.
rasche Verbreitung über Landesgrenzen > 1830 ( drei Jahre nach 1. Aufführung in Stettin ) in New York Sommernachtstraum - Ouvertüre in einem Konzertprogramm
-
- bewertet als liebenswerten, konservativen, romantischen Träumer
- im dritten Reich verboten
- heute: Beginn einer ernsthaften Beschäftigung mit seinen Werken
Häufig gestellte Fragen zu Felix Mendelssohn Bartholdy
Wer war Felix Mendelssohn Bartholdy?
Felix Mendelssohn Bartholdy war ein deutscher Komponist und Dirigent, geboren am 3. Februar 1809 in Hamburg und gestorben am 4. November 1847 in Leipzig. Er stammte aus einer wohlhabenden Bankiersfamilie und genoss eine umfassende Ausbildung.
Was waren einige wichtige Stationen in Mendelssohns Leben?
Zu den wichtigen Stationen gehören seine frühe musikalische Förderung, Unterricht bei verschiedenen Lehrern (z.B. Ludwig Berger, Carl Friedrich Zelter), öffentliche Auftritte als Pianist, Reisen nach Weimar zu Goethe, Paris und in die Schweiz, die Wiederaufführung von Bachs Matthäuspassion im Jahr 1829, Reisen nach England und Schottland, sowie die Leitung der Leipziger Gewandhauskonzerte.
Welche bedeutenden Werke hat Mendelssohn komponiert?
Mendelssohns Werk umfasst Orchestermusik (Sinfonien, Ouvertüren, Konzerte), Kammermusik (Klaviertrios, Quartette, Quintette, Streichquartette, Sonaten), Klaviermusik (Sonaten, Variationswerke, Lieder ohne Worte), Orgelmusik (Präludien und Fugen, Sonaten), Musikbühnenwerke (Singspiele, Schauspielmusik zu "Ein Sommernachtstraum"), und Vokalmusik (Kantaten, Oratorien wie "Paulus" und "Elias", Psalmvertonungen, Chorlieder).
Welche Einflüsse prägten Mendelssohns Stil?
Mendelssohns Stil wurde durch seine aufklärerische Erziehung, die Beschäftigung mit klassischen Vorbildern (Mozart, Beethoven, Schubert, Weber, Bach) und die Strömungen der Romantik geprägt. Er entwickelte einen eigenständigen Stil mit kleingliedrigen Motiven, gesteigerter Chromatik und thematischer Bindung an lyrischen Liedcharakter, Naturerlebnisse, literarische Vorbilder und die Welt der Feen und Kobolde.
Was ist die Bedeutung von Mendelssohns "Sommernachtstraum"?
Die Schauspielmusik zu "Ein Sommernachtstraum" ist eines seiner bekanntesten und erfolgreichsten Werke. Sie umfasst die Ouvertüre, einen Elfenmarsch, ein Intermezzo, ein Nocturne und einen Hochzeitsmarsch. Die Musik spiegelt die verschiedenen Szenen und Stimmungen des Stücks wider, von der Welt des Palastes und der Handwerker bis zum Reich der Feen.
Wie wurde Mendelssohn zu seiner Zeit wahrgenommen?
Mendelssohn wurde zu seiner Zeit hoch geschätzt und beeinflusste die Musikwelt maßgeblich. Er trat für politische Reformen ein und wurde in der NS-Zeit verboten, heute setzt sich die Forschung vermehrt mit seinem Werk auseinander.
Was war Mendelssohns Rolle bei der Wiederentdeckung von Bachs Musik?
Mendelssohn spielte eine entscheidende Rolle bei der Wiederentdeckung und Popularisierung der Musik von Johann Sebastian Bach. Seine Aufführung der Matthäuspassion im Jahr 1829 gilt als Beginn der modernen Bach-Rezeption.
Was ist unter Klassizismus im Bezug auf Mendelssohn zu verstehen?
Mendelssohn zeigt klassizistische Züge in seinen Kompositionen. Der Klassizismus bezieht sich auf Richtungen, die sich an der klassischen Antike orientieren und deren Ideale der klaren Strenge und Ruhe wiederaufleben lassen.
- Citar trabajo
- Fabian Friebel (Autor), 2001, Mendelssohn-Bartholdy, Felix, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100790